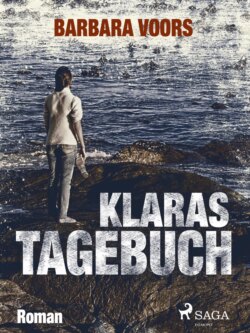Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеIrgendwo in mir ist ein kleines Mädchen, das schreit. Ich bin nur groß geworden, um es zum Schweigen zu bringen. Ich bin klug und kompetent geworden, bin völlig intakt und besitze Integrität, genau wie Klara es vorausgesehen, wie Klara es sich gewünscht hat. Ich habe geglaubt, mich immer richtig entschieden zu haben: daß ich mir nur ein Kind angeschafft habe, um rückhaltlos auf den Beruf setzen zu können, daß ich mich damit unerbittlich gezwungen habe, jemand zu werden, genausogut wie jede andere, oder richtiger, besser als jede andere Frau und ganz entschieden besser als jeder Mann. Wie ich es jetzt sehe, gibt es gute Gründe dafür, warum ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Ich weiß noch, wie ich als Kind, ich war vielleicht acht Jahre alt, meiner Mutter eine Frage gestellt habe, von der sie sich nie wieder erholt hat. Ich selbst habe es auch nicht. Ich hatte lange Zeit nach weiblichen Vorbildern in Berufen gesucht: unter den Freunden meiner Eltern, in Geschichtsbüchern, in den Fernsehnachrichten, in den Lehrbüchern. Aber wohin ich mich auch wandte, hörte ich nur von Männern berichten, mein eigenes Geschlecht kam äußerst selten vor. Was ich also gefragt habe, war: »Wohin verschwinden all die Frauen?«
Wir haben es alle gesehen, man kann ihm nur schwer entgehen: dem Rückschlag der Emanzipation. Daß Frauen niedrigere Löhne erhalten, daß nur wenige Prozent der gesellschaftlichen Machtpositionen von Frauen besetzt sind, daß der Mann die Norm und die Frau die Ausnahme ist, daß nur wenige Männer mit ihren Kindern daheim bleiben, daß die Frau zum Objekt gemacht und Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Und immer so weiter. Das ist es, worin ich meine Berufung sehe, ich kann nicht nur Tatsachen feststellen und mich dann nicht weiter um sie kümmern. Es ist meine Aufgabe, die Diskussion voranzutreiben, Fakten zu sammeln, ständig daran zu erinnern. Ich fordere das Äußerste von meinen Studenten, von meinen Mitmenschen und von mir selbst. Ich akzeptiere keine Entschuldigungen, kein Hohnlächeln, keine verharmlosenden Diskussionen, keine plumpen Scherze. Ich betrachte es als meine Pflicht, an Ungerechtigkeiten zu erinnern, aber ich will auch Möglichkeiten aufzeigen. Wie ich es sehe, gibt es keinen Weg daran vorbei. Es gibt Unmengen von Theorien, warum es so gekommen ist, jeder hat seine eigene. Es gibt unzählige Statistiken, Pläne und Bemühungen um eine Antwort, die alle zufriedenstellend erscheinen – und dennoch hat man das Gefühl, nur ins Leere zu greifen. Es ist aufreibend, etwas zu wissen, das ganz offenbar richtig ist, und dennoch auf so viel Widerstand zu stoßen.
Ihr braucht mir nicht zuzustimmen. Die Diskussion läuft schon seit Ewigkeiten. Magnus und ich haben nächtelang darüber geredet. Ich weiß auch, daß dieses Thema eine ganze Tischgesellschaft seufzen lassen kann und man nur hofft, daß der Nachtisch bald käme, glaubt mir, selbst ich habe die Sache manchmal satt. Aber versucht mir trotzdem zu antworten: Wohin verschwinden denn die Frauen? Nur das will ich wissen, trotz des Risikos, als Nervensäge zu gelten. Wo sind all die weiblichen Chefs, Professoren, Forscher, Preisträger, Dirigenten, Komponisten, Aufsichtsratsvorsitzenden, Abgeordneten und Präsidenten? Ich überlege, ich ahne es, doch obwohl ich versucht habe, so konsequent wie möglich zu leben, habe auch ich keine Antwort. Manchmal glaube ich, daß ich mein Leben der Suche nach einer Antwort gewidmet habe, die es nicht gibt, aber ich bleibe dabei, wenn aus keinem anderen Grunde, dann Klaras wegen, damit sie nicht vergebens gestorben ist.
Weshalb krame ich jetzt in diesen Papieren? Ich sitze auf dem Dachboden, und das sanfte Licht des schwedischen Sommermorgens dringt durch das kleine staubige Dachfenster. Es scheint, als wollte jeder Vogel, der dort draußen zwitschert, bloß das eine wissen: Was machst du hier, Saskia? Wenn dein Leben so vollkommen ist – trotz des momentanen Einbruchs – und dich deine Erinnerungen nur peinigen, weshalb wühlst du dann in diesen Papieren?
Vielleicht, um mich selbst wiederzufinden. Irgendwo in den Tagebüchern meiner Schwester befindet sich der Schlüssel zu derjenigen, die ich heute bin. Niemand sollte die Tagebücher seiner Jugend lesen müssen. Es reicht, die von Klara zu lesen, um zu begreifen, warum. Mein Vorsatz, nur zu leben und nicht rückwärts zu schauen, die Arbeit als großes Glück und als Erlösung anzusehen – all das fiel an dem Tag, als ich in der Prinsengracht unter ein Fahrrad geriet, gleichsam in sich zusammen. Ich war kein Ganzes mehr, und als Magnus sich über mich beugte, war es, als würde meine Stimme zehn Jahre jünger, verschwunden war die tüchtige Saskia, und zurückgeblieben war diese äußerst dünne Stimme, die ich nur zu gut kannte: »Erzähl von uns, Magnus!«
Es war, als fiele ich zurück in eine Zeit, als die Liebe mehr bedeutete als alles andere, wo ich mit Freuden jeden Doktorhut der Welt für einen Menschen hergegeben hätte, der mich umfaßt hielt und meine Hände dazu brachte, mit dem Zittern aufzuhören. Jahrelang habe ich geglaubt, unerhörtes Glück gehabt zu haben. Erst war da ein Mann, der mich unter der Voraussetzung aufrechthielt, daß ich dasselbe für ihn tat. Ein Mann, der mein Liebhaber und auch mein bester Freund wurde, ich brauchte niemanden sonst. Dann diese Arbeit hier, die mir eine Richtung, einen Wert, ein Gefühl gibt, daß die Dinge, die ich sage und tue, von Bedeutung sind. Und schließlich Malin. Sie hält mich beschäftigt, sie sieht mich genau an. Und ich kann nicht entkommen. Ich habe geglaubt, all das zu besitzen. Ich habe wie in einem Kokon aus Glück gelebt, und es fiel mir jedesmal schwer, das Lächeln zurückzuhalten, wenn ich durch Amsterdams schwimmenden Blumenmarkt ging, um Tulpen zu kaufen, mit denen ich meine Wohnung vollstellen wollte. Ich habe wirklich geglaubt, ich sei entkommen, hätte es geschafft, sei wahrhaftig zu Hause angelangt. Und jetzt das: »Erzähl von uns.«
Ich will wirklich, daß er erzählt, damit auch ich es tun muß. Daß wir gemeinsam die Fäden entwirren, um das Sonderbare ans Licht zu holen, das man Wahrheit nennt. Doch das Unglaubliche ist, daß vermutlich keiner von uns mit der Wahrheit leben kann, daß wir wohl nicht genug Kraft haben, um sie zu ertragen. Vielleicht liegt es einfach daran, daß wir so viele Jahre vor ihr geflohen sind, daß die Flucht das einzige ist, was wir wirklich beherrschen. Ich ahne, was ich zu tun versuche, indem ich Klaras Tagebücher bis zu jenem Ende verfolge, der mein Anfang wurde. Mutter hatte recht, es wird nicht einfach werden. Wir beide, Magnus und ich, haben die Lügen willig verdrängt, mit denen wir unser gemeinsames Leben begonnen haben, überzeugt wie wir waren, tatsächlich entkommen zu sein. Wir wurden übermütig wie alle Frischverliebten. Dennoch gibt es da viel, was nicht einmal Magnus weiß. Mir ist klar, daß er die Absicht hat, in diesem Sommer die Lücken zu füllen, daß er meint, zehn Jahre als Frist sind genug, selbst für jemanden wie mich. Doch meine Erinnerung ist mit den Jahren verblaßt, und allein in den letzten Monaten hat sich eine furchtbare Leere ausgebreitet. Ich habe genausoviel Angst wie Malin, ich weiß es. Ich habe mich angestrengt, mit dem Beschäftigtsein so beschäftigt zu sein, daß ich nicht gemerkt habe, wie sich das, was einmal eine faszinierende Liebe gewesen ist, in flüchtige Küßchen auf die Wange verwandelt hat und in Sätze wie:
»Liebling?«
»Hmm.«
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Liebling.«
Die Brille auf den Nachttisch, ein Glas Wasser daneben, ein verstohlenes Streicheln über eine stachlige Wange und dann: der Schlaf. Ich wußte nicht, daß wir uns gegenseitig an die Liebe erinnern müssen, daran, daß wir Verbündete, die besten Freunde sind, daß man den anderen bitten muß zu erzählen, wie man sich kennengelernt hat, sich einen Grund geben muß, um sich jeden Tag zu küssen. Ich wußte nicht, daß die Liebe, daß das Leben ein gutes Gedächtnis erfordert.
»Gute Nacht, Liebling.«
»Gute Nacht.«
Deshalb krame ich in diesen Papieren: Ich bin nicht entkommen. Mutter wußte es, Klara ebenso, vielleicht auch Vater. Magnus und ich, wie konnten wir so naiv sein? Wir wollten glauben, daß es vorbei ist und wir nach Hause gefunden haben. Hinter uns ließen wir eine verschwundene Schwester, zwei ermordete Menschen und ein Wirrwarr aus Lügen und Ermittlungen zurück, und wir konnten einfach nicht mehr. Magnus fand mich in Amsterdam, und wir bauten uns nicht nur ein Nest, sondern eine Burg, wo ich im Turm saß und arbeitete, derweil Magnus die Zugbrücke bewachte, damit kein Unbefugter Zutritt bekam. War das falsch?
Jetzt bin ich hier. Ich steige die wacklige Bodentreppe hinunter, schiebe sie nach oben zurück und schließe dann die Luke. Damit war es vorbei. Ich wünschte, das wäre alles. Magnus kommt aus unserem Schlafzimmer, er hat auf mich gewartet. Er blickt nach oben zu der geschlossenen Bodenluke. In seinem Blick liegt Verzweiflung. Er sagt mit leiser Stimme, er weiß es bereits: »Niemand sollte alte Tagebücher lesen müssen. Das ist unmenschlich.«
»Aber notwendig.«
Er nickt und sieht bekümmert aus. Ich tu mein Bestes, um die Gereiztheit abzuschütteln, die er mir einflößt. Ich ahne, daß nicht er es ist, der sie verursacht.
»Saskia?«
»Ja.«
»Du verschwindest nicht?«
»Nein, Magnus, ich verschwinde nicht.«
Er legt seine Arme um mich, er bereitet mir ein Nest, in dem ich die Augen schließen und ein Weilchen aus der Welt verschwinden kann. Genausoviel Platz, wie die Liebe damals einnahm, scheint diese Müdigkeit jetzt auszufüllen. Ich wünschte so sehr, daß ich überzeugt wäre, die Wahrheit zu sprechen, und daß ich seine Berührung wirklich genießen könnte, daß es diese Rastlosigkeit nicht gäbe, die mich von hier forttreibt. Ich war es doch, die das hier verursacht hat! Das einzige, was Magnus tut, ist, mich zu erinnern. Weshalb dann diese Gereiztheit? Obwohl ich so gern lieben würde, ihn einfach wieder lieben würde, höre ich mich selbst sagen: »Wollen wir mit dem Aufräumen anfangen?«
Ein paar Tage später nehme ich das Schiff in die Stadt. Ich will meine schwedische Kollegin Andrea Sjögren treffen, um mit ihr über unser gemeinsames Buchprojekt zu sprechen. Wir wollen von Autorinnen erzählen, die zu ihrer Zeit berühmt waren, doch die später in der Literaturgeschichte – und damit für die Nachwelt – einfach vergessen oder vernachlässigt worden sind. Wir wollen zeigen, daß es solche Frauen wirklich gegeben hat und daß sie geschrieben haben. Man hat uns nur nicht darüber informiert, daß ihre Art, die Welt zu betrachten, von Bedeutung ist. Das Buch soll den Titel tragen »Im Schatten von«. Unsere Ambitionen sind gewaltig, wir haben einen großen Verlag hinter uns, und ich weiß, genau das ist es, wofür ich all die Jahre gekämpft habe: Jetzt werde auch ich in der Erinnerung der Nachwelt weiterleben als diejenige, die die schwarzen Löcher ausgefüllt hat. Auf dem Buchumschlag wird »Van Ammer/Sjögren« zu lesen sein, und ich selbst habe gefordert, daß mein Name an erster Stelle steht. Deshalb muß ich mich nicht schämen, warum auch? Ich kenne die Spielregeln, und wie ich aus meinen wenigen, aber intensiven Treffen mit Andrea weiß, kennt sie die auch. Im Laufe der Jahre haben wir uns gegenseitig mit Material, Kontakten und Briefen versehen. Einige Male war sie in Groningen und manchmal sogar bei mir in Amsterdam. Ihretwegen habe ich mehrere Züge nach Hause verpaßt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, daß wir uns ein bißchen ähneln, diese Integrität und eine Aura von »Bitte laß mich in Frieden, hier ist nichts zu holen«. Dennoch ist sie auf eine merkwürdige Art präsent: Betritt sie ein Zimmer, dann ist der Raum nicht mehr derselbe. Nicht weil sie Menschen manipuliert, sondern weil sie die Leute dazu bringt, sich zufriedener zu fühlen. Sie ist eine Frau, die nichts dem Zufall überläßt. Andrea ist eine resolute und nüchterne Frau, eine perfekte Partnerin bei einer solchen Arbeit.
Sie erwartet mich an der Anlegestelle des Schiffes mitten in der Stadt, und wieder berühren mich ihre Schönheit und ihre Lebendigkeit, diese alles umfassende Integrität. Sie streckt ihre Hand aus, und ich nehme sie, derweil sie lächelt, nach meiner Tasche greift und knapp feststellt, ohne eine Antwort zu erwarten: »Die Reise lief gut?«
Wenn sie etwas von meinem Kollaps weiß, kann sie es bestens verbergen. Sie ist niemand, der fragt, wohl eher eine aktive Zuhörerin. Hingegen gibt es nichts in ihrer Art, das zu Intimität auffordert, zu Selbstbespiegelung, dazu, daß man seine Hand auf die ihre legen und ausrufen will: »Erzähl mir alles!« Ich begreife, aufs neue verwundert, daß sie in vieler Hinsicht genauso ist wie ich. Kompetent, liebenswert, interessiert, aber im Grunde genommen einsam. Ich versuche, dem Unbehagen, das von dieser Erkenntnis ausgelöst wird, zu entkommen, wünsche plötzlich, zu ihr vorzudringen, und sage: »Erzähle, wie ist es dir ergangen?«
»Gut. Ich finde, die Gespräche, die ich mit dem Verlag hatte, waren konstruktiv, und außerdem habe ich eine ordentliche Grobplanung vorgenommen. Du mußt sehen, ob du sie akzeptierst.«
»Und sonst?«
»Was meinst du damit?«
»Dich selbst.«
Sie lacht, ein schönes Lachen voller Wärme.
»Ach, wie üblich. Nichts Aufregendes. Mein Kater und ich sind mit der Gesellschaft des anderen zufrieden, wenn auch alles ein bißchen eintönig ist. Er hat seine Reviere, und ich habe meine.«
Ich lächle sie an. Ich weiß nicht einmal, warum. Was ist es, das ich eigentlich wissen, hören und fühlen will? Wir werden zusammen arbeiten, wollen nicht enge Freundinnen werden. Übrigens will ich keine Freundin haben, ich verstehe nicht, wozu das gut sein sollte. Wenn mir nach Reden ist, habe ich, hatte ich ja Magnus.
»Reicht das?« fragt Andrea. »Oder willst du noch mehr wissen?«
»Den Rest können wir auf später verschieben«, sage ich, über mich selbst erstaunt.
Wir sind beim Verlag angelangt, wo wir einen Lektor treffen wollen, um über die finanziellen Punkte zu verhandeln.
»Ich glaube, du kannst mir das überlassen«, sage ich, als ein junger Mann, der ein gewinnendes Lächeln versucht, auf uns zukommt.
An der Art, wie er uns bittet, die Jacken abzulegen und es uns in den Ledersesseln bequem zu machen, spüre ich, daß er denkt, er hätte uns – so sein vermutlicher Sprachgebrauch – in der Tasche. Er erwartet Dankbarkeit, weil er unserem Projekt so viel Verständnis entgegenbringt. Er erwartet, Amateure vor sich zu haben, die glauben, Geld sei eine Form von Bonus, weil wir ja doch der Ansicht sind, daß die Sache unglaublich viel Spaß machen wird. Das ärgert mich maßlos. Ich sage gleich zu Anfang, daß die Voraussetzungen nicht zufriedenstellend sind und wir schon beschlossen haben, die Verhandlungen mit einem anderen Verlag weiterzuführen. Der Mann vergißt, den obligatorischen Kaffee einzugießen, und nach langem, kompliziertem Hin und Her weiß ich, daß ich den Sieg davongetragen habe. Der leicht mitgenommene Lektor schüttelt uns die Hand, murmelt etwas von der Wichtigkeit eines offenen Dialogs. Andrea lächelt, ich tu es nicht, und dann sind wir wieder draußen auf der Straße. Ehe er sich umdreht, sehe ich es. Eine Sekunde lang kann ich es in seinen Augen lesen – obwohl er versucht, großmütig zu sein, ich sehe, wie er mit sich kämpft –, doch habe ich es schon viele Male zuvor gesehen: Hexe steht in seinen Augen geschrieben, er kann es nicht verbergen. Was für eine Hexe.
»Du hattest recht«, sagt Andrea.
»Womit?«
»Daß ich es dir überlassen kann.«
Ich beiße mir auf die Lippe.
»Ich habe meine Gründe dafür, so dickfellig zu sein«, entgegne ich.
»Ich habe nichts gesagt.«
»Ich weiß. Ich wollte es trotzdem sagen.«
»Wir haben alle unsere Gründe«, erwidert sie nur.
Erneut streckt sie mir ihre Hand entgegen, jetzt zum Abschied, weil sie auf dem Weg nach Hause ist und ich zurück zur Anlegestelle muß. Ich blicke auf die Hand, die ich in der meinen halte, wie um sie zu studieren, und ich weiß nicht, was mich dazu bringt, ob es die Einsamkeit ist, die wir beide kennen, oder die Einsicht, daß ich sonst den ganzen Sommer Magnus’ mahnenden Blicken ausgesetzt bin, vielleicht auch die Angst vor dem verlassenen Haus und meiner verblassenden Erinnerung. Ich weiß es nicht, doch sage ich: »Hast du nicht Lust, im Sommer zu Magnus, Malin und mir rauszukommen? Hin und wieder vielleicht?«
Andrea sieht verwundert aus.
»Um schon jetzt an dem Buch zu arbeiten«, füge ich hinzu.
»Ich dachte, du wolltest dich erholen«, sagt sie vorsichtig.
Ich zucke irritiert mit den Schultern.
»Das kann warten. Ich meine, das tue ich ja doch. Diese Arbeit hier wird erholsam, bestimmt«, sage ich und begreife, mehr als alles andere will ich, daß sie im Sommer auf der Insel ist. Ich zwinge mich ihr fast auf.
»Sicher«, sagt sie nur. »Hin und wieder kann ich rauskommen. Das wäre schön.«
Wir stehen da wie zwei ratlose Schulmädchen, und ich bemerke, daß ich mit der Sandale an einem alten Eispapier auf dem Bürgersteig herumschabe, daß ich verwirrt und erschöpft bin von, ich weiß nicht was. Auch daß die Situation mich an etwas erinnert, bei dem ich dabeigewesen bin, daß ich, obwohl ich hier stehe, auch ein Leben ganz woanders lebe. Klaras Leben. Ich sage, um das Ganze abzuschließen und diesem peinlichen Schweigen zwischen uns ein Ende zu bereiten:
»Dann machen wir es so.«
Wir verabschieden uns; ich gehe durch die Stadt, in der Klara und meine Mutter zu Hause waren, und ich beschließe, nichts zu fühlen, nichts zu denken, nur das zu planen, was ich besorgen will, im Kopf eine Liste aufzustellen und Punkt für Punkt darauf abzuhaken, bis ich an ihrem Ende angelangt bin und zur Insel zurückkehren kann.
Ich höre jemanden rufen. Es kann doch keiner rufen, über all die Jahre hinweg, nach all dem, was geschehen ist, wie kann jemand auf einer normalen Straße in einer Stadt, in der ich fremd bin, rufen.
»Klara?«
Ich drehe mich um, und dort steht ein Mann, den ich nicht kenne. Doch, ich erkenne ihn wieder, dunkel, ich muß ihn in einem weit zurückliegenden Leben getroffen haben. Er sagt: »Sind Sie nicht Klara Mårstedt?«
Ich kehre zurück in das Haus auf der Insel. Magnus hat das Abendessen bereits fertig, und Malin spielt mit jemandem draußen im Garten. Ich weiß, daß ich ganz bleich bin, ich sehe es an seinem Blick, und mir ist klar, daß er fragen wird, daß ich auch darauf antworten muß.
»Magnus, ich habe heute etwas Merkwürdiges erlebt.«
»Ja?«
»Jemand hat mich Klara genannt. Ein Mann.«
»Was hast du geantwortet?«
»Wie es ist. Daß sie tot ist.«
Er zuckt zusammen.
»Tot?«
»Magnus, was hätte ich sagen sollen? Es sind zehn Jahre vergangen.«
»Ja. Und was noch?«
»Ich habe gesagt, daß wir einander ähneln. Daß wir Zwillingsschwestern waren und uns immer zum Verwechseln ähnlich sahen.«
»Das hast du gesagt?«
»Ich habe es gesagt.«
Wir stehen ratlos da und starren uns an. Ich würde gern sagen, daß ich jetzt nach Hause fahren sollte, daß ich in Amsterdam mit den Dingen besser zurechtkäme, ich wolle nicht erinnert werden, es sei genug mit Mutters und Klaras Tod, ich sollte nicht länger in diesem Haus bleiben müssen, und daß ich lieber bösartig und leer wäre als ...
Er legt mir die Hand auf die Wange. Nur das. Sein Blick ist nicht einmal bekümmert. Die Hand liegt einfach dort. Das ist mehr, als ich aushalten kann. Und daß er flüstert, so wie er es immer getan hat, damit ich nicht zerbreche: »Liebste Saskia. Meine liebste Freundin. Meine Schwester.«