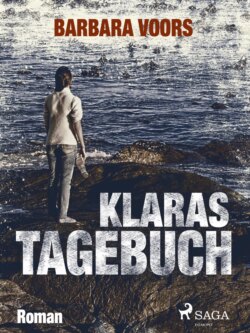Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEs gibt keine Rettung, keinen Weg aus der Sache heraus. Ich weiß es jetzt. Auch Klara ahnte es schon bald, und dennoch entschloß sie sich weiterzumachen. Ist es das, was wir Liebe nennen? Weiterzumachen, obwohl der Weg blockiert ist, der Ausgang der Sache bereits feststeht? Ich will nicht, daß es so ist. Besser wäre gewesen, sie hätte nichts geahnt, wenn sie naiver gewesen wäre, wie ein Katzenjunges, das unter wilde Tiere geraten ist und sich nur angepaßt hat, um zu überleben. Doch sie wußte, was sie tat, sie wollte Leben retten, wollte weitere Irrtümer und Katastrophen vermeiden, statt dessen aber wurde sie zur Ursache derselben. Sie glaubte, wenn sie sich im Zentrum der Ereignisse befinde, könnte sie dazwischengehen, das Spiel rechtzeitig beenden. Sie glaubte, daß sie diese Fähigkeit hätte.
Ich sitze auf der Sommerinsel meiner Kindheit, in den Schären eines Landes, von dem ich nicht gerade viel weiß. Dieses Land ist ein Teil von mir, meine Mutter ist hier begraben, hier war es, wo meine Schwester verschwand. Ich wünschte, ich könnte mehr für dieses Land empfinden. Ich tue mich schwer mit den Menschen hier draußen, mit ihrer Art, verstohlen hinter der Gardine zu stehen, mit ihrem Gerede von Ausländern, die all die Häuser aufkaufen, vom Land, das nicht mehr wie früher ist, mit ihrer verständlichen Angst vor Veränderung, die wohl mit diesem phantastischen Wohlstand zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, nicht hierherzupassen, als befände ich mich, was immer ich auch versuche, zu meiner Umgebung im Widerstreit. Wenn ich etwas sage, dann tue ich es zu laut oder auf die falsche Weise – sogar Malin spürt es, sie wird rot und macht Umwege, wenn ich mit ihr zusammen bin –, und lädt man mich irgendwo ein, so bitte ich in meiner Verwirrung um einen Genever. Wenn ich in Schweden bin, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Es liegt natürlich nicht an Schweden, darüber bin ich mir im klaren, es liegt an meinem Unvermögen. Doch ist es nur zu schön, die Schuld woanders zu suchen. Seit ich hergekommen bin, weiß ich nicht mehr, wer ich bin.
Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald. Ich habe so getan, als sei ich wie die Schweden, und behauptet, ich möchte allein sein, möchte in Frieden gelassen werden – was in Holland, wo man hintereinander durch aufgeforstete Wälder läuft, geradezu unmöglich ist –, ich habe gesagt, ich will Beeren pflücken und im Wald spazierengehen, um zur Ruhe zu kommen. Und hier sitze ich nun auf meinem Baumstumpf. Um mich herum fliegen Vögel, deren Namen ich nicht kenne, hier wachsen Pflanzen, die zwar grün sind, doch näher definieren könnte ich sie nicht, über meinem Kopf sehe ich Bäume der verschiedensten Art, doch ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich bin ein armer Mensch, die Natur ist nur etwas, dem ich einen Besuch abstatte. Ich beneide die Menschen hier draußen, weil sie sich in ihr finden. Ich bin umschlossen von stillem Grün, das mir nichts sagt, und ich weiß, daß es in meinem Inneren viel zu viele Stimmen gibt, als daß ich jemals wirklich Frieden haben könnte.
Um von den Stimmen wegzukommen, denke ich an Malin. Sie hat hier auf der Insel eine neue Freundin gefunden, was wohl der Traum aller Eltern ist. Sie nehmen sich gegenseitig völlig in Beschlag. Diese Freundin heißt Desirée.
»Ein seltener Name, stimmts, Mama?«
»Ja, wirklich.«
Sie lassen einander nicht in Frieden, geben einander keine Möglichkeit zum Nachdenken. An den Abenden, wenn die Freundin bei uns übernachtet, höre ich, wie sie sich jede Kleinigkeit erzählen, sie wissen alles voneinander, und bald werden sie sich tief in die Augen schauen und sagen: »Werden wir uns immer lieben?« Sie werden Erkennungszeichen tragen als Beweis für ihre Freundschaft, sie werden der ganzen Welt zeigen, daß sie auserwählt sind, und wenn ein anderes Mädchen ihren Weg kreuzt, werden sie so unbarmherzig sein, wie es ihre eben entdeckte Intimität erfordert. Sie werden der Neuen die Augen auskratzen, und diese wird weinend nach Hause laufen zu ihrer Mutter, die wieder eine von denen ist, die vergessen haben, wie bösartig wir kleinen Mädchen sein können, und sie wird ihre Tochter mit aufmunternden Worten zurückschicken, statt ihr beizubringen, Zorn und Mut zu zeigen. Wir vergessen. Aber ich vergesse nicht, ich erinnere mich an Klara. Ich sehe den Schmerz, noch bevor er da ist, ja vielleicht sogar dann, wenn es ihn nicht gibt. Sicher plädiere ich für Schwesterlichkeit, doch weiß ich auch einiges über ihre Kehrseiten. Ich weiß, daß ich gezwungen sein werde, Malin wiederaufzurichten, daß ich es schon früher getan habe. Heute wie damals werde ich sie ermuntern, sich auch mit Jungen abzugeben, werde ihr sagen, daß sie nicht weniger grausam sind, ihre Grobheit aber vielleicht offener zeigen, daß deren Regeln ihr durchs Leben helfen können. Denn eines Tages hat die Freundin eine andere Vertraute gefunden, und all die Geheimnisse Malins werden zum Gegenstand gründlichster Erörterung zwischen den neuen Busenfreundinnen. Halsketten werden zurückgefordert, ebenso wie Geschenke und Versprechen. Wir werden Zeugen eines Blutbades sein, und ich weiß nicht einmal, ob Magnus überhaupt bemerken wird, was geschieht.
Ich will nicht behaupten, daß Magnus nichts von Frauen versteht, denn so ist es nicht. Ich kenne nur wenige Männer, die so instinktiv fühlen, wie man eine Frau glücklich macht, wie man es fertigbringt, daß ein anderer Mensch sich entfaltet. Magnus hat meine unendlichen, oft sinnlosen Klagen stets angehört, hat mir dann zugelächelt, was ansteckend war, so daß auch ich zugeben mußte: »Ist doch wahnsinnig, nicht?«
»Ein bißchen.«
»Wahnsinnig.«
»Ja.«
Er verleugnet mich nicht, es gibt nichts Herablassendes in seinem Verhalten. Es ist nicht so, daß er über mich lacht. Er bringt mich vielmehr dazu, über mich selbst zu lachen. Je ernster eine Angelegenheit ist, desto mehr muß man lachen. Er sagt, das hätte er damals in Sambia gelernt. Er hat es geschafft, daß ich mich von außen sehen, mich zügeln kann, ehe es zu spät ist, und statt mich bedroht zu fühlen, fühle ich mich befreit. Wir haben das Entsetzen aus unserem Leben weggelacht. Genau das haben wir so viele Jahre lang getan. Jeder von uns hat den anderen zum besseren Menschen gemacht – auch das bin ich, ich habe ebensoviel teil daran –, selbst wenn es banal klingen mag. Mit ihm bin ich, war ich, das Beste, was ich überhaupt sein kann. Zehn Jahre lang bin ich glücklich gewesen, und jeden Morgen habe ich unser Zuhause in Amsterdam verlassen, bin zur Universität gegangen und habe studiert oder dann Vorlesungen in Groningen gehalten, und schließlich, nach vielen Jahren angestrengter Arbeit, habe ich meinen Doktor gemacht. Mit Magnus hatte ich eine Richtung, ein Ziel. Mein privates Leben hat mir so viel Ruhe gegeben, daß ich meine freie Zeit fast nie zu Spekulationen darüber nutzen mußte, ob er mich verlassen wird, ob wir uns genügend lieben. Ich habe es gewußt, er hat es gewußt. Das war das Beste, was ich besessen habe, mein größter Stolz. Wir haben etwas so Großartiges wie die Gewißheit besessen, daß einer den anderen nie verraten wird.
Und jetzt? Ich sitze im Wald und blicke zurück auf zehn Jahre, und ich weiß, daß diese Gewißheit nicht mehr genauso selbstverständlich ist. Mein Stolz ist angeknackst, er wird zerfressen von meiner Bosheit, meinen häßlichen Worten, meinem erbärmlich schlechten Gedächtnis. Innerhalb kurzer Zeit bin ich zu einer von diesen schrecklichen Personen geworden, über die wir früher gelacht haben: eine Märtyrerin, so eine, die Spitzen austeilt und Worte bis zur Unkenntlichkeit verdreht. Aber ich weiß, daß immer zwei dazu gehören, selbst wenn es bei mir die schlimmere Form angenommen hat. Ich weiß, wenn Magnus und ich stärker gewesen wären, hätten wir auch das durchschaut. Er hätte gesagt, meine Bosheiten interessierten ihn nicht, ich solle allein losfahren, bis ich mich wieder gefangen hätte, oder daß wir uns zusammensetzen könnten, bis wir wüßten, warum unsere Worte immer eine so unangenehme Wendung nähmen. Wie er es zuvor stets getan hatte. Und ich auch. Statt dessen schleicht er mit vielsagenden Blicken und unruhiger Miene um mich herum. Es gehören immer zwei dazu.
Ich ahne, wie das alles begonnen hat. Ich habe mich selbst getäuscht, das war vor dem Fahrradfahrer und meinem Sturz. In den vergangenen Jahren habe ich manchmal ein plötzliches Entsetzen in seinen Augen gesehen. Vielleicht ist Entsetzen ein zu starkes Wort, denn ich weiß, er liebt mich noch immer, er wird, ebenso wie ich, niemals entkommen. Ich glaube, es ist Angst. Es ist Angst, was ich zuweilen, irgendwie aus den Augenwinkeln, in seinem Gesicht sehe, wenn er mich betrachtet. Angst und Mißtrauen. Ich weiß nicht, ob er begreift, daß ich es bemerkt habe. Doch er muß es ahnen. Weshalb würde er sonst so herumschleichen? Ich wünschte nur, er könnte sagen, wovor er die größte Angst hat. Das würde mir helfen. Hat er mehr Angst vor mir oder vor dem, was mir geschehen könnte? Zwischen diesen beiden Dingen liegt der Wertmesser unserer Liebe. »Hast du Angst vor mir, Magnus?« möchte ich ihn abends fragen. Statt dessen sage ich, derweil ich mich über ihn strecke, um die Nachttischlampe auszuschalten: »Gute Nacht, Liebling.«
»Gute Nacht.«
Seine Lippen berühren die meinen. Sie schmecken nach nichts. Ich öffne mich nicht für ihn. Nachts flüstert er bisweilen, ich glaube, im Schlaf: »Klara?«
»Ich bin es, Saskia.«
»Saskia?«
»Ich bin hier.«
Es hinterläßt Spuren bei ihm, daß ich nachts auf dem Dachboden sitze und von Klara lese. Doch es gibt keinen Weg aus der Sache heraus. Nicht nachdem ich die Bodentreppe heruntergeklappt habe und zu den Erinnerungen an eine Vergangenheit hochgestiegen bin, von der ich nichts habe wissen wollen. Nicht seit dem Morgen, als ein Mann die überall geltende Grenze des Privatlebens überschritten hatte und plötzlich in unserem Wohnzimmer stand. Das war gestern. Indem er sich kurz vorstellte, nahm er den ganzen Raum ein und veränderte das Haus für immer: »Gruten Tag, ich heiße John Adolfsson, ich bin Kriminalinspektor a.D. Den Sommer über wohne ich hier auf der Insel. Ich war jahrelang zuständig für die Ermittlungen bei dem Doppelmord und dem Verschwinden Ihrer Schwester Klara Mårstedt.«
»Wie bitte?«
Ich flüstere, ich bin allein zu Hause, ich habe keinen Schutz. Malin teilt gerade Geheimnisse mit, und Magnus mißtraut mir.
Ich sage es noch einmal: »Wie bitte?«
»Adolfsson. Wir haben vor vielen Jahren mal miteinander telefoniert. Ich hatte Sie nach Ihrer Schwester Klara gefragt, ob Sie von ihr gehört hätten, ob Sie wüßten, wozu sie imstande war.«
»Ich erinnere mich«, sage ich.
Ich will diesen Mann nicht in meinem Haus haben.
Er ist ein wenig untersetzt und hat graue Strähnen im Haar. Er spricht Schonisch auf eine Weise, die gemütlich klingen könnte. Es ist entsetzlich. Seine Augen sind ungewöhnlich neugierig und hellwach. Ich sehe, daß er kein Wort zufällig sagt, er weiß, was er tut, auch dann, wenn er sich unsicher gibt. Dieser Mann hat sich mindestens ebenso unter Kontrolle wie ich mich. Ich fühle mich bedroht. Er will etwas von mir, und ich werde kämpfen, um ihn aus meinem Leben herauszuhalten. Doch ich bin höflich, ich bin Schwedin und Holländerin in perfekter Kombination und frage folglich: »Kaffee?«
»Danke, gern.«
Er nimmt auf der Terrasse Platz, einer der Korbstühle knackt unter seinem Gewicht, und er seufzt, offenbar vor Wohlbehagen, ohne irgendwelche Sorgen im Leben. Ich weiß, daß er mich täuschen wird, ich muß aufpassen. Er ruft, indem er mit der Hand auf die Bucht weist: »Was für ein phantastisches Haus! Was für eine Aussicht!«
Ich antworte nicht. Ich stelle zwei Tassen auf ein Tablett, das Wasser kocht, in die Thermoskanne damit, Gebäck dazu. Er empfängt mich mit einem Lächeln. »Genau, wonach ich mich gesehnt habe, nach einem schönen Vormittagskaffee.«
Als ob das hier eine Gaststätte wäre, an der er zufällig vorbeigekommen ist und wo der Kaffee den Ruf hat, besonders gut zu sein, die Serviererinnen besonders charmant sein sollen und die Aussicht überwältigend ist. Ich klappere störend mit dem Geschirr.
»Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Das Haus war jahrelang verschlossen.«
»Drei Jahre. Seit meine Mutter gestorben ist.«
»Tut mir leid.«
Ich möchte sagen: »Ach ja?« Ich gieße Kaffee ein und reiche ihm eine Tasse.
»Und davor?« fragt er, als wollte er das Gespräch ungezwungen fortführen.
Er täuscht mich nicht.
»Da war meine Mutter hier.«
Er lächelt: »Das ist mir klar. Ich meine Sie.«
»Ich hatte in den letzten Jahren überhaupt keine Zeit, um herzukommen.«
»Zeit?«
»Keine Lust.«
»Aha.«
»Ich hatte nie eine starke Bindung zu Schweden. Das war Klaras Sache.«
»Ich habe jahrelang in England gewohnt. Ich fühle mich hier manchmal auch fremd.«
Er tut vertraut, er tastet sich vor, er will erreichen, daß ich ihn mag. Ich gebe keine Antwort.
»Aber Ihre Schwester war oft hier?« fragt er.
»Ich nehme es an.«
»Sie war hier draußen, kurz bevor sie verschwunden ist, nicht wahr?«
»Bevor sie gestorben ist, meinen Sie.«
»Wir wissen nicht, ob sie tot ist.«
»Wir wissen, daß sie Selbstmord begangen hat.«
»Wir nehmen an, daß sie Selbstmord begangen hat. Alles deutet darauf hin, der Brief an Sie, das Auto neben dem Brückengeländer, die Tasche, der Paß. Doch da die Leiche nicht gefunden wurde, kann man schließlich nie sicher sein.«
Ich stehe auf und stelle mich ans Geländer der Terrasse, schaue aufs Meer hinunter, das gegen die Felsen schlägt.
»Herr Kriminalinspektor Adolfsson?«
»Sagen Sie John.«
»Herr Adolfsson. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, was Sie von mir wollen. Sie haben natürlich alles Recht der Welt, auf derselben Insel zu wohnen wie ich, auch wenn ich finde, daß es dazu nur eine minimale Chance oder Gefahr hätte geben dürfen. Für mich ist dieses Gespräch nichts Angenehmes. Für Sie ist es vielleicht eine interessante Angelegenheit, etwas, das einem Pensionär Stoff zum Grübeln bietet, wenn die Nachmittage lang werden. Egal, wie es auch ist, jedenfalls würde ich gern wissen, was Sie wirklich wollen.«
Er schaut mich an. Ich bemerke ein leichtes Lächeln in seinem eingefallenen Gesicht. Er hat meine Unsicherheit gespürt, meine Angst gerochen. Genau das war es, was er brauchte, um in diesem Sommer meinem Ferienhaus weitere informelle Besuche abzustatten.
»Ich will Sie natürlich nicht aufregen. Das war nicht meine Absicht. Ich bin eigentlich nur neugierig auf Sie. Ich habe so viele Jahre mit diesem Fall, dem Mord an Desirée Cronenfelt und Henrik von Rensen, verbracht, und die Sache hat ein so unrühmliches, nichtssagendes Ende gefunden, daß ich sie einfach nicht richtig loslassen konnte.«
»Und?«
»Sie erinnern mich an Klara.«
»Sie sind ihr doch nie begegnet.«
»Nein, das ist wahr. Aber sie hat mich beschäftigt, hat mich interessiert. In all ihrer Abwesenheit. Wenn ich sie finden würde, könnte ich erfahren, was wirklich geschehen ist.«
»Sie ist tot.«
»Natürlich«, sagt er und trinkt seinen Kaffee aus. »Das war es übrigens, weshalb ich gekommen bin.«
»Ach so?«
»Ich weiß nicht, ob Sie daran gedacht haben, daß es bald genau zehn Jahre her ist, seit sie verschwunden ist.«
»Ich weiß.«
»Daß Sie jetzt das Recht haben, oder besser gesagt Ihr Vater, einen Antrag zu stellen, um sie vom Amtsgericht für tot erklären zu lassen. Vielleicht wollen Sie auch eine Gedenkfeier abhalten?« fragt er und lächelt mitfühlend.
Ich zucke unwillkürlich zusammen.
»Für mich spielt das keine Rolle.«
»Daß sie endlich formell für tot erklärt wird?«
»Das hätte sie schon längst sein können.«
»Ja, wenn die Umstände ihres Verschwindens, ihres Selbstmordes, klar und einfach gewesen wären, dann sicher. Nun war es nicht so. Doch da sie nicht wieder aufgetaucht ist ...«
»Wieder aufgetaucht?«
»... und schon zehn Jahre vergangen sind, so dürfte alles klar sein.«
Ich sage nichts dazu. Es macht mich nervös, daß er sieht, wie getrübt mein Blick ist, und daß ich mir kein Blinzeln erlaube, daß ich mich zur Wehr setzen muß, um mein Gesicht nicht zu verlieren.
»Vielleicht sollte ich gehen«, sagt er und erhebt sich. »Vielen Dank für Kaffee und Gebäck.«
Er dreht sich zu mir um und ist nun wieder entgegenkommend.
»Wissen Sie, daß ich hier auf der Insel ein Haus gekauft habe, gleich nachdem wir uns gezwungen sahen, die Ermittlungen in dem Mordfall einzustellen?«
Er erwartet keine Antwort.
»Ich war zuvor einmal hergefahren, um zu sehen, ob ich nicht eine andere Erklärung für das Verschwinden Ihrer Schwester finden könnte, und habe mich einfach in dieses Eiland verliebt. Ich, ein Schone, hier mitten in den Stockholmer Schären! Wissen Sie, zu Hause lacht man darüber.«
Ich kann ein Lächeln nicht unterdrücken. Er lacht lange.
»Ja, dann gehe ich wohl. Es tut mir leid, wenn ich Sie beunruhigt habe. Ich wollte nur, daß Sie Bescheid wissen.«
»Ich weiß Bescheid.«
»Aha, na dann also einen schönen Tag.«
»Ebenfalls, Herr Kriminalinspektor.«
Als er den Hang hinuntergeht, dreht er sich mit einer entwaffnenden Geste zu mir um und ruft etwas, es klingt wie: »Sagen Sie John.«
Ich weiß, er wird wiederkommen. Ich bleibe auf der Terrasse sitzen. Die Welt habe ich ausgeschlossen. Ich schlafe ein, wie ich es immer tue, wenn ich spüre, das Gehirn will etwas wiederkäuen, was unlösbar ist. Magnus weckt mich mit einem Kuß auf die Stirn. Er nickt.
»Ich weiß. Ich habe ihn unterwegs getroffen.«
»Du wußtest, wer er ist?«
»Ich habe doch mit ihm gesprochen, als er in Holland angerufen hat.«
Er zögert einen Augenblick.
»Er hat mich auch ein paarmal aufgesucht, als ich in Stockholm gewesen bin.«
»Das hast du nie erzählt.«
»Nein, ich hielt es nicht für nötig.«
»Nicht nötig?«
»Saskia, Liebe. Ich fand, du hattest genug durchgemacht.«
Ich halte den Mund fest geschlossen, bin es leid, giftig zu werden. Ich schaffe es nicht, seine Worte zu verdrehen, um eine Reaktion zu provozieren, ich hätte so gern ein Herz gehabt, das einfach offen ist, ihn zu lieben, wäre so gern bereit, mich von ihm erneut zum Lachen bringen zu lassen. Ich will, daß er wieder der Mann ist, der versprochen hat, mich nie zu verraten.
»Erzähl von uns«, flüstere ich deshalb.
Er legt seinen Mund an mein Ohr.
»Ich weiß nicht, ob ich es noch kann, Saskia. Erzähl du.«
»Ich weiß nur, daß es einmal einen Mann gab, der grenzenlos liebte. Dieser Mann warst du. Du hast nicht verurteilt, bist nicht herumgeschlichen, hast nicht verraten, nicht du hast sie gerettet, du hast sie gebeten, sich selbst zu retten.«
»Diese Frau warst du.«
»Sie liebte dich. Nur dich. Dir ist es zu danken, daß sie überlebt hat, nur dir.«
»Und jetzt?« flüstert er, und ich höre, wie gepreßt seine Stimme klingt, und es tut mir weh zu wissen, daß jemand, der so nahe ist, mir nicht wirklich nahe kommt.
Ich höre mich selbst sagen, und es ist das Ehrlichste, was ich seit langem geäußert habe: »Saskia weiß nicht mehr, wer sie ist.«
Er hält mich umfaßt, und ich glaube, daß wir irgendwo doch noch nach Hause finden können, glaube nicht, daß wir entkommen sind, es ist zu spät dafür, doch besitzen wir noch immer etwas von dem Vertrauen, das unsere Körper als Schutz umhüllte. Er hält mich umfaßt, er hält mich fern von der Welt, er umschließt mich. Und dennoch. Es reicht nicht aus.
Der Wald gibt keine Antwort, so wie ich keine Antwort darauf weiß, was sich in ihm befindet. Das einzige, was ich denken kann, als ich in dem unbeschreiblichen Grün dort auf dem Baumstumpf sitze, ist: Wenn ich nur fliehen könnte. Danach: Wenn doch Andrea hier wäre.