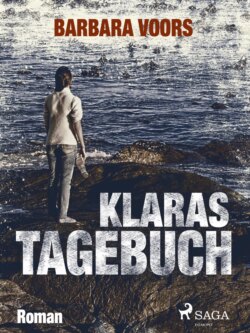Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMai 1981
Saskia,
ich besitze dieses Leben, doch weiß ich nicht, womit ich es ausgefüllt habe. Ich besitze diese Liebe, die ich nicht benennen kann. Auch dich habe ich, obwohl du sehr weit weg und manchmal nur noch wie eine ferne Erinnerung bist, und obwohl du für mich, beinahe, wieder tot bist. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum Desirée und ich uns so nahestehen, es ist diese ewige Sehnsucht nach dir, die mit etwas anderem kompensiert werden muß. Ich bin nicht wie du: stark im Wissen, daß es genügt, man selbst zu sein. Doch bin ich wirklich überzeugt, daß Desirée und ich klarkommen werden. Wir werden zwei selbständige Menschen, die sich nicht in anderen zu spiegeln brauchen, damit sie erfahren, wer sie sind, wir werden in der Welt nicht nur unseren Weg finden, sondern sie zu einem besseren Ort machen.
Nach den Vorlesungen in der Universität haben wir es uns angewöhnt, eifrig darüber zu diskutieren, wie wir unsere zukünftige Welt ändern können. Wir nehmen uns sehr ernst, das wird von uns verlangt. Wir hocken in einem Café der Stadt, selbstsichere, kettenrauchende, schöne Frauen, die nichts kleinkriegen kann. Desirée sagt, wir müßten das System, die patriarchalische Hierarchie, von innen her aufbrechen. Solche Worte verwendet sie, blendet uns damit. Sie stellt alles so anschaulich und einfach dar: die Männer als Feinde und die Frauen als diejenigen, die ständig das Nachsehen haben. Ich wende ein, daß wir auch die Männer einbeziehen müßten, denn wenn eine Frau in ihrer Geschlechterrolle festsitze, tue es der Mann ebenso. Ich sage: »Dreht die Sache doch mal um. Es gibt Bereiche, die Frauen genauso streng bewachen wie Männer die ihren, Bereiche, die sie vielleicht gar nicht hergeben wollen. Kann es nicht sein, daß in diesem System beide Seiten die Betrogenen sind? Haben wir vielleicht auch schuld daran?«
Die anderen aus dem Kurs stimmen mir nicht zu, vor allem Desirée nicht. Sie protestieren heftig. Die Gespräche gehen hin und her, ganze Nachmittage und Abende lang, es ist verlockend und stimulierend. Aber trotzdem, Saskia, fühle ich mich manchmal wie eine Verräterin und denke: Warum reden wir so viel, können wir nicht etwas Radikales mit unserem Leben anfangen?
»Du nimmst die Männer in Schutz, Klara«, sagt Desirée in diesem unangenehmen Tonfall, den sie, wenn andere dabei sind, oft anschlägt, so als wolle sie unsere Verbundenheit tarnen.
»Ich meine einfach, wie sollen wir die Dinge allein wirklich ändern können?« frage ich müde.
»Wir müssen denselben Platz einnehmen wie die Männer, sie genauso raffiniert unterdrücken, wie sie es mit uns tun«, sagt eine Frau, die Carolina heißt, sie ist zierlich und blond, sitzt immer rechts von Desirée und beugt sich jetzt zu ihr hin, um ihre Zustimmung zu betonen.
Ich schüttele langsam den Kopf. Desirée wendet sich direkt an mich: »Klara, glaubst du wirklich, daß ein System, das von Männern aufgebaut ist, nimm nur mal die Universitätswelt, sich verändern und freiwillig auf Macht verzichten wird? Auf der untersten Ebene, ja, wo wir dazugehören und Geld bringen, aber weiter oben? Wo sind dann all die weiblichen Professoren?«
»Die werden wir.«
»Nie im Leben. Glaubst du das tatsächlich?«
»Ich muß es, egal wie es jetzt auch aussieht.«
»Das reicht nicht«, sagt Desirée kopfschüttelnd. »Mein Gott, es ist erst sechzig Jahre her, daß wir das Stimmrecht bekommen haben, außerdem zählten wir damals mehr oder weniger zum Besitz des Mannes.«
»Das ist noch heute so«, sagt Carolina, beißt sich aber sofort auf die Zunge, weil Desirée ihr nicht zustimmt.
»Es braucht aber doch nicht so zu werden, wie du es beschreibst. Es gibt andere Beispiele.«
Carolina und Desirée lächeln vielsagend.
»Welche?«
»Meine Mutter. Sie kommt aus eigener Kraft klar und hat Erfolg.«
»Weil sie geschieden ist, ja.«
»Sie war auch vorher schon stark, zusammen mit meinem Vater. Sie haben sich glücklich gemacht, haben sich vorwärts geholfen.«
Desirée schaut auf die Tischplatte, dann wandert ihr Blick in meine Richtung. In ihren Augen ist Kälte. Zweimal hast du mich jetzt verraten, sagen sie.
»Aber Klärchen, du und ich, wir wissen doch, daß dein Vater sie ständig betrogen hat.«
Sie ist es, die mich verrät. Alles, was ich ihr im Dunkeln anvertraue, kommt ans Licht. Bei Diskussionen ist sie erbarmungslos, sie muß immer gewinnen. Je mehr wir uns lieben, desto gemeiner muß sie sein. Sie muß sich Verbündete suchen als Schutz gegen diese Liebe, und sie erwartet, daß ich dasselbe tue. Doch ich weigere mich. Ich bin ein Mensch, der mehr liebt, als guttut, und ich halte mein Versprechen. Ich stehe auf, um zu gehen. Warum ist alles so ermüdend, obwohl ich mich hier doch sicher und verstanden fühle? Woher kommt das Gefühl, daß wir uns nicht vom Fleck bewegen, auch wenn wir uns noch so einig sind? Manchmal will ich einfach alles hinter mir lassen: die ewige Jagd nach Einmütigkeit, die schrillen Stimmen, wenn sich jemand verletzt fühlt, in einem Moment dazuzugehören und im nächsten plötzlich ausgestoßen zu sein, all die Intrigen. Manchmal möchte ich nur klar sagen dürfen, was ich meine, statt es mit sanfter Stimme diplomatisch zu kaschieren. Manchmal ist es, als hätte ich all das gründlich satt. Kannst du mich verstehen, Saskia?
»Ich geh nach Hause«, sage ich nur.
Ich ziehe mich an, gehe zur Tür und habe nicht den Wunsch umzukehren, ich begreife, ich könnte, wenn ich nur die Kraft dazu hätte, jetzt meine Koffer packen, meine Bücher nehmen und die Erinnerungen und dahin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Zu dir, Saskia.
Sie läuft mir hinterher. Natürlich tut sie das. Sie faßt mich ums Kinn und zwingt mich, sie anzusehen. Sie fängt mich ein mit ihrem Lächeln, mit ihren Augen, ihrer Art, mich zu berühren.
»Du verläßt mich doch nicht?« fragt sie.
»Natürlich nicht.«
»Sehen wir uns heute abend?«
»Natürlich.«
»Du bist nicht traurig?«
»Nein.«
Langsam gehe ich zu meiner Wohnung, sie ist klein und scheint nach all dem muffig zu riechen. Hier gibt es keine offenen Flächen oder den Geruch der Wohlhabenheit, der Desirées gesamtes Dasein umgibt und auch Stunden meines eigenen Lebens geprägt hat, seit ich mich in ihre Welt habe einkaufen lassen. Mein Leben hat nie zuvor etwas Derartiges besessen, ich habe nur diese Hände und diesen Kopf, und meine Mutter hatte gesagt, ich solle sie gut gebrauchen. Sie hat mir Glück gewünscht und gesagt, ich müsse selbst kämpfen, und daß ich nur im äußersten Notfall auf sie zählen könne. Das hier ist kein Notfall, es ist das Leben, wie es ist. Vielleicht habe ich mir deshalb gestattet, mich von all dem berauschen zu lassen.
Vor meiner Haustür steht eine Frau, ihr Haar flattert über den rotgeweinten Augen. Ich kenne sie von der Universität. Ich kenne sie von den endlosen Nächten in Desirées Gesellschaft. Ich kenne sie von den vielen Malen, als sie aus ein paar Meter Entfernung beobachtet hat, wie Desirée mit ihrem Freund anbändelte.
»Ich muß mit dir reden«, sagt die Frau, die Maria heißt.
»Ja, ich verstehe.«
Der Wind packt unsere Kleider, und sie sieht so einsam und zerzaust aus, daß ich die Hand ausstrecken und ihre Schulter berühren muß, als wollte ich nachsehen, ob sie noch immer dasteht.
»In diesem Jahr will es nicht warm werden«, sagt sie nur, als reiche das zur Erklärung, warum sie ihren zerweinten Körper vor meiner Tür postiert hat.
»Das wird schon«, sage ich und lasse es wie ein Versprechen klingen.
Sie sieht mich an, und in ihren Augen leuchtet ein Funke auf.
»Kannst du mit ihr sprechen?«
Ich weiß, worüber. Ich wünschte, ich wüßte es nicht.
»Was willst du, daß ich sage?«
»Sie soll meinen Freund in Ruhe lassen. Sag, daß er mich liebt, aber ihr nicht widerstehen kann. Ich weiß, das klingt feige, als hätte er kein Rückgrat, genausowenig wie ich.« Verwundert fügt sie hinzu: »Er hat Angst vor ihr und ich auch.«
Ich nicke. Ich wünschte, daß ich es fertigbringen könnte, ihr von unseren Nächten zu erzählen, davon, wie zärtlich Desirée sein kann, von ihrer Großzügigkeit, ihrem guten Willen, von ihrer durchscheinenden Haut und ihrem zierlichen Körper, der einfach davongetragen werden möchte, wenn nur einer die Kraft dazu aufbringen könnte. Dieser Jemand, der ich werden muß. Doch ich bin müde, Saskia, ich bin erschöpft, und mir fehlt deine Tatkraft.
»Ich werde mit ihr reden«, sage ich nur.
Sie nickt, sie ist beschämt, weil sie sich vor mir bloßgestellt, weil sie ganz offen ihre Schande eingestanden und gezeigt hat, daß sie diejenige ist, die liebt, diejenige, die um einen Mann kämpfen muß, der behauptet, sie ebenfalls zu lieben. Ich schaue zu Boden.
»Wie kannst du nur?« fragt sie.
»Was?«
»Wie kannst du mit ihr zusammen sein?«
»Wir sind Freundinnen«, antworte ich unbeholfen.
»Das habe ich begriffen. Ich frag mich nur ...«
Sie nickt, wie um zu zeigen, daß auch ich jetzt entlarvt und ein Teil der Schande bin, daß sie diese keineswegs nur allein trägt. Das war es, was ich die ganze Zeit gewußt habe: Daß ich mitschuldig bin.
Nachts ruft Desirée an. Wir können ausgewesen sein, ich bin nach Hause gegangen, sie ist mit einem Mann verschwunden, doch dann ruft sie irgendwo aus der Stadt an; im ersten Morgengrauen zerreißt ein Klingeln die Stille meiner Wohnung. So auch in dieser Nacht. Ich bitte sie, ein Taxi zu nehmen und herzukommen. Sie ist völlig hysterisch, sagt, sie begreife nicht, wo sie ist und bei wem, und wenn ich sie nicht bald holen käme, wisse sie nicht, was ... Ich bitte sie, auf die Straße zu gehen und dann so weit zu laufen, bis sie sehe, wo sie sei, weil ich sie sonst nicht finden könne. Sie sei wie gelähmt ohne mich, sagt sie, sei ratlos und ohne jedes Ziel. Ich bitte sie loszugehen. Sie bringt mich um meine Ruhe. Nachts wache ich am Telefon, sie raubt mir alle Kraft. Es ist unbegreiflich, daß sie an diesem Leben festhält, obwohl sie doch gesagt hat, sie will damit aufhören. Ich verstehe nicht, warum ich weiter warte. Trotzdem weiß ich es. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Nicht noch jemand darf zugrunde gehen. Wenn ich sie rette, rette ich auch mich. Ich weiß, Saskia, ich erinnere mich daran. Es ist nur so ermüdend.
Am Ende kommt sie dann. Ich bürste ihr das Haar, gebe ihr eine Tablette, wische ihr die Schminke ab, die sich schon aufgelöst hat und ihr müdes Gesicht mit einer aquarellfarbenen Schicht überzieht. Ich lege eine Matratze auf den Boden, lese ihr etwas vor, tue alles, was sie will. Doch will ich nicht, daß sie erzählt. Ich weiß, daß ich mitschuldig bin, aber ich will nicht wissen, woran. Sie hält meine Hand. Allein das, wie sie meine Hand hält. Niemand hat mich je so gebraucht. Sie flüstert: »Wir fahren zu meinen Eltern.«
»Sicher tun wir das.«
»Ich will, daß du sie triffst. Bald. Wir fahren zu ihrem Haus am Meer, es ist so schön, und sie sind wunderbar. Du mußt sie kennenlernen, erst dann wirst du verstehen, wer ich wirklich bin.«
»Ja, Desirée.«
»Ich will es. Ich glaube, du wirst sie sehr mögen. So wie ich es tue. Du wirst sie lieben, du mußt, Klara.«
»Ja. Schlaf jetzt.«
Sie schließt die Augen, preßt meine Hand, bis sie fast taub ist. Ich weiß, daß ich es ihr sagen muß.
»Maria war heute hier.«
»Wer?«
»Die Freundin von Anders.«
»Ach die.«
»Sie will, daß du ihn in Ruhe läßt.«
»Ich habe ihn nicht angerührt. Sie lügt.«
Ich schaue zur Decke hoch, das Licht der Nachttischlampe läßt unsere Profile das halbe Zimmer ausfüllen.
»Du glaubst ihr doch wohl nicht? Alle fallen über mich her. Keiner mag mich. Nur du.«
»Liebes. Nicht mit mir. Ich habe euch doch gesehen.«
Sie blickt mich bestürzt an. Dann fängt sie an zu weinen. Ich ertrage es nicht. Ihren Blick: »Auch du.«
»Desirée? Du brauchst mich nicht anzulügen. Ich laß dich nicht allein. Ich habe es versprochen.«
Sie hört nicht auf zu weinen, liegt zusammengerollt auf meiner Matratze, und wieder würde ich sie am liebsten nehmen und mit ihr diese seltsame Welt verlassen. Es ist, als hätte sie in der falschen Umgebung Wurzeln geschlagen. Wenn ich sie nur herausziehen und verpflanzen könnte, würde sie eine andere werden.
»Laß ihn in Ruhe. Mir zuliebe«, sage ich.
»Er interessiert mich nicht«, murmelt sie.
»Aber dann laß ihn doch.«
»Er entscheidet selbst, was er tun will. Er ist ein erwachsener Mann.«
»So einfach ist es nicht.«
»Aber du weißt doch, daß ich nicht interessiert bin, daß ich mit ihm nie länger zusammen sein möchte. Das muß doch selbst sie begreifen.«
»Laß es sein.«
»Willst du, daß auch ich mich verstelle? Ich soll ihn also freigeben, damit er zu dem verlassenen Aschenbrödel zurückkehren kann, das mit verheultem Blick am ehelichen Bett wartet? Du verstehst, wenn sie sich wirklich lieben würden, wenn sie sich wirklich ... Willst du das, Klara?«
»Ja.«
»Dann mache ich es. Dir zuliebe. So viel Romantik, wie du nur willst. Ich soll also verlassen werden und sie ihn zurückgewinnen?«
»Ja. Ich glaube, so muß es sein. Schlaf jetzt.«
Kurz bevor wir beide einschlafen, flüstere ich, obwohl ich eigentlich weiß, daß ich sie nicht vor Irrtümern schützen kann:
»Genießt du es, mit Männern zusammen zu sein?«
»Genießen?«
»Ja. Spürst du Wärme, Liebe.«
»Ich bin nicht so sicher, daß ich weiß, was das ist.«
Ich lerne sie besser kennen, als ich sollte. Trotzdem muß ich weiterfragen, nach Dingen, die ich am liebsten nicht wissen will.
»Schützt du dich?«
»Wovor, Klara?«
»Vor den Risiken.«
»Du verstehst wirklich nicht. Die sind es doch, auf die ich aus bin.«
»Ich begreife dich nicht«, sage ich und schließe die Augen.
»Brauchst du auch nicht. Liebe mich einfach.«
Wir halten uns bei den Händen. So endet es immer. Katastrophen – dann diese Nächte der Einsicht, der Nähe und der Versprechen.
»Das muß ein Ende haben, Desirée. Du weißt es.«
Sie flüstert, tief aus dem Schlaf heraus: »Ich ahne es. Dir zuliebe. Wir ziehen zu Saskia, nach Amsterdam, das machen wir. Wir werden wie sie, ja, Klara?«
Ich gebe keine Antwort. Was soll ich sagen? So viele Lügen.
»Sicher«, flüstere ich. »Sicher.«
Deine Schwester Klara