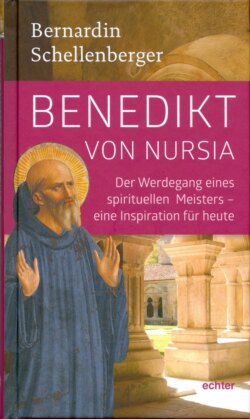Читать книгу Benedikt von Nursia - Bernardin Schellenberger - Страница 13
Die Abnabelung
ОглавлениеBenedikt wanderte zunächst einmal entlang des Flusses Anio (heute Aniene) rund achtzig Kilometer in Richtung Osten, aber nicht gleich ganz in die Wüste. Gregor erzählt nämlich, seine Amme sei ihm „als Einzige gefolgt“. Von ihr heißt es, dass sie ihn arctius liebte, was genau übersetzt bedeutet: „sehr eng, allzu eng“. Die beiden gelangten schließlich in den in einer bergigen Gegend liegenden Ort Effide (das heutige Affile) und ließen sich dort nieder.
Was da in diesem ersten Kapitel des „Lebens des heiligen Benedikt“ erzählt wird, ist von etwas rätselhafter Symbolik, die man anscheinend meistens nicht groß beachtet hat. Man hat sich vorwiegend auf das erste Wunder konzentriert, das Benedikt dort wirkte: Auf sein intensives, von Tränen begleitetes Gebet hin wurde ein tönernes Getreidesieb, das der Amme versehentlich entzweigebrochen war – und sie hatte es von einer Nachbarin geliehen! –, wieder heil.
Dass ein junger Mann, der Mönch werden wollte, sich mit seiner Amme in Richtung Wüste auf den Weg machte, wirkt recht merkwürdig. Die Wüstenväter in Palästina und Ägypten hätten über ein solches Paar nicht schlecht gestaunt. War da ein Abnabelungsprozess noch nicht gelungen?
Interessanterweise heißt es direkt nach dem Satz, in welchem von der Benedikt allzu eng liebenden, ihm einzig nachfolgenden Amme die Rede ist, dass in Effide „viele ehrenwerte Männer dort aus Liebe (caritate) in der Kirche des heiligen Petrus weilten“. Das ist wieder eine rätselhafte Formulierung. Warum muss die „Ehrenwertigkeit“ der Männer betont werden (und nicht etwa, wie üblich, die große Frömmigkeit)? Warum, dass sie aus caritas dort weilten?
Wird da diskret – oder doch eigentlich deutlich – der notwendige Übergang, ja Ernüchterungs- und Reifungsprozess von amor zu caritas angedeutet, also von der Mutter- oder latent erotischen Liebe zur nüchternen Nächsten- und Gemeinschaftsliebe?
Und was war das für eine eigenartige Männergruppe? Warum wird sie nicht mit den üblichen Ausdrücken für eine geistliche Gemeinschaft beschrieben?
Mehr als diese Fragen stellen kann man hier wohl nicht.
Und dann das capisterium, das Getreidesieb. Es ist kaum zu glauben, dass Gregor damit überhaupt nichts Symbolisches sagen wollte. Wieder kann man nur Vermutungen anstellen. Ein solches Sieb dient jedenfalls zur Scheidung von Spreu/Schmutz und Getreide, deutet also auf eine klare Unterscheidung hin: Das Unterscheidungsmedium zerbricht kurz; Benedikt stellt es auf wunderbare Weise wieder her und „tröstet seine Amme zärtlich“. Dieses Wunder, das er da gewirkt hat, verbreitet sich im Ort wie ein Lauffeuer und wird allgemein bestaunt. Alle wollen das heil gewordene Getreidesieb sehen.
Gregor kommentiert dies so: „Von daher sollten alle Gegenwärtigen und Künftigen erkennen, mit welcher Vollkommenheit der junge Benedikt seine gnadenreiche Lebensweise begann.“ Auch diese Aussage schillert wieder: Bezieht sich die „Vollkommenheit“ auf seine Fähigkeit, mit einem Wunder ein zerbrochenes Sieb wieder ganz zu machen oder auf seine Unterscheidungs- und Entscheidungsfähigkeit?
Was in der Erzählung folgt, deutet eher auf Letzteres: „Aber Benedikt wollte lieber die Übel der Welt aushalten als deren Lob, lieber von Mühsal ermüdet als von den Gunsterweisen dieses Lebens erhoben werden. So floh (fugiens) er heimlich von seiner Amme. (Das ist die erste Etappe seiner fuga, „Flucht“). Er suchte einen abgelegenen Wüstenort namens Subiaco auf, ungefähr vierzig Meilen (75 Kilometer östlich) von Rom entfernt.“
Das ist ein zweiter recht herzloser Abschied, jetzt von seiner treuen Amme; vielleicht wäre sonst der Ablösungsprozess nicht gelungen. Jedenfalls ist jetzt die Abnabelung geschafft, bei Benedikt psychologisch und örtlich.
Wovon, inwiefern und wie muss sie beim heutigen Menschen stattfinden, der einen fruchtbaren Wüstenort aufsuchen will?