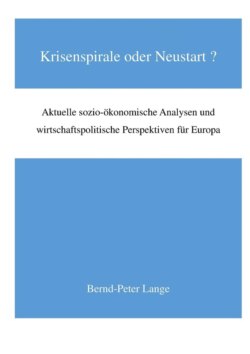Читать книгу Krisenspirale oder Neustart? - Bernd-Peter Lange - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеWir schrieben vor einem Jahr das Jahr 2014: 200 Jahre nach dem Wiener Kongress als Reaktion auf die napoleonischen Kriege, - der Wiener Kongress als der 2. Versuch nach dem westfälischen Frieden eine "dauerhafte" Friedensordnung in Europa zu etablieren -, 100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges, 75 Jahre nach Beginn des 2. Weltkrieges, der mit dem 1. Weltkrieg zusammenhängt und den Tiefpunkt jeder zivilisierten Entwicklung in Europa markiert. 2014 sind aber auch 65 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes vergangen, der freiheitlichsten Verfassung in Deutschland, die es je gab, und 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjet-Union und des Mauerfalls in Berlin. Dieses freudige Ereignis ermöglichte inzwischen 9 osteuropäischen Staaten, der Europäischen Union beizutreten, und damit nach Europa zurückzukehren. 2014 fanden auch Wahlen zum europäischen Parlament statt und es wurde eine neue EU Kommission unter ihrem Präsidenten Jean Claude Juncker gebildet. Die Europäische Union seit 1956 gewachsen, auch und gerade jetzt unter Einschluss osteuropäischer Staaten und Slovenien und Kroatien, ist gemessen an den Kriegen vorher und den Zeiten des "kalten Krieges" und gemessen an früherem Nationalismus ein "Wunder" und ist sowohl politisch als auch ökonomisch ein historisch einmaliges Freiheits- und Friedenswerk in Bezug auf die Integration ganz verschiedener Völker und Länder nach demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien. Am 10. Dezember 2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis - nicht nur eine Anerkennung des bisher Geleisteten sondern auch eine Verpflichtung für die Zukunft!
Die Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 haben aber auch zwei besorgniserregende Ergebnisse gezeitigt; zum einen war die Wahlbeteiligung in einigen Ländern wie z.B. in der Slowakei sehr gering, zum anderen haben Parteien mit dezidiert antieuropäischen Programmen starken Zulauf erhalten: So wurde die Front National in Frankreich dort die stärkste Partei, ebenso die UKIP in Großbritannien. Dies zeigt, dass die Begeisterung für das europäische Integrationsprojekt stark nachgelassen hat. Die Revolution in der Ukraine in diesem gleichen Jahr ist trotzdem auch ein Zeichen, welche Strahlkraft die Europäische Union zumindest nach außen nach wie vor entfaltet, auch wenn die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Destabilisierung zumindest der Ostukraine durch Russland unter Führung von Putin ein barbarischer Rückfall ins 19. bzw. 20. Jahrhundert darstellt. Diese Entwicklungen gemahnen, den erreichten Stand der europäischen Integration nach innen nicht als selbstverständlich und auf Dauer gesichert anzusehen und nach außen weiterhin konsequent eine offene Nachbarschaftspolitik auch und gerade der Ukraine gegenüber zu betreiben. Dies ist leicht gesagt aber schwer zu realisieren: Für ein vereintes Europa und ein Europa der friedlichen Nachbarschaft muss auf allen Ebenen der Politik und Zivilgesellschaft geworben und gekämpft werden.
Im Jahre 2000 hatte die EU das Ziel formuliert, bis zum Jahre 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Dies ist nicht gelungen. Im Gegenteil: Die EU steckt heute in der tiefsten Krise ihrer Geschichte, geprägt durch demographischen Wandel - Europa ist der einzige Erdteil, dessen Bevölkerung sinkt -, hohe, bisher immer noch wachsende Staatsverschuldung, politische Krisen in wichtigen Ländern der EU wie z. B. Griechenland, Italien oder Spanien, eine hartnäckige globale Finanzmarkt- und eine tiefgehende Eurokrise mit zentrifugalen Desintegrationskräften, schwaches und uneinheitliches Wirtschaftswachstum und strukturelle Arbeitslosigkeit mit besonders einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50% wie in Spanien. Außerdem stellen in vielen Ländern Europas rechts-populistische Parteien verstärkt die europäische Integration grundsätzlich in Frage.
Es stellt sich also die Frage, wie es zu diesen Europäischen Krisen kommen konnte, wieso strategische integrationspolitische Orientierungen sowohl auf EU- als auch auf nationalstaatlicher Ebene ins Leere liefen, wieso Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik offenbar versagt haben und vor diesem Erfahrungshintergrund welche Perspektiven es auf dem Weg zur Sicherung der europäischen Integration zu wieder dynamischem Wirtschaftswachstum, hoher Beschäftigung, ausgeglichener Einkommens- und Vermögensverteilung, Abbau der Staatsverschuldung und wirtschaftlicher und politischer Stabilität gibt. Grundsätzlich ist nach einer Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Wirtschaft, nach Regulierungsanforderungen besonders für Banken und nach ordnungspolitischer Neuorientierung besonders in der Eurozone zu fragen. Es geht um nicht weniger als um den weiteren Zusammenhalt der europäischen Union. Dabei müssen auch die Interdependenzen zwischen den Krisen herausgearbeitet werden: Wie weit haben die Rettungspakete für Banken in Schieflage die Staatsverschuldung weiter vorangetrieben? Ist dadurch die Eurokrise überhaupt erst ausgebrochen? Ist die Rettungspolitik gegenüber Griechenland gescheitert? Wenn ja, was dann? Haben Staatsschulden- und Eurokrise die drohende Spaltung Europas in einen prosperierenden Norden und einen kranken Süden beschleunigt? Nur wenn diese Fragen beantwortet sind, lässt sich auch eine umfassende Strategie zur Bekämpfung der verschiedenen, und doch zusammenhängenden Krisen diskutieren. Der Begriff der Krise umfasst daher zwei Perspektiven: Zum einen geht es um die Erfassung sich zuspitzender Fehlentwicklungen im Sinne einer abwärts gerichteten Spirale, zum anderen geht es um die Auslotung der Bedingungen eines Neuanfangs, um die Chancen, die Krise zu überwinden und in Zukunft zu verhindern.
Die Verwendung des Begriffes "Sozio-Ökonomie" ist Ausdruck eines Programms: Es geht darum, einen Beitrag zur Re - Formulierung der herrschenden Wirtschaftstheorie des Modell- orientierten "zeitlosen" Neo-Liberalismus zu leisten. Nur so können die Wirtschaftswissenschaften wieder als Sozialwissenschaften etabliert werden. Dies bedeutet, dass Kategorien wie Machtausübung und Herrschaft zentral für die sozio-ökonomischen Analysen sein müssen. Dies bedeutet weiterhin, dass wirtschaftliche Entwicklungen in ihrem jeweiligen historischen und sozialen Kontexten zu behandeln und dabei psychologische, soziologische, politische und juristisch-regulatorische Aspekte zu berücksichtigen sind. Daher ist ein interdisziplinärer Ansatz geboten.
In dieser Einführung gehe ich nicht systematisch - also z. B. von der Mikroökonomie über die Analyse der Marktformen hin zur Makroökonomie - vor, sondern schildere am Beispiel der krisenhaften Entwicklung seit 2007, was einen sozio-ökonomischen Ansatz leisten kann. Dabei werden verschiedene Aspekte der Krise analysiert: zunächst die internationale Finanzmarktkrise, sodann die Eurokrise in verschiedenen Ländern, dann die Staatsschuldenkrise und schließlich die Krise der Europäischen Integration mit den jeweiligen Querverweisen zwischen diesen Teilbereichen. Es geht darum, hinter den Erscheinungsformen z. B. von Bankenzusammenbrüchen bzw. -rettungen die Ursachen und Folgen zu ergründen und die kontroversen politischen Antworten darzustellen und nach ex- und impliziten Interessenpositionen und den jeweiligen externen Effekten zu bewerten. Vor dieser Folie sollen dann eigene Krisenvermeidungs- bzw. Bewältigungsstrategien zur Diskussion gestellt werden.
Als der Verfasser 1963 das wirtschaftswissenschaftliche Studium an der Universität Bonn aufnahm, lehrte Professor Krelle: "Vergessen Sie Krisen. Wir haben heute ein wirtschaftswissenschaftliches Instrumentarium, um einen gleichmäßigen, aufsteigenden Wirtschaftspfad zu steuern". Es war vom Beginn des "golden age" die Rede. Vergegenwärtigt man sich diese Prophezeiungen, so muss man sich fragen: Was ist in den herrschenden Wirtschaftswissenschaften falsch gelaufen?
Das Krisenparadigma setzt begriffsnotwendig als Gegenentwurf den "Normalzustand" wirtschaftlicher Entwicklung voraus: ausgeglichene Haushalte, angemessenes Wachstum, hohes Beschäftigungsniveau, stabile Währungen und nachhaltige europäische Integration. Aus historischer Perspektive ist zu fragen, ob der postulierte Normalzustand nicht auch ein Artefakt ist. Dann wäre Krisenbewältigung bzw. -vermeidung unter anderen Perspektiven zu diskutieren, als unter der der Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten Normalität und Stabilität. Es wäre dann besonders nach gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Resilienz gegen allfällige Krisenschocks angesichts dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung und kontinuierlichem gesellschaftlichem Wandel zu fragen.
Der Begriff der Krise enthält auch immer den Verweis auf die Chancen, die sie eröffnet: Chancen zu einem Neustart, die die Krisenerfahrung eröffnet. Diese Publikation weist bei aller oft grundsätzlichen Kritik den Weg zu praktikablen, ordnungspolitisch begründeten Reformschritten.
In diesem Zusammenhang soll auch die Kritik der vorherrschenden Wirtschaftstheorie zur Krisenerklärung entfaltet werden mit deren Artefakt des homo oeconomicus, des immer rational handelnden Menschen sowohl als Konsument als auch als Investor als auch als Banker oder Unternehmer. Dabei wird auch das Postulat sich selbst regulierender Märkte - also ohne staatliche Intervention - einem Realitätscheck unterzogen.
Auf der Basis dieser beiden Analysestränge werden dann Strategien zur Überwindung der Krisen diskutiert auf breiter interdisziplinärer Basis: es geht um juristische Regulierung und ihre jeweilige Wirksamkeit, es geht um alternative wirtschaftspolitische Konzepte auf der Basis unterschiedlicher wirtschaftstheoretischer Ansätze und spezifischen gesellschaftlicher Interessen, es geht um gesellschaftspolitische Grundvorstellungen über das Verhältnis von wirtschaftlicher Macht und demokratisch legitimierter politischer Souveränität, es geht schließlich um die Perspektiven der europäischen Integration vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen.
Kontroverse Ansätze sollen jeweils zunächst dargestellt und sodann auf ihren ideologischen Hintergrund abgeklopft werden. Ideologien sind Argumentationsstränge, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, tatsächlich aber spezifische Interessenpositionen absichern sollen.
Ziel dieser Analysen ist es
- die relevanten realen Vorgänge mit Hilfe eines sozio-ökonomischen Instrumentariums zu sezieren und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu beschreiben,
- Ursachen und Wirkungszusammenhänge theoretisch zu erfassen und das heißt hinter den vielfältigen Erscheinungsformen wirtschaftlicher Entwicklungen nach Gesetzmäßigkeiten und Strukturen zu fragen,
- jeweils herauszuarbeiten, was politisch zur Krisenbekämpfung getan oder aber auch unterlassen wurde; dabei geht es auch darum zu ergründen, wem das Eine oder wem das Andere nützt.
- die notwendigen weiteren regulatorischen und politischen Reformschritte zu skizzieren;
- hierbei sollen so weit als möglich Erkenntnisse, die aus anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen fruchtbar gemacht werden können, verarbeitet werden.
Da es keine wertfreie Sozialwissenschaft gibt - schon die Auswahl der behandelten Themen stellt eine Wertentscheidung dar -, muss bei allen Analysen der jeweilige Wertehorizont so präzise wie möglich offengelegt werden. Hier spielen die im Grundgesetz verankerten Werte, wie z. B. das Selbstbestimmungsrecht jeder einzelnen Person gerade auch gegenüber mächtigen wirtschaftlichen Institutionen wie z. B. Banken, und das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, - so viel Markt wie möglich, so viel staatliche Regulierung wie nötig -, eine besondere Rolle. Hier geht es auch um die volle Entfaltung demokratischer Entscheidungen angesichts wirtschaftlicher Macht auf den verschiedenen Ebenen der Nationalstaaten, der EU und auf globaler Ebene. Die Frage lautet: Sind die institutionellen Arrangements auf diesen Ebenen bzw. ist ihr Zusammenwirken effizient genug, um global agierenden Banken und anderen Finanzinstitutionen wie Hedge Fonds - gerade auch in Bezug auf ihre engen Verflechtungen untereinander - einen festen ordnungspolitischen Rahmen vorzugeben? Sind demokratisch legitimierte Institutionen so durchsetzungsfähig, damit Krisen soweit als möglich vermieden werden können bzw. ihre negativen Auswirkungen nicht immer wieder die Allgemeinheit schwer belasten. Die weitere ordnungspolitische Frage auf der Basis eines Konzepts eines funktionsfähigen Währungsraumes lautet: Welche wirtschaftspolitischen Schritte sind erforderlich, um die Eurokrise, die von der Finanzkrise befeuert wurde, dauerhaft zu beenden. Damit zusammenhängend ist nach dem notwendigen Wertewandel in Politik und Gesellschaft auf der Basis des Konzepts von Generationengerechtigkeit zu fragen, um die weitere Ausbreitung der Staatsschuldenkrise zu stoppen. Schließlich ist zu klären, ob der weitere Weg zu vereinigten Staaten von Europa als Bundesstaat sui generis einen Ausweg aus der Krise der europäischen Integration darstellt und wenn ja, wie er konkret beschritten werden kann.
Der hier vertretene Wertehorizont geht also von der Priorität der Grundrechte und dem Demokratiegebot aus. Er orientiert sich an den ordnungspolitischen Grundentscheidungen des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft. Er speist sich darüber hinaus aus den Überzeugungen der friedensstiftenden Funktion der europäischen Integration.
Neben der interdisziplinären Anlage der Analysen geht es auch um einen vergleichenden Ansatz zwischen den Entwicklungen in den USA und der EU, dabei weiter differenzierend zwischen den Entwicklungen der einzelnen Mitgliedsländer.
Bei diesem Unterfangen ist eine unendliche Fülle von Materialien - Statistiken, Dokumenten, Gerichtsentscheidungen und Literatur - zu sichten und aufzuarbeiten. Dabei kann es nicht um Vollständigkeit gehen, sondern nur um eine Auswahl der für diese Analysen wesentlichen Unterlagen. Verweise auf einschlägige Literatur dienen auch als Anregungen zur vertieften eigenen Auseinandersetzung.
In Bezug auf über die Tatsachen wiedergebende Berichte hinausgehende mediale Einschätzungen ist Vorsicht geboten. Privatwirtschaftliche Medien neigen aus Gründen des Buhlens um Aufmerksamkeit zu negativen Schlagzeilen und zur Skandalisierung von Ereignissen. Wie oft ist schon in den vergangenen 5 Jahren das Ende der Euro Zone beschworen worden, wie oft stand die nächste Finanzkrise unmittelbar bevor, ohne dass diese "Berichte" seriös begründet waren. Es ist daher zwischen oft negativen "headlines" und oft medial vernachlässigten "trendlines", den positiven durchgängigen Entwicklungen, zu unterscheiden.
Wichtiger als das Streben nach Vollständigkeit erscheint dem Verfasser die Überprüfung von Tatsachenbehauptungen und deren Einordnung in den jeweiligen Kontext und die klare Herausarbeitung unterschiedlicher wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Konzepte mit jeweiligen konträren wirtschaftspolitischen Konsequenzen. Dem Leser soll so die Möglichkeit gegeben werden, sich eine eigene fundierte Meinung zu den brennenden Fragen der Gegenwart zu bilden.