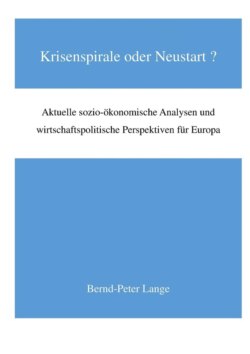Читать книгу Krisenspirale oder Neustart? - Bernd-Peter Lange - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Warum diese Form der interdisziplinären Analyse?
ОглавлениеDie Krise der Finanzierung des Immobilienmarktes in den USA hat sich negativ nicht nur auf die Stabilität der Immobilienmärkte und der Banken ausgewirkt, sondern hat auch die weltwirtschaftliche Entwicklung massiv beeinträchtigt. Diese langandauernde Kettenreaktion ist mit den herkömmlichen Instrumenten der neoklassischen Wirtschaftstheorie - die These lautet: sich selbst überlassene Märkte führen immer relativ schnell zu einem Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurück - nicht erklärbar.
- Die weltweiten Finanzmärkte waren und sind in dieser Krise auch heute noch nicht in der Lage, durch wettbewerbliche Anpassungsprozesse aus sich heraus wieder zu Stabilität und Wachstum zurückzufinden. Die Finanzmarktkrise dauert inzwischen mehr als 7 Jahre. Ein derartiges Marktversagen kommt in der herrschenden Wirtschaftstheorie nicht vor.
- Die staatliche Regulierung der Finanzmärkte hat insbesondere auf Grund der staatlichen Deregulierung vor der Krise - begründet mit der Behauptung der immer zum Gleichgewicht tendierenden Selbstregulierung der Märkte - versagt. Dies ist nur durch eine erweiterte politikwissenschaftliche Analyse zu erklären. Dabei sind die Wellenbewegungen von strenger Ordnungspolitik hin zur Deregulierung und zurück in ihrem zeitlichen Verlauf zu analysieren.
- In Folge dieser Entwicklungen ist das Vertrauen in den Finanzsektor weltweit nachhaltig erschüttert. Vertrauen in den Geldwert, Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der Banken in Bezug auf dort getätigte Einlagen ist aber die Grundvoraussetzung der Funktionsfähigkeit marktwirtschaftlicher Wirtschaftsordnungen. Eine Analyse über die Voraussetzungen von Vertrauen sowohl bei Bankkunden - Privatpersonen und Unternehmen - als auch zwischen Banken ist bisher kein Thema der herrschenden Wirtschaftswissenschaften. Vertrauen ist aber grundlegend für soziale Beziehungen, indem es Menschen Sicherheit gibt und Gesellschaften stabilisiert. Nur wenn es gelingt, Aufbau und Zerstörung von Vertrauen aus dem psychologischen Wissen über menschliche Verhaltensweisen und Reaktionen zu erklären, kann es gelingen, zu einer gewissen Stabilität des Bankensektors zurückzufinden. Der Artefakt des homo oeconomicus, des wirtschaftlich immer rational handelnden Menschen, verstellt den Blick auf menschliche Emotionen, auf Gier, auf Geiz, auf Größenwahn, auf Panikreaktionen, auf Herdentrieb und auf Handeln aus Prestige- und Herrschaftssucht.
- Die Lobby des internationalen Finanzsektors versucht die notwendige (Re-) Regulierung auf nationaler und internationaler Ebene zu blockieren. Die Politik hechelt permanent der Krise hinterher und versucht immer aufs Neue, Zeit zu gewinnen. Nationale und internationale Politik befinden sich offenbar in dem Dilemma, einerseits der Empörung und der Wut der von der Krise Geschädigten durch (angeblich) strengere Regulierung Rechnung zu tragen und andererseits der "mächtigen" Bankenlobby nicht zu weh zu tun. Nur durch eine sozialwissenschaftliche Analyse lassen sich die Probleme demokratischer Willensbildung zur Wirtschaftspolitik auf nationaler, auf EU- und internationaler Ebene angesichts "nervöser" Finanzmärkte, angesichts automatisierter computergestützter Börsen und angesichts von sog. Schattenbanken wie Hedge Fonds erklären. Macht und Herrschaft eines entfesselten weltweiten Finanzsektors müssen dabei zentrale Kategorien sein. Wirtschaftssoziologische Analysen können hier hilfreich sein.
- Die weltweite Finanzmarktkrise hat die Eurokrise und die Staatsschuldenkrisen in Europa, aber auch in den USA und Japan verschärft. Die Versuche zur Rettung der Krisenstaaten im südlichen Europa durch sog. Rettungsschirme für Banken und Staaten aber auch durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank hat Europa gespalten. Dadurch steht das "Jahrhundertprojekt" der europäischen Integration am Scheideweg: Zurück zu Nationalismus oder Vorwärts zu demokratischen legitimierten Vereinigten Staaten von Europa? Welches sind die Kräfte, die in die eine oder andere Richtung weisen? Was wären die jeweiligen Folgen? Welche Rolle spielt dabei die Bundesrepublik Deutschland? Geht es um ein europäisches Deutschland oder um ein deutsches Europa? Hier bedarf es gesellschaftswissenschaftlicher Analysen unter Einbezug historischer Erfahrungen insbes. aus zwei Weltkriegen bzw. dem oft auch genannten zweiten 30jährigen Krieg.
- Die internationale Finanzmarktkrise, die Eurokrise und die Staatsschuldenkrisen kumulieren in der Krise der europäischen Integration. Kann diese Krise genutzt werden zu mutigen Schritten zur weiteren Integration wie z. B. der Durchsetzung einer europäischen Bankenunion und/oder einer europäischen Wirtschaftsregierung und einer Energieunion oder führt die Krise zurück zu Renationalisierung und Zerfall des Euro?
- In diesen Krisen wird besonders zweierlei deutlich: Erstens wird um das "europäische Geschäftsmodell" angesichts der weltweiten Konkurrenz um Innovationen, Ressourcen, Produktionsknowhow, Technikentwicklung, Arbeitskräfte und ihre Qualifikation und um Absatzmärkte gerungen. Welches sind die Perspektiven für die soziale Marktwirtschaft in Deutschland? Eignet sie sich als Vorbild für Europa? Ist eisernes Sparen in den Staatshaushalten nicht nur der PIIGS-Staaten - Portugal, Irland, Italien und Griechenland - eine Vorbedingung zur Erhaltung internationaler Wettbewerbsfähigkeit? Oder aber führt die Austeritäts- Politik in eine Abwärtsspirale von Minuswachstum, steigender Arbeitslosigkeit insbes. bei Jugendlichen und damit zu einem weiteren Anstieg der Staatsverschuldung? Besteht die Gefahr einer unheilvollen Verbindung von wirtschaftlicher Stagnation und Deflation wie in jüngster Zeit in Japan? Gibt es dagegen eine Förderung des Wirtschaftswachstums, die Arbeitsplätze besonders für hoch qualifizierte Jugendliche schafft, die aber nicht die Staatsschulden weiter aufbläht? Woran scheitern die dringend notwendigen Investitionen in den Bereich der erneuerbaren Energien, in den Bildungssektor und in die Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur? Zweitens wird deutlich, dass es dringend einer breiten öffentlichen Diskussion zur strategischen Orientierung der EU sowohl nach innen als auch nach außen bedarf: Was ist mit der Perspektive der "Vereinigten Staaten von Europa" gemeint? Welche Schritte dahin können realistisch gegangen werden? Sollen weitere Länder als Mitglieder in die EU aufgenommen werden oder geht es vorrangig in den nächsten Jahren um Konsolidierung nach innen? Welche außenpolitische Rolle kann die EU angesichts der vielen Konflikte in der Welt spielen ohne sich zu übernehmen?
- Mit der Entwicklung des "Turbokapitalismus" seit dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperialismus geht einher die stetige Vergrößerung der Schere zwischen "Reich" und "Arm" in den westlichen Industrienationen, und dies auch und gerade in dieser Krise seit 2007, wobei immer auch zwischen absoluter und relativer Armut zu unterscheiden ist. Der Prozess der gesellschaftlichen Entsolidarisierung schreitet weiter voran. In der politischen Auseinandersetzung der Parteien spielt der Ruf nach mehr Gerechtigkeit eine zunehmende Rolle, wobei die Vorstellungen von Gerechtigkeit diffus sind und zwischen Leistungs-, Verteilungs- und Chancengerechtigkeit hin und her schwanken. So bleibt die Frage nach den Mechanismen der Einkommens- und Vermögensverteilung und der Rolle des Staates hierbei zu analysieren.
Die Europäische Union mit ihren mehr als 500 Millionen Bürgern macht 7% der Weltbevölkerung und knapp 25% des Weltsozialprodukts aus, verteilt aber gleichzeitig 50% der Weltsozialausgaben in ihrem Gebiet. Unter welchen Bedingungen hat dieses Wirtschafts- und Sozialmodell noch eine Zukunft? Gleichzeitig findet ein rigoroser Verteilungskampf unter den Staaten der EU um günstige Kredite, um Subventionen, um Standortvorteile durch günstige Steuern und um Rettungsschirme mit ihren Garantien statt. Wie weit muss die Bundesrepublik in europäischer Solidarität bürgen für wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen z.B. in Griechenland, Spanien und Portugal oder Zypern auch um die europäische Union zusammenzuhalten? Oder müssen diese Länder die in Folge der Krise hohe Arbeitslosigkeit, besonders bei den Jugendlichen (zum Teil über 50%), allein bekämpfen?
Hieraus folgt - so die zu begründende These -, dass die vorherrschende Volkswirtschaftslehre auf der Basis des Neoliberalismus nicht in der Lage ist, diese Fragen zu beantworten, d. h. die umfassende Krisenentwicklung adäquat zu erklären. Daher kann sie auch nicht nachhaltige Instrumente und Lösungen zur Krisenbekämpfung bereitstellen. Es bedarf daher eines neuen Zugangs zu diesen essentiellen Fragen in sozio-ökonomischer Perspektive.