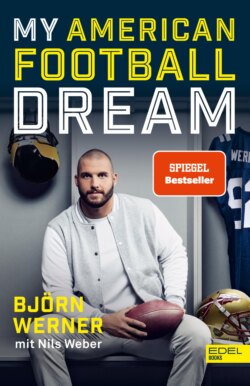Читать книгу My American Football Dream - Björn Werner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Huddle Vom Traum zum Plan zur Tat
ОглавлениеSchweigen. Nur die Stimmen aus dem Fernseher, auf den meine Eltern starrten, waren zu hören, während ich im Raum stand und die Worte noch in meinem Kopf nachhallten. Vielleicht hatte ich mal wieder zu leise gesprochen. „Ich will nach Amerika gehen und Football spielen“, wiederholte ich nun etwas lauter und fügte mit trotzigem Nachdruck an: „Ich meine das ernst.“ Und dann endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, reagierten meine Mutter und mein Vater auf meine Worte. Sie brachen in schallendes Gelächter aus.
Für einen Teenager gibt es kaum etwas Schlimmeres – neben einem fetten Pickel am Morgen des ersten Dates oder der Auflösung der Lieblings-Boygroup – als das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Meine Eltern dachten zunächst, ich mache Witze. Da ich überhaupt nicht mitlachte, dachten sie als Nächstes: Der Junge spinnt. Die Hormone, zu wenig Schlaf, zu viel Playstation, schlechter Einfluss – das Übliche, was Eltern so denken, wenn sie ihre pubertierenden Kinder nicht verstehen. Als ich ihnen versicherte, dass es mein voller Ernst sei, und ich ihnen wie ein Wasserfall von den Gesprächen mit meinem Coach erzählte, kamen die Fragen wie eine Lawine zurück: Amerika? Wie stellst du dir das überhaupt vor? Wie soll das gehen? Wer soll das bezahlen? Was soll das Ganze überhaupt?
Es war nicht einfach, mich dagegen zu behaupten und meinen Eltern klarzumachen, dass es keine Teenie-Spinnerei war, sondern mein Traum, mein Wunsch und auch mein Ziel, denn ich wusste aus den Gesprächen mit meinem Coach, dass es tatsächlich einen Weg gab. Aus heutiger Sicht verstehe ich natürlich ihre Reaktion. In ihrer damaligen Lebenssituation, mit dem täglichen Kampf um unseren Lebensunterhalt und einem Reisehorizont, der an der deutschen Nord- und Ostseeküste endete, muss es in ihren Ohren wie der Schwachsinn des Jahrhunderts geklungen haben, dass ihr gerade erst 16 Jahre alt gewordener Junge nach Amerika gehen wollte, um diesen komischen Sport zu machen, bei dem der Ball nicht einmal rund ist, wie es sich für einen ordentlichen Ball gehört. Spätestens als die Sprache auf das Geld kam, war der Ofen aus, denn die Information, dass ein Austauschprogramm für eine staatliche High School so um die 10 000 Euro kosten würde, wie Jörg mir erklärt hatte, lässt sich einfach nicht schonend beibringen. Meine Eltern hätten zu dieser Zeit nicht einmal ein paar hundert Euro übriggehabt. Die Botschaft von Mama und Papa war unmissverständlich:
Junge, schlag dir das aus dem Kopf!
Einen Teufel tat ich. „Ihr braucht euch nicht zu kümmern, ich schaffe das allein“, entgegnete ich. Und obwohl ich es genau so meinte, wie ich es sagte, war ich mir darüber im Klaren, dass meine Eltern es für leeres Gerede hielten. Sie begriffen damals nicht, wie absolut ernst es mir war. Sie waren nicht Teil meiner Football-Welt, hatten keinen blassen Schimmer davon, wie gut ich in meinem Sport war, und auch nicht davon, was in meinem Kopf vorging, in dem sich Stück für Stück ein Traum zu einem Plan zusammensetzte wie ein Puzzle. Den Ernst der Lage realisierten sie erst später, als Jörg Hofmann bei uns zu Hause am Wohnzimmertisch saß, um meinen Eltern das ganze komplizierte Prozedere zu erklären, und wir die Köpfe zusammensteckten wie in einem Huddle auf dem Footballfeld, wenn der Quarterback den nächsten Spielzug ansagt.
Die Operation USA war ein komplizierter Prozess, der sich über mehrere Monate erstreckte, und während meine Eltern zunächst nichts dazu beitrugen, weil sie immer noch glaubten, ihr verwirrter Junge würde sich schon wieder einkriegen, steckte ich all meine Energie hinein und tat wirklich alles dafür, meinen Traum zu realisieren.
Ich hatte nie einen Plan B. Seit meinem 15. Lebensjahr gab es für mich immer nur das Ziel, Footballer in der NFL zu werden. Alles, was ich dachte und tat, baute darauf auf. Was muss ich tun, um in die NFL zu kommen? Ich muss der beste Spieler meiner Mannschaft werden. Ich muss der beste Spieler meines Jahrgangs in Deutschland werden. Ich muss an eine amerikanische High School gehen. Ich muss dort der beste Spieler werden, um ein Stipendium für ein großes College zu bekommen. Ich muss am College einer der besten Spieler meines Teams werden. Ich muss auf meiner Position einer der besten Spieler in ganz Amerika werden, um es in die NFL zu schaffen. So simpel und doch so unendlich schwer. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich es nicht geschafft hätte, aber möglicherweise wäre ich nie so weit gekommen, wenn ich auf diesem Weg auch nur einmal an mir selbst gezweifelt hätte.
Ich wusste, dass ich es schaffen würde. Ich war felsenfest davon überzeugt. Ich wusste nur noch nicht genau wie.
Ein Austauschprogramm war schnell vom Tisch, denn die finanzielle Hürde war einfach zu hoch, und auch mein Coach hatte keine Idee, wie wir die Kohle zusammenkriegen sollten ohne Lottogewinn oder reiche Tante in Amerika, die ich leider nicht hatte.
Mir war bewusst, dass es nicht reichen würde, nur meinen Körper in die bestmögliche Verfassung zu bringen und an meinen Football-Skills zu arbeiten. Auch der Kopf musste mitspielen. Wer nicht halbwegs gute Noten in der Schule hatte, der hatte kaum eine Chance, ein Stipendium zu ergattern, und ohne gute Englischkenntnisse konnte ich die ganze Sache gleich vergessen. Mein Problem: In Englisch war ich eine Gurke. Ich hatte zwar alle Fachbegriffe im Football drauf und konnte diese auch einigermaßen cool aussprechen, darüber hinaus war mein Wortschatz jedoch arg begrenzt, vom flüssigen Formulieren grammatisch korrekter Sätze ganz zu schweigen. Das lag zum einen daran, dass ich nicht als Sprachtalent geboren bin, zum anderen war ein geregelter Englischunterricht an meiner neuen Schule kaum möglich. Wenn ich ehrlich bin, dann war eigentlich überhaupt kein geregelter Unterricht möglich.
Der ganze Schlamassel hatte mit meinem Wechsel auf die Max-Eyth-Oberschule in Reinickendorf begonnen. Nach der Beendigung der Grundschule hatte man die Möglichkeit, drei Wunsch-Schulen anzugeben, von denen es dann auf jeden Fall eine werden würde. Ich bekam aber einfach eine vierte zugeteilt – die Arschkarte. Weder konnte ich mit meinem besten Freund Cedric zusammen zur Schule gehen noch mit irgendeinem anderen meiner Mitspieler. Kein anderer Adler weit und breit. Weitaus schlimmer war aber, dass man mich in die größte Problemklasse steckte. Unser Klassenraum war ganz hinten auf dem Schulgelände untergebracht, in einem von mehreren Bungalows, abseits des Hauptgebäudes, und ich begriff schnell, warum. Vorne waren die schöneren Klassen mit den schlaueren und artigen Kids untergebracht und hinten die mit den nicht ganz so schlauen und pflegeleichten. Es gab vier siebte Klassen, und ich war in der vierten davon, in der D, wenn ich mich recht erinnere. Wenn man in der Pause einen Snack in der Cafeteria kaufen wollte, die im Hauptgebäude untergebracht war, musste man gefühlt erst mal zehn Minuten latschen. Es fühlte sich an wie eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: die da vorne, wir da hinten.
Nach ein paar Monaten verstand ich dann auch das heimliche Ranking der vier siebten Klassen. Wenn jemand in den anderen drei Schulklassen Mist gebaut hatte und aus der Klasse flog, dann darf man dreimal raten, in welche er gesteckt wurde: in meine. Und wer es dann fertigbrachte, auch noch aus meiner Klasse zu fliegen, der flog von der Schule.
Es war wie in einem schlechten Film, und im Unterricht ging es oft zu wie bei Fack ju Göhte, was wiederum ein großartiger Film ist. Es war laut, chaotisch, Mitschüler liefen herum, machten Quatsch, verhöhnten die Lehrer, bewarfen sie mit Papierkugeln oder bespuckten sie sogar. In meiner damaligen Klasse von montags bis freitags Lehrer zu sein, muss mindestens genauso hart und aufreibend gewesen sein, wie an jedem verdammten Sonntag in der NFL Football zu spielen – allerdings mit weitaus geringeren Erfolgsaussichten und ohne jede Form von Applaus. Es war wirklich krass.
In der Klasse saß ich meistens weiter hinten, und was vorne am Pult oder der Tafel gesagt wurde, kam bei mir oftmals nur als Wortfetzen an. Ich beteiligte mich nicht an dem ganzen Mist meiner Mitschüler, denn die Lehrer taten mir leid. Ich beschloss, einfach meine Klappe zu halten und die Ohren weit aufzusperren, um so viel wie möglich mitzubekommen, und hoffte, dass das ausreichen würde, um mich irgendwie durchs Schuljahr zu manövrieren und versetzt zu werden. Diese Strategie funktionierte eine Weile ganz gut, aber spätestens in der zehnten Klasse war klar: Ich brauchte Hilfe. Nachhilfe. Meine Englischkenntnisse reichten längst nicht aus, um im Ausland zur Schule gehen zu können. Ich musste sie unbedingt verbessern und fand den benötigten Support nicht etwa im Umfeld meiner Schule, sondern beim Football, genauer gesagt in meiner Mannschaft. Die Mutter unseres Quarterbacks Ricky Smith erklärte sich bereit, mir Nachhilfe zu geben. Ricky kam aus einer deutsch-amerikanischen Familie, einer richtigen Football-Familie, und seine Mom war eine großartige Lehrerin, der ich bis heute dankbar für die Unterstützung bin.
Wie es der Zufall oder aber das Schicksal wollte, stieß ich auf der Website von Berlin Thunder auf eine Story, in der für das International Student Program, kurz ISP, geworben wurde, ein Förderprogramm für Footballtalente. Dieses von der NFL unterstützte Programm war gerade erst von dem US-Amerikaner Patrick Steenberge, einem ehemaligen Quarterback am legendären College Notre Dame und Chef der Firma Global Football, ins Leben gerufen worden. Ziel war es, die größten internationalen Talente schon im Jugendalter über den großen Teich an eine High School zu bringen, damit sie in der Wiege des Footballs bestmöglich gefördert wurden und sich unter amerikanischen Bedingungen weiterentwickeln konnten, um es möglicherweise an ein College zu schaffen und von dort aus vielleicht sogar bis in die NFL. Nur fünf oder sechs Talente wurden pro Jahr ausgewählt und hatten dann die Chance auf ein Stipendium an einer privaten High School, einem richtigen Internat, in New England. „Stipendium“ war für mich das Zauberwort, denn es zauberte die belastende Frage weg, wer den ganzen Spaß bezahlen sollte.
Ich bewarb mich. Rickys Mutter half mir beim Ausfüllen der Formulare, und ich musste noch ein sogenanntes Highlight Tape mit Clips meiner besten Spielszenen auf dem Footballfeld einschicken. Patrick Steenberge war in Europa bestens vernetzt, und wie ich später erfuhr, erkundigte er sich auch bei Shuan Fatah nach mir, der ja bei Berlin Thunder als Coach tätig war und ganz genau wusste, welche Talente in seiner Stadt von sich reden machten. Er hatte mich ja auch schon beim JPD-Camp gesichtet, als ich noch ein Flag-Footballer war. Shuan muss jedenfalls ein gutes Wort für mich eingelegt haben.
Nicht lange nachdem ich die Bewerbung abgeschickt hatte, erhielt ich eine E-Mail, die sich in drei Worten zusammenfassen lässt: Du bist dabei. Ich konnte es kaum glauben. Ich war dabei! Weitere Informationen würden in den kommenden Wochen folgen, las ich. Die weiteren Informationen konnten warten. Ich war dabei. Das sei nur der erste Schritt, und es würden erst noch einige Dinge zu klären sein, stand im Kleingedruckten, das ich einfach überlas und auch gar nicht verstanden hätte. Ich war dabei. Nur diese Botschaft zählte für mich. Es war wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und Silvester an einem Tag. Und dann war wirklich Weihnachten und dann Silvester.
Das neue Jahr begann mit einem Ereignis, das mein Leben für immer verändern würde, und diesmal hatte es rein gar nichts mit Football zu tun, sollte aber Konsequenzen für meine Footballkarriere haben. Es war ein ganz normaler beschissener Vormittag an der Max-Eyht-Schule. In der großen Pause machte ich mich in der Januarkälte auf den Gewaltmarsch von den Bungalows zur Cafeteria, weil ich mir etwas Süßes gönnen wollte, und näherte mich dem Hauptgebäude. Was mich sonst immer schwer genervt hatte, störte mich nicht mehr. Die Lauferei, der ganz normale Wahnsinn auf dem Schulhof und in der Unterrichtsstunde zuvor und das zu erwartende Tohuwabohu in der Stunde danach, die Zwei-Klassen-Gesellschaft an dieser Schule – all das war mir jetzt auf einmal so was von egal. Das galt auch für die zunehmende Enge zu Hause, wo mir immer häufiger die Decke auf den Kopf fiel. Ich fühlte mich leicht und unbeschwert, denn ich wusste, dass ich in ein paar Monaten den Abflug machen und diesen ganzen Scheiß einfach hinter mir lassen würde. Tschö mit Ö!
Dann sah ich sie. Unsere Blicke trafen sich. Alles bewegte sich plötzlich in Zeitlupe, der Himmel färbte sich rosarot, und Streicher setzten ein … Natürlich nicht. Ich ging einfach weiter. Und zwinkerte dem schönen Mädchen mit den langen dunklen Haaren in formvollendeter Coolness zu. In ihrer Version zwinkerte sie mir aufreizend lässig zu, und ich guckte ziemlich dumm aus der Wäsche. Die Sache ist bis heute nicht endgültig geklärt. Es steht Aussage gegen Aussage. Erst mit Verzögerung – und das ist Fakt – traf mich der Blitz. Ich erstarrte. Dann drehte ich mich um, aber da war das Mädchen, das ich nach zweieinhalb Jahren an dieser Schule gerade zum ersten Mal gesehen hatte, schon im Getümmel verschwunden.
Ein paar Tage danach erreichte mich eine Nachricht über den MSN Messenger, ein damals sehr populäres Chat-Programm von Windows, das sehr verbreitet war. Sie konnte unmöglich von einem meiner Freunde oder Mitspieler sein, denn der Absender lautete: Muschimaus16. Das ließ mein Herz höherschlagen, und weil ich ein 16-jähriger Junge war, war mein Brustkorb nicht die einzige Körperregion, in der es pochte. Muschimaus klang aufregend und verheißungsvoll. Lockte da etwa ein unkompliziertes sexuelles Abenteuer? Meine Erwartungen diesbezüglich wurden enttäuscht. Muschimaus entpuppte sich als Denise aus einer der zehnten Klassen meiner Schule, die im Hauptgebäude untergebracht war, das Mädchen, mit dem ich Blickkontakt gehabt hatte. Sie war also eine von denen da vorne. Wir chatteten hin und her, und irgendwann konnte ich meine Neugierde nicht mehr zügeln und fragte sie, warum sie sich Muschimaus nannte. Sie antwortete, dass sie mit ihrem Vater irgendeinen Trucker-Film gesehen hatte, bei dem Codewörter eine Rolle spielten, und eines davon lautete Muschimaus. An Trucks hatte ich dabei nun wirklich nicht gedacht … Aber ich musste nun immerzu an Denise denken.
Auf die Chats folgte das erste Treffen und dann viele weitere. Meine anfängliche fixe Idee, dass ich in den letzten Monaten ja einfach noch ein bisschen Spaß haben könnte, ganz unverbindlich, da ich mich dann ohnehin aus dem Staub machen würde, erwies sich als totale Fehleinschätzung. Es hatte mich voll erwischt. Ich war verliebt. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Aber zum ersten Mal in ein Mädchen.
Es war aufregend. Der erste Kuss passierte im wenig romantischen Ambiente eines Fitnessstudios, in dem ich seit meinem 16. Geburtstag meinen Körper für meine geplante Footballkarriere stählte (den Spielplatz überließ ich nun wieder den spielenden Kindern). Auch Denise hatte begonnen, dort zu trainieren, anfangs immer in Begleitung ihrer Mutter, weil sie wusste, dass sie mir da über den Weg laufen würde.
Meine erste große und auch größte Liebe blieb weiterhin der Football, aber jede freie Minute, die nichts mit meinem Sport zu tun hatte, verbrachte ich nun mit Denise. Wir waren nun auch offiziell zusammen. In allen Schulpausen trafen wir uns, und statt am Nachmittag bei Cedric stundenlang Madden zu zocken, hockte ich nun stundenlang bei Denise in ihrem Zimmer. An einem dieser Schmetterlinge-im-Bauch-Nachmittage erregte ein dicker Stapel von DIN-A4-Blättern meine Aufmerksamkeit. Es war der ausgedruckte Wikipedia-Eintrag zu American Football. Ich fand es total süß und war schwer beeindruckt, dass sie alles wissen wollte über diesen komplizierten Sport, der mein Leben war und jeden meiner Tage bestimmte. Denise meinte es wirklich ernst. Und ich hatte plötzlich ein Problem. Es hätte alles so schön, so einfach, so unbeschwert sein können, wenn da nicht meine bevorstehende Amerika-Operation gewesen wäre.
Der Countdown lief, die Uhr tickte. Ich haderte und fragte mich, warum ich unbedingt noch eine Beziehung anfangen musste, wo ich doch wusste, dass es unweigerlich auf eine schmerzhafte Trennung hinauslaufen würde. Warum ich das alles nicht nur mir, sondern vor allem auch ihr antat. Die Antwort war einfach und kompliziert zugleich: Liebe.
Ich musste es ihr sagen. Für Denise war es ein Schock, dass ihr neuer Schwarm schon auf dem Weg ans andere Ende der Welt war. Sie war spürbar traurig, aber dennoch erstaunlich gefasst. Denise hatte ziemlich schnell begriffen, dass sie niemals zwischen mir und Football stehen könnte; das wollte sie auch gar nicht. Ihr war klar, dass Football meine erste große Liebe war, und sie meinte immer, dass sie das auf keinen Fall kaputtmachen oder mich vor die Wahl stellen wolle, denn sie muss geahnt haben, wie ich mich damals entschieden hätte. Denise sagte, ich solle meinen Traum leben, sie würde auf mich warten. Dafür liebte ich sie nur noch mehr.
Denise war hart im Nehmen. Das zeigte sich auch bei ihrer ersten Begegnung mit Cedric, dem ich meine Freundin unbedingt vorstellen wollte, damit sie für ihn nicht mehr nur das böse Mädchen war, mit dem ich plötzlich viel mehr Zeit verbrachte als mit ihm. Madden war out, aber Cedric immer noch mein bester Freund und Football-Gefährte, und es war mir sehr wichtig, dass er Denise kennenlernte. Die erste Begegnung fand in einem Bus statt, weil wir gemeinsam irgendetwas unternehmen wollten. Der Bus war voll, und wir mussten stehen. An einer Haltestelle stieg dann Cedric dazu. Ein bisschen Quatschen, einige Momente des peinlichen Schweigens, dann ging der Busfahrer plötzlich in die Eisen, und ich griff blitzschnell nach einem der Haltegriffe. Dabei rammte ich Denise meinen Ellenbogen mit voller Wucht ins Gesicht, mitten auf die Nase.
Ich war total geschockt, und auch Cedric starrte sie mit aufgerissenen Augen an, doch Denise blinzelte ein paarmal, während ihr die Tränen in die schönen Augen stiegen, und tat einfach so, als sei gar nichts passiert. Ich hatte ihr gerade die Nase gebrochen, und sie lächelte mich an. Sie wollte einfach nicht losheulen vor meinem besten Freund, der ja auch ein Footballer war, sondern cool und tough sein. Cedric hat dieses Erlebnis so sehr beeindruckt, dass er die Geschichte noch heute gerne zum Besten gibt, weil sie so verrückt ist und uns drei verbindet. Ich meine: Wo sonst lernt man unter Schmerzen neue Leute kennen und beginnt eine Dreiecks-Freundschaft – außer im Sadomaso-Keller eines Swingerclubs?
Die folgenden Monate gehören zu den intensivsten meines Lebens. Die erste richtige Liebesbeziehung, die vorerst letzte Saison mit den Adlern, die Vorbereitungen auf mein Abenteuer in Übersee. Ich befand mich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Abschied und Aufbruch, in dem Herz und auch Kopf überfordert waren.
Ich trainierte wie ein Besessener, um mich körperlich in Bestform zu bringen, und verbrachte viel Zeit im Fitnessstudio, wo ich regelmäßig zusammen mit Denise und auch Cedric, die sich zu meiner Freude bestens verstanden, schwitzte. Es war diese Fitnesskette, deren Namen an Fastfood erinnert. Auch Cedric hatte einige Zeit lang mit mir zusammen den Traum von einer Footballkarriere in den USA verfolgt, aber ihm fehlten einfach die körperlichen und athletischen Voraussetzungen, um das nächste Level zu erreichen. Auf meinem Weg war Cedric aber ein unverzichtbarer Trainingspartner, und wir haben uns gegenseitig unheimlich gepusht – bis ans Limit und nicht selten darüber hinaus. Wir waren zeitweise, bevor ich Denise kennenlernte, so irre, dass wir auch an Feiertagen trainierten, einmal sogar an Heiligabend, bis 22 Uhr. Wir waren die Letzten, hinter uns wurde abgeschlossen. Meine Kraft nahm zu, meine Muskeln wuchsen. Als 16-Jähriger machte ich Kniebeugen mit einer 200-Kilo-Hantel, was schon eine krasse Nummer war. Damals war ich stolz wie Oskar, heute steht fest: Ich war ein Idiot. Ich wusste es einfach nicht besser. Der Gewichte-Wahn, immer noch eine Scheibe Eisen mehr draufzupacken – schwerer, härter, geiler –, sollte sich später rächen.
In meiner zweiten Saison mit den Adlern, aus der mir am ehesten eine denkwürdige Defense-Schlacht gegen die Berlin Rebels mit dem Fußball-Endergebnis 0:3 in Erinnerung geblieben ist, lief es nicht ganz so rund, und wir konnten den Vorjahreserfolg nicht wiederholen. Aber individuell konnte ich mich und mein Spiel weiterentwickeln und auch eine Freundschaft vertiefen. Bei den beiden Auswärtsspielen seiner Hamburg Young Huskies in der Hauptstadt blieb Kasim über Nacht, und wir verbrachten die meiste Zeit damit, uns auszumalen, wie es wohl sein würde, in Amerika Football zu spielen, denn auch Kasim hatte sich auf meinen Tipp hin beim International Student Program beworben und war tatsächlich ebenfalls angenommen worden – eine ziemlich coole Story, die im Detail bis heute nur wenige Leute kennen. Mit ihm konnte ich den Weg weitergehen, auf dem mich Cedric lange begleitet hatte. Kasims alleinerziehende Mutter und meine Mutter haben in dieser Zeit häufig miteinander telefoniert, um sich auszutauschen, wenn mal wieder Fragen auftauchten rund um das Football-Förderprogramm ihrer Söhne. Und es gab jede Menge davon. Fragen. Und Telefonate.
In meiner Euphorie über die Aufnahme in das ISP-Förderprogramm hatte ich völlig außer Acht gelassen, dass ich zwar die erste und wichtigste Hürde genommen hatte, aber längst noch nicht die letzte. Die Sache lief folgendermaßen ab: Zunächst wurde mir eine Liste zugeschickt mit einer Auswahl an Privatschulen aus den New-England-Staaten, die bei dem Programm mitmachten und sich davon herausragende Talente aus Übersee für ihre Schulmannschaft versprachen. Kostenpunkt für die Internate: 45 000 bis 55 000 Dollar. Pro Schule. Pro Jahr. Pro Schüler! Die Schulen wiederum erhielten von ISP und damit indirekt von der NFL einen Zuschuss in Höhe von 15 000 Dollar, sodass sie die Vergabe ihres kostbaren Platzes „nur“ noch zwischen 30 000 und 40 000 Dollar kostete, was immer noch eine verdammte Stange Geld ist und für mich und meine Familie eine schwindelerregende Summe darstellte. Der erste Schritt war, mich für zwei der Internate zu entscheiden, dann Kontakt aufzunehmen und mich dort direkt für einen Platz zu bewerben.
Ich hatte also eine Liste mit zehn Schulen auf dem Tisch, die in Vermont, Maine, New Hampshire, Connecticut und Massachusetts lagen. Weder hatte ich diese Namen jemals zuvor gehört, noch wusste ich, wo sich diese Bundesstaaten überhaupt befanden. Ostküste war der einzige Hinweis. Ich musste erst mal auf der Karte nachschauen und fand immerhin New York City. Alles, was ich zu diesem Zeitpunkt über New York wusste, hatte ich in irgendwelchen Filmen gesehen und beschränkte sich auf die Freiheitsstatue, das Empire State Building und gelbe Taxis. Für Connecticut sprach, dass es New York am nächsten lag. Gegen Connecticut sprach, dass ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wie man es überhaupt ausspricht. Ich musste meine Kriterien für das Auswahlverfahren überdenken und begann zu recherchieren, wie gut die Footballteams der zur Auswahl stehenden Schulen in jüngster Zeit waren. Die beiden Internate, die am Ende übrigblieben, waren Salisbury School, Connecticut, und Worcester Academy, Massachusetts. Salisbury war mein Favorit, weil die Schulmannschaft gerade die New England Championships gewonnen hatte. Außerdem gefiel mir der Name des Teams: Crimson Knights. Die purpurroten Ritter.
Ich schickte meine Bewerbungen inklusive eines aktualisierten Highlight-Tapes ab und bekam prompt zwei Zusagen. Die Entscheidung fiel mir am Ende leicht, denn Salisbury hatte das bessere Footballprogramm, lag nur rund 150 Kilometer nördlich von New York City, und auch Kennäddikätt ging mir irgendwann deutlich leichter über die Lippen als Mässedingsbums. Also sagte ich per E-Mail zu und freute mich, als einen Tag später ein Christopher Adamson antwortete, zur damaligen Zeit der Headcoach der Salisbury Crimson Knights, später mein amerikanischer Vater und heute mehr als nur ein Freund. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Chris Adamson freute sich überschwänglich, dass meine Wahl auf Salisbury gefallen war, und teilte mir mit, dass nur noch ein paar Details geklärt werden müssten.
Details. Guter Joke. Ich mag seinen Humor, aber das war ein schlechter Witz. Mit den angeblichen Details fing die ganze Arbeit für mich erst richtig an – und die hatte leider rein gar nichts mehr mit Football zu tun. Ich musste gefühlt Hunderte Formulare ausfüllen, ein Schülervisum beantragen, mich um Versicherungen kümmern und, und, und. Der Papierkram war die Hölle und überforderte nicht nur mich, sondern auch meine Eltern. Ich brauchte Hilfe. Ich fand sie in Jörg. Mal wieder. Mein Coach kam sogar mehrmals zu uns nach Hause, um Mamotschka und Daddy-Jo mit einer Engelsgeduld zu erklären, wieso, weshalb, warum nun dies, das und jenes ausgefüllt oder beantragt und von ihnen unterschrieben werden musste. Darüber hinaus versuchte er, meinen Eltern die Sorgen zu nehmen. Jörg war jetzt nicht mehr nur mein Footballtrainer, er war auch unser Familien-Coach. Wenn ich an diese Stunden zurückdenke, in denen wir, wie schon erwähnt, in einer Art Huddle um den Tisch saßen und der Coach mit kühlem Kopf sagte, wo es langgeht, und unsere manchmal blank liegenden Nerven beruhigte, dann rührt mich vor allem seine Selbstlosigkeit. Jörg opferte damals viele Stunden seiner Freizeit, und er tat das alles nur für mich. Er selbst hatte nichts davon und spielte sich auch später nie groß als mein Entdecker und Förderer auf, ohne den ich es nicht geschafft hätte. Ich denke, Jörg liebte den Football so sehr, dass er es einfach nicht ertragen konnte, wenn Talent und Potenzial ungenutzt blieben, und ich bin sicher, dass mein späterer Erfolg für ihn Belohnung genug war. Was er für mich und meine Familie getan hat, bleibt unvergessen. More than a Coach.
Bei einer Sache konnte aber auch er mir nicht helfen. Ich musste für die Aufnahme an der Schule nicht nur eine Mathe-Prüfung bestehen, sondern eigentlich auch den sogenannten TOEFL-Test, den „Test of English as a Foreign Language“, ein standardisierter Sprachtest für Nicht-Muttersprachler, der in den USA die Voraussetzung für die Zulassung an einer privaten und akademisch anspruchsvollen High School wie Salisbury oder einer Universität ist. Um dieses bürokratische Gelaber etwas verständlicher zu machen und zugleich meine dramatische Lage zu schildern: Der Test wäre mein Untergang gewesen.
Englisch war trotz bestmöglicher Nachhilfe bei Rickys Mom meine große Achillesferse und Salisbury als Privatschule mit hohen Ansprüchen nicht dafür bekannt, Ausnahmen für außergewöhnliche Sporttalente zu machen – anders als viele der großen Universitäten mit renommierten Footballprogrammen, die manchmal sogar beide Augen und auch noch ein Hühnerauge zudrücken, wenn es darum geht, ein Football-Juwel mit Spatzenhirn ins College-Team zu locken. Mein großes Glück war, dass Chris Adamson in Sachen Football ähnlich dachte wie Jörg Hofmann und es ebenfalls nicht ertragen hätte, wenn diese ganze Sache jetzt an dem verdammten Test gescheitert wäre. Er hat mir später erzählt, dass er in Salisbury bei der Schulleitung für mich kämpfte und diese schließlich zu folgendem Kompromiss überredete: Ich würde in Amerika nicht wie geplant nach Beendigung der zehnten Klasse in Deutschland mit der elften Klasse weitermachen, sondern die zehnte wiederholen, um mich in den USA einzugewöhnen.
Der Papierkrieg war gewonnen. Die Schule erklärte sich bereit, die 40 000 Dollar pro Jahr in mich zu investieren, mir ein Bett und drei Mahlzeiten am Tag zur Verfügung zu stellen und alles an Wissen zu vermitteln, was ein Salisbury-Absolvent wissen musste. Ich war beinahe am Ziel. Jetzt musste ich nur noch die Kohle für den Flug, die Auslandskrankenversicherung, eine Schuluniform, ein paar Hemden, eine Krawatte und schicke Schuhe sowie ein kleines Startkapital zusammenkriegen. Das nächste Problem. Hatten wir natürlich nicht. Meine letzte Rettung war meine Oma. Sie nahm einen Kredit über 3000 Euro auf, für ihre Verhältnisse eine Riesensumme, und die Sache war endgültig geritzt. Ich weiß übrigens, dass die Mitarbeiterin in der Bank, die damals mit meiner Oma die Sache mit dem Kredit in die Wege geleitet hat, ein großer Footballfan ist und sonntags immer vor dem Fernseher sitzt, wenn NFL läuft …
Der Sommer kam schnell und ging noch schneller vorüber. Noch zu Beginn des Jahres hätte mich das gefreut, doch seit ich mit Denise zusammen war, konnten die Tage nicht lang genug sein. In meiner Brust schlugen zwei Herzen. Einerseits konnte ich es kaum erwarten, mich in mein großes Abenteuer zu stürzen, und fieberte meinem Abflug entgegen. Andererseits lief mir die Zeit mit Denise davon. Sie wurde immer weniger und kostbarer. Der Gedanke an den bevorstehenden Abschied tat verdammt weh, aber ich habe damals keine Sekunde an meinem Vorhaben gezweifelt oder mich gefragt, ob es die richtige Entscheidung sei. Ich wollte abhauen, wollte meine Chance nutzen, ein Footballprofi werden und mir ein besseres Leben aufbauen.
Es ist merkwürdig. Obwohl die letzten Tage vor meiner Abreise und auch der Tag selbst ein emotionaler Ausnahmezustand zwischen Euphorie und Kummer gewesen sein müssen, habe ich so gut wie keine Erinnerungen daran. Ich habe es wohl verdrängt, wie man das mit traumatischen Erlebnissen halt macht. Nur so kann ich es mir erklären, dass ich zwar noch genau vor Augen habe, wie Denise mich mit Tränen in den Augen tapfer anlächelte, nachdem ich ihr im Bus den Ellenbogen gegen die Nase gerammt hatte, aber keinerlei Erinnerung daran, wie sie mich heulend am Flughafen verabschiedete oder wie meine Mutter Tränen vergoss, weil es ihr so schwerfiel, einen ihrer Söhne kurz vor seinem 17. Geburtstag los- und in die große weite Welt ziehen zu lassen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, wer damals alles dabei war in Tegel. Und auch von meinem Flug über den Atlantik, dem ersten Langstreckenflug meines Lebens mit Board-Entertainment und freier Getränkeauswahl, ist kein einziger Erinnerungsfetzen übrig. Ich weiß nur, dass ich irgendwann eingeschlafen sein muss. Meine Erinnerung setzt erst mit dem Landeanflug auf den Newark Liberty International Airport wieder ein.
Als ich aufwachte, neigte sich das Flugzeug im Landeanflug zur Seite, und ich blickte aus dem Fenster direkt auf die Riesen von Manhattan aus Stahl, Beton und Glas. Schlagartig war alle Euphorie verflogen, mein Herz raste, rutschte mir dann in die Hose, und Panik ergriff mich. Die Gedanken schossen wie Blitze durch meinen Kopf: Du kennst hier niemanden. Du kannst die Sprache nicht richtig. Deine Familie, deine Freundin, deine Freunde sind 6500 Kilometer entfernt.
Die Faust der Realität schlug mir mit voller Wucht in die Fresse, und in meinem Kopf schrie eine Stimme, die meine eigene war: „Shit, Alter! Du bist hier ganz allein in Amerika! Was hast du dir nur dabei gedacht?!“
Wie betäubt verließ ich das Flugzeug, fühlte mich wie ausgespuckt, schwamm willenlos im Strom der Menschenmassen mit und reihte mich in die nicht enden wollende Schlange vor der Einreisekontrolle ein. Gehen, stehen, gehen, stehen, gehen, stehen, gehen, stehen. Shit. Shit. Shit.
Ich hatte amerikanischen Boden unter den Füßen – und keine Ahnung, wie es jetzt weiterging.