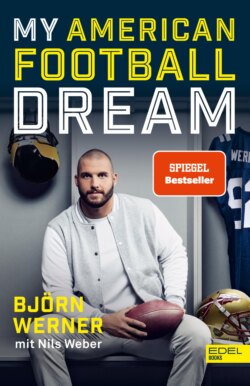Читать книгу My American Football Dream - Björn Werner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
City Boy Kindheit zwischen Kiez und Bolzplatz
ОглавлениеMeine Football-Karriere begann auf einem Kinderspielplatz. Das klingt romantisch, so wie man es aus vielen Geschichten von den Anfängen bemerkenswerter Sportlerkarrieren kennt. In meinem Fall war allerdings gar kein Football im Spiel. Es gab überhaupt keinen Ball, sondern eine Rutsche, und oben auf dem Turm saß ein für sein Alter sehr großer, sehr kräftig gebauter und auch etwas moppeliger zehnjähriger Junge auf der Suche nach der nächsten kleinen Dosis Adrenalin.
Von American Football hatte ich noch nie etwas gehört, und wenn mich damals jemand gefragt hätte, was NFL bedeutet, dann hätte ich vermutlich auf einen Fernsehsender getippt. ARD, ZDF, RTL, NFL. Ich war jedoch schon in einem Alter, in dem Rutschen nur noch Spaß macht, wenn man die Rinne besonders schnell oder waghalsig runtersaust. Volle Pulle oder gar nicht. Werner-Style. Vermutlich musste mal wieder eine neue persönliche Kinderspielplatz-Olympia-Bestmarke her, denn ich war schon immer ein absoluter Wettkampftyp. Also holte ich ordentlich Schwung, schnellte mit dem Oberkörper nach vorne, stieß mich mit den Armen ab und jagte hinab. Als ich nach rekordverdächtiger Fahrt unten aufkam, gab es ein merkwürdiges Geräusch, das nicht so klang, wie es normalerweise klingt, wenn ein durchgelatschter Turnschuh auf sandigem Untergrund bremst. Vermutlich hatte der Turnschuh seine beste Zeit längst hinter sich und inzwischen weniger Profil und mehr Öffnungen als vom Hersteller vorgesehen. Ich spürte einen stechenden Schmerz im Knöchel meines linken Fußes, der bei den Gegnern meines Fußballvereins Berliner Athletik-Klub 07, kurz BAK, gefürchtet war, weil dieser Fuß Tore wie am Fließband schoss. Mein erster Gedanke: Shit. Die anschließende Vor-Ort-Diagnose war auch ohne medizinische Kenntnisse meinerseits absolut präzise, wenn auch anatomisch etwas unscharf: Fuß im Arsch.
Ich schluckte das in mir aufkeimende erbärmliche Gejammer und Gewinsel tapfer runter, biss auf die Zähne, blinzelte die Flüssigkeit weg, die mir in die Augen trat, und humpelte nach Hause. Tränen konnten das ja wohl nicht sein. Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was mir unterwegs durch den Kopf ging, mal abgesehen von „Aua“. Ich bin mir aber zu hundert Prozent sicher, dass mir nicht ein einziges Mal in den Sinn kam, dass der BAK07 möglicherweise in Zukunft auf meine Tore würde verzichten müssen. Oder dass sich der unter einem chronischen Energieüberschuss und mangelhafter Risikoanalyse leidende Riesenknabe einen neuen Allerlieblingssport aussuchen würde, in dem er es über die Grenzen seines Kiezes hinaus vielleicht zu etwas bringen könnte.
Mein Kiez war der Sprengelkiez, im Wedding, Berlin. Der Wedding war damals das, was man als Problem-Bezirk bezeichnete, zumindest Teile davon. Manche Gegenden hatten ein Schmuddel-Image oder waren regelrechte kriminelle Hotspots und Treffpunkte der Trinker, Junkies und Dealer. Touristen verirrten sich nur in den Wedding, wenn sie zu blöd waren, ihren faltbaren Stadtplan richtig herum zu halten. Heute gilt der Stadtteil mit seinem rauen Charme als hippes Szeneviertel und wird sogar international abgefeiert. Für jemanden, der wie ich in den Neunzigern dort aufgewachsen ist, als es die Bezeichnung Szene-Bezirk noch gar nicht gab, ist das irgendwie komisch.
In diese ungekünstelte, hier und da abgefuckte, für mich aber schmutzig-schöne Welt wurde ich hineingeboren, im August 1990, einen Monat vor der Deutschen Einheit, und ich verbrachte dort die ersten Jahre meines Lebens. Mit meiner Mutter Martina, meinem Vater Andreas und meinen Brüdern Marcel und Pascal wohnte ich in einer kleinen Wohnung in der Fehmarner Straße, unweit der U-Bahn-Station Amrumer Straße, mittendrin im multikulturellen Wedding. Die Fehmarner Straße ist eine ruhige Seitenstraße, in der damals eigentlich jeder jeden kannte. Im Norden grenzte unsere Straße an den riesigen Komplex des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, das zur Charité gehört. Auf dem Gelände befindet sich übrigens auch der Hauptsitz des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI. Diese Abkürzung kennt heute jeder, mir sagte das damals ungefähr so viel wie NFL. An ihrem südlichen Ende stößt die Fehmarner Straße auf das Nordufer des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals. Von dort hat man einen schönen Blick über das Wasser nach Westen und nach Osten und einen nicht ganz so schönen direkten Blick nach Süden auf das gegenüberliegende Ufer mit dem Kraftwerk Moabit. Wenn ich also mal Bock auf Panorama hatte – so sah es aus.
Wir wohnten in der Nummer 23, erster Stock, drei Zimmer, kleiner Balkon. Die Wohnung an sich war nichts Besonderes, aber sie hatte für unsere Familie eine große emotionale Bedeutung. Sie war ein Werner-Nest. Schon meine Oma hatte dort gewohnt und meinen Vater und seine zwei Schwestern, also meine Tanten, großgezogen. Meine Mutter ist auch im Wedding aufgewachsen, nur ein paar Straßen weiter. Meine Eltern haben irgendwann die Bude meiner Oma übernommen. Meine Brüder und ich waren also schon die dritte Generation innerhalb dieser Wände.
Das Kinderzimmer musste ich mir mit meinem älteren Bruder teilen. Mein Vater hatte eine Art Zwischenetage in den Raum gebaut, wie ein übergroßes Hochbett mit einer Treppe, sodass jeder von uns dann doch einen eigenen Bereich hatte, was ganz cool war. Weniger cool fand ich, dass dieses zweite Level das Reich von Marcel war, der sich als größerer Bruder natürlich den Platz an der Glühbirnen-Sonne gesichert hatte. Zeit für ein peinliches Geständnis: Meinen unteren Bereich verschönerte ich, als ich alt genug war, an so etwas Gefallen zu finden, aber noch nicht alt genug für guten Geschmack, mit Postern der Boygroups Backstreet Boys und NSYNC. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, dass bei NSYNC Justin Timberlake mit am Start war, der ja nun wirklich eine große Nummer geworden ist, womit wir einen eleganten Schlenker zum Football machen können: Timberlake ist schon zweimal in der Halftime-Show des Super Bowls aufgetreten, dem Mount-Everest-Moment für Musikstars, und sorgte 2004 beim Duett mit Janet Jackson bekanntlich für den größten Skandal: „Nipplegate“. Auch mein absolutes Lieblingsposter in späteren Jahren hatte Football-Bezug, zumindest aus heutiger Sicht. J.Lo! Das fiel mir wieder ein, als ich Jennifer Lopez bei ihrem Aufritt mit Shakira in der Halbzeit von Super Bowl LIV im Jahr 2020 in Miami live im Hard Rock Stadium miterlebte. Sie sah erstaunlicherweise auch ein Vierteljahrhundert später fast genauso aus wie auf dem Poster an meiner Wand, das ich als Heranwachsender so oft angestarrt hatte. Ewige Jugend mit über 50. Respekt. Sie könnte meine Mutter sein.
J.Lo war mein erster Teenage Crush.
Ich war Björn from the Block. Nicht aus einer richtig üblen Gegend, wie so viele Spieler in der NFL, aber aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter arbeitete als Putzfrau in einer Kita, was sie bis heute mit Überzeugung macht und wofür ich sie sehr bewundere, und mein Papa schuftete damals auf dem Bau. Wir sind eine „Blue-Collar-Family“, wie man in Amerika sagt. „Blue Collar“ heißt „blauer Kragen“, was für die traditionellen blauen Arbeitsoveralls steht, die man in Deutschland als Blaumänner kennt. Blue-Collar-Jobs sind mit körperlicher Arbeit und meistens niedrigem Lohn verbunden, während White-Collar-Jobs die Bezeichnung für Berufe ist, bei denen man ein weißes Hemd trägt, also Büro- oder Dienstleistungsjobs.
Im US-Sport ist immer wieder von Blue-Collar-Mentalität die Rede, wenn es um harte körperliche Arbeit von Athleten, ihre Einstellung zu Training und Wettkampf und eine gewisse Bodenständigkeit geht. Troy Polamalu, der legendäre Safety der Pittsburgh Steelers, der zweimal den Super Bowl gewann und Defensive Player of the Year war (nicht zu vergessen: All-Time Defensive Player of the Hair!), hat American Football mal als „real blue-collar sport“ bezeichnet. Ich erwähne das hier nicht nur, weil der frischgebackene Hall-of-Famer eine absolute Granate auf dem Gridiron war und zu den Spielern gehörte, denen ich nacheiferte. Was mich und meine Karriere betrifft, kann ich die Worte Polamalus absolut unterschreiben. Ich bin ein Arbeiterkind, und alles, was ich im Football erreicht habe, basiert auf harter Arbeit.
Wir Werners sind traditionelles Arbeitermilieu. Mein Vater war lange Zeit der Meinung, dass ein ordentlicher Beruf mit den Händen ausgeführt wird und so etwas wie Abitur eine Extrawurst und ein Studium eigentlich Zeitverschwendung ist – es sei denn, man hatte das Ziel, im späteren Leben seinen Fahrgästen im Taxi etwas über Goethe oder den Dreißigjährigen Krieg zu erzählen. Wegen dieser Sichtweise sollte ich mit meinem Alten Herrn an einem ganz entscheidenden Punkt meines Lebens noch heftig aneinandergeraten, und wenn wir Werner-Männer streiten, dann gleicht das einem Footballspiel mit Worten. Wir vier sind totale Dickschädel, echte Rammböcke, und sosehr wir uns lieben, so sehr lieben wir es auch, uns zu dissen und richtig zu fetzen, und dann will keiner klein beigeben, ganz egal, ob er recht hat oder nicht. Darum geht es auch gar nicht. Ich denke, es geht in erster Linie darum, sich zu behaupten. Das mag jetzt machomäßig klingen, aber es ist vielleicht einfach auch ein bisschen Wedding-Mentalität, sich nicht die hart verdiente Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Jeder Euro wurde bei uns zu Hause zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde, denn er war eben hart erarbeitet. Es ist nicht so, dass wir arm waren, aber das Leben meiner Eltern drehte sich schon in erster Linie darum, zu arbeiten, Geld zu verdienen, ein Dach über dem Kopf zu haben und jeden Abend eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen, damit alle satt werden und die Kinder groß und dabei möglichst glücklich. Old School. Wenn meinen Eltern damals jemand was von Work-Life-Balance oder Quality Time erzählt hätte, dann wären die vor Lachen vom Stuhl gefallen. Oder sie hätten die betreffende Person den kurzen Fußweg aus der Fehmarner Straße zurückbegleitet, in die Psychiatrie der Charité.
Als Kind hatte ich nie das Gefühl, dass es mir an etwas fehlte, schon gar nicht an Liebe und Unterstützung, auch wenn ich natürlich merkte, dass wir weniger hatten als manche anderen. Es gab nicht massenweise Spielsachen. Was wir besaßen, war kostbar und wurde gehütet wie ein Schatz. Mein größtes und schönstes Geburtstagsgeschenk als Kind war ein BMX-Rad, und mir war damals klar, dass meine Eltern dafür ordentlich gespart haben mussten. Wir besaßen auch kein Auto, nur einmal für eine kurze Zeit, aber dann haben wir es wieder verkaufen müssen, weil es einfach zu teuer war. In den Urlaub sind wir immer mit der Bahn gefahren, und so ging es meistens an die Ostsee, Warnemünde, Usedom oder auf irgendeinen Bauernhof. Fehmarn war für uns schon eine Fernreise. Aus der Fehmarner Straße nach Fehmarn – das war für mich als Kind nur logisch. An Flugreisen war gar nicht zu denken, aber das hat mich nie gestört, denn im Gegensatz zu vielen anderen Familien aus unserer Gegend konnten wir ja immerhin verreisen. Für mich war das alles großartig, aber im Vergleich zu anderen Kindern, vor allem heutzutage, war meine Welt lange Zeit ziemlich klein. Die Ferne – das war für mich der Blick vom Strand über das offene Meer bis zum Horizont oder über die Felder und Wiesen. Das war mir genug. Es war wunderbar.
Ärgerlich nur, dass der Urlaub im Nachhinein immer teurer als geplant und kalkuliert war. Wenn wir nach zwei Wochen braungebrannt und glücklich wieder in Richtung Berlin abreisten, waren wir zwar gut erholt, aber es war auch immer irgendetwas kaputt. Ein Fahrrad, ein Kettcar, die Schaukel, eine Schaufel oder auch mal die Kutsche des Bauernhofs. Das lag an der Art und Weise, wie meine Brüder und ich „spielten“. Wir waren eben sehr groß und stämmig und hatten die Angewohnheit, auf der Suche nach Action mit maximaler Kraft zu Werke zu gehen, welcher das Material häufig einfach nicht gewachsen war. Ich muss an dieser Stelle aber ehrlicherweise das Material in Schutz nehmen und zugeben, dass wir es auch nicht immer sachgemäß benutzt haben. Die unvermeidliche Frage „Wer war das?“ wurde in meiner Erinnerung nie gestellt, denn die Antwort lag auf der Hand: Die Werners waren es. Und so ging die Verabschiedung von unseren Gastgebern nach zwei Wochen Urlaub oft einher mit einer Nachzahlung für entstandene Schäden, und es würde mich nicht wundern, wenn so mancher Vermieter unser euphorisches Versprechen, nächsten Sommer auf jeden Fall wiederzukommen, als Drohung aufgefasst hat.
Meine Mutter wusste bei der Abreise immer schon, dass dieses Geld zu Hause an anderer Stelle fehlen würde. Sie war die Finanzministerin der Familie. Ich möchte behaupten, dass ich sehr gut mit Geld umgehen kann, was mir während meiner Football-Karriere und auch danach immens geholfen hat, und das verdanke ich ihr. Credit, Mama! Schon in jungen Jahren hat sie mich oder einen meiner Brüder zum Einkaufen geschickt, weil sie oft kaputt war, wenn sie von der Arbeit kam. Das war jetzt nicht gerade unsere Lieblingsbeschäftigung, und ich weiß noch genau, wie sie dann immer gesagt hat: „Wofür habe ich denn drei Söhne?“ Ich wusste damals noch nicht, was eine rhetorische Frage ist, aber mir war klar, dass das bedeutete: Einer von uns dreien muss jetzt zum Laden mit den vier großen Buchstaben und den gestreiften Plastiktüten gehen und Beute machen. Wenn ich also mal wieder an der Reihe war und meine Mutter mir den Einkaufszettel und das Geld in die Hand drückte, dann wusste sie bereits, dass ich mit 10,33 Euro oder 27,74 Euro zurückkommen würde, und das sagte sie mir manchmal sogar beim Verlassen der Wohnung. Nicht etwa, weil sie mir misstraute und befürchtete, dass ich mir heimlich Wechselgeld abzwacken und auf dem Rückweg ein Eis kaufen würde, sondern einfach, weil sie alle Preise auswendig kannte und im Kopf ausgerechnet hatte, wie viel der Einkauf kosten würde, auf den Cent genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich dabei auch nur ein einziges Mal verrechnet hätte. Das war echt verblüffend und beeindruckt mich noch heute. So hatte meine Mutter immer einen genauen Überblick über unsere Finanzen. Sie hielt das Geld zusammen und damit auch den Laden. Jeder Cent zählte.
Das machte sich auch beim Einkauf bemerkbar. Ich musste mich oft bücken, denn die preiswerten Produkte stehen bekanntlich immer ganz unten im Regal. Ich erinnere mich, dass es bei uns nie die Markenprodukte gab, sondern immer die Billigvariante vom Discounter. Meine Nutella hieß Nusskati, auf der Packung mit den Frühstücks-Flakes war auch keine grinsende Raubkatze drauf, die den Tiger in mir wecken wollte, und wenn es bei uns zur Feier des Tages mal Fanta gab, dann stand auf der Flasche „River Orange“. Süßigkeiten gab es bei uns im Alltag nicht. Die gab es bei meinem Kumpel Kevin, der wohnte an meinem Schulweg. Ich ging auf die Gebrüder-Grimm-Grundschule und nach dem Unterricht oft mit zu ihm nach Hause. Bei Kevin hießen die Schokoriegel Twix, Snickers, Bounty oder Lion, und sie wohnten mit ihren Kumpels von Haribo und Katjes in einem großen Schrank, dicht gedrängt. Fanta hieß bei Kevin Fanta. Neidisch war ich nie. Aber immer hungrig.
Was bei uns zu Hause auf den Tisch kam, musste nicht nur günstig, sondern auch schnell zuzubereiten sein, nahrhaft und viel. Sehr viel. Es gab selten etwas Besonderes, aber immer riesige Portionen. „Ich muss ja meine vier großen Jungs irgendwie satt kriegen“, diesen Satz habe ich von meiner Mutter oft gehört – und sie schloss meinen Vater damit ein. Große Jungs waren wir im Grunde genommen schon, als wir noch klein waren, denn wir waren immer eine Nummer größer als gleichaltrige Kinder. Das haben wir von unserem Vater geerbt, der 1,94 Meter misst. Mein jüngerer Bruder Pascal, fünf Jahre nach mir geboren und immer das Nesthäkchen, ist mit 1,96 Metern mittlerweile der Größte in der Familie und Marcel, der älteste Bruder, mit 1,87 Metern der Kleinste, was schon kurios ist. „Der Kleinste“ hört er übrigens gar nicht gerne. Ich bin mit meinen 1,92 Metern also das Mittelmaß.
Gemeinsame Mahlzeiten waren bei uns eine Mischung aus Raubtierfütterung im Zoo und sportlichem Wettbewerb. Am Tisch herrschte immer ein Kampf um die üppigsten Portionen und die größten und besten Stücke. Mit einer Ausnahme. Ich bekomme dieses Wort kaum über die Lippen, denn schon beim Gedanken daran schüttelt es mich, und meine Zehennägel stellen sich auf: R…o…sen…kohl. Ich HASSE Rosenkohl! Das Problem war, dass meine Eltern Rosenkohl liebten. Der Deal war immer: Kam das Zeug mal wieder auf den Tisch, mussten ich und meine Brüder wenigstens eines der grünen Bällchen essen. Ist ja sooo gesund. Diskussionen waren zwecklos, große Dramen garantiert. Schon beim Geruch wurde mir kotzübel. In dieser misslichen Lage gab es nur einen Ausweg: die Flucht nach vorn. Meine Erfolgstaktik, die ich jedem nur empfehlen kann: Augen zu, Mund auf, Nase mit Daumen und Zeigefinger zuhalten, die giftgrüne Kugel rein, wie verrückt kauen, runterschlucken, mit Wasser nachspülen, nach Luft schnappen. Überlebt. Jede Kugel, die dich nicht tötet, macht dich nur härter.
Das Tempo am Tisch war immer hoch, nicht nur unter akuter Lebensgefahr. Sosehr sich meine Mutter bei der Zubereitung der Mahlzeiten auch beeilte, die Teller waren noch schneller leer. Selbst wenn sie die Fünf-Minuten-Terrine auf den Tisch gestellt hätte, wäre die nach zwei Minuten in unseren Mägen verschwunden. Ganz egal, was serviert wurde: Wir machten es zu Fast Food. Das ist übrigens auch heute noch so, bei Familientreffen zu Hause oder im Restaurant. Da wird der Tisch zur Red Zone, das Testosteronlevel ist hoch, und jede Speise, die neu hingestellt wird, ist wie ein auf dem Grün liegender Football nach einem Fumble. Alle stürzen sich drauf. Manchmal auch mit Gebrüll. Wir Werners sind immer sehr laut am Tisch. Lustig. Finden wir Brüder. Peinlich. Findet meine Frau Denise. Manchmal jedenfalls. Es grenzt fast an ein Wunder, dass wir diese Art der großfamiliären Nahrungsaufnahme bislang ohne schlimmere Verletzungen überstanden haben, obwohl wir alle mit Messer und Gabel ausgerüstet sind. In diesem Zusammenhang von Besteck zu reden, ist eigentlich eine Verharmlosung von Waffen.
Ich weiß nicht, was zuerst da war in meinem Leben: der große Hunger oder mein unbändiger Bewegungsdrang, für den ich täglich große Mengen Treibstoff in Form von Kalorien benötigte. Beides ist jedenfalls miteinander verbunden, und aus dem großen Björn wäre wahrscheinlich auch schnell ein sehr runder Björn geworden, wenn ich nicht schon früh begonnen hätte, Sport zu machen. Wie eigentlich jeder Junge spielte ich zunächst Fußball. Auch das lag in der Familie. Ich konnte gar nicht anders. Wir Werners sind fußballverrückt. Meine Brüder und mein Vater sind blau-weiß, Fans von Hertha BSC. Mein Vater hat früher selbst Fußball und Handball gespielt, als Torwart, und auch Marcel stand schon früh zwischen den Pfosten, beim Berliner Athletik-Klub 07, womit dann auch besiegelt war, dass mein Verein nur BAK heißen konnte, schließlich wird man als kleiner Bruder immer mitgeschleppt. Mit dem ersten Fußballverein ist es wie mit der Familie: kann man sich nicht aussuchen. In beiden Fällen hatte ich Glück.
Anders als mein Papa und mein großer Bruder hatte ich keinen Ehrgeiz, mir im Tor die Beine in den Bauch zu stehen und zu warten, dass etwas passiert (nichts für ungut, liebe Torhüter. Dissen ist bei uns Familiensport). Ich wollte im Feld spielen, wollte rennen, dribbeln, Zweikämpfe bestreiten und Tore schießen. Wie schon erwähnt, war ich Linksfuß und hatte schon als Siebenjähriger einen amtlichen Schuss, was natürlich auch an meiner Größe und Masse lag. Wenn wir mit der F-Jugend oder später in der E-Jugend gegen andere Mannschaften spielten, dann kam es nicht selten vor, dass ich doppelt so groß war wie einige meiner Gegenspieler – und auch doppelt so breit. Man könnte meinen, dass mich das für die Rolle eines gefürchteten Abwehrspielers prädestinierte, aber ich war kein tumbes Riesenbaby, sondern athletisch, konnte mich trotz meiner Größe und Masse gut bewegen und war erstaunlich schnell. Und ich konnte auch mit der Pille umgehen. Ich schoss viele Tore, war immer Torschützenkönig meiner Mannschaften. Für den Gegner war allein das natürlich schon eine ungute Kombination. Zu allem Überfluss war ich nicht der klassische Schönspieler, der sich auf Tricks und Tore beschränkte. Ich liebte Zweikämpfe.
Tackling lag mir irgendwie im Blut. Die Duelle wurden aus genannten Gründen selten auf Augenhöhe geführt. Ich war im Eins-gegen-Eins auch nicht gerade zimperlich und fand es geil, den ganzen Körper einzusetzen – und davon hatte ich ja reichlich. Dann gab es immer gleich Geschrei an der Seitenlinie, vom gegnerischen Trainer oder von besorgten Eltern. Schnell wich die Sorge um die Unversehrtheit des eigenen Nachwuchses der Wut auf den angeblichen Übeltäter. Wenn ich also mal wieder fünf bis zehn Tore schoss oder ein feingliedriger Abwehrspieler, den ich für meinen Geschmack nur leicht touchiert hatte, an mir abprallte wie in einem Videogame – so habe ich das alles jedenfalls in meinem Gehirn abgespeichert –, dann wurde lautstark behauptet, ich sei ein D-Jugendspieler und mein Spielerpass gefälscht. BAK-Betrüger, Wettbewerbsverzerrung und so weiter, das ganze Programm. Einmal hat einer reingebrüllt: „Was ist denn das für ein Anabolika-Kind!?“ Mein Vater, der mich damals zu jedem Spiel begleitete, war nicht geschockt oder erzürnt, wie man jetzt denken könnte. Der hat sich einfach schlappgelacht und sich einen Kullerkeks gefreut. Er erzählt die Geschichte noch heute gerne. Sein Junge, das Anabolika-Kind! Ihm war klar, dass sein Sohn beleidigt wurde, weil der so gut war. Das machte ihn stolz. Man soll sich ja nicht selbst loben, aber in Zeiten von Fake News ist es wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben: Ich war wirklich gut. Ich hatte Talent. Aber das behauptet ja jeder, der in der Jugend mal gekickt hat und als Erwachsener damit prahlt, dass er das Zeug zum Nationalspieler gehabt hätte, wenn … ja, wenn.
Sport wurde schnell mein Lebensmittelpunkt. Ich liebte es, mich auszutoben, auszupowern, mit anderen zu messen. Ich bin ein absoluter Wettkampftyp. Das hat natürlich auch mit der Konkurrenzsituation im eigenen Haus zu tun. Marcel war als größerer Bruder immer auch ein Konkurrent, dem ich zunächst nacheiferte, den ich aber dann natürlich auch überflügeln wollte. Beim Fußball, beim Wettlauf, beim Weitsprung in irgendeine Sandkiste, beim Wer-trifft-mit-der-Papierkugel-den-Mülleimer oder bei unseren legendären Wrestling-Matches, wenn wir als The Rock, Undertaker, Triple H und wie sie alle hießen unsere Kräfte maßen. Dieser brüderliche Wettbewerb hat mich definitiv geprägt.
Competition, Baby! Egal, ob auf dem Fußballplatz, beim Federball in irgendeinem Weddinger Innenhof oder beim Brennball in der Schule – ich wollte immer und überall der Beste sein. Weil mein Ehrgeiz grenzenlos war und Übung bekanntlich den Meister macht, gelang mir das auch ganz gut. Wenn auf dem Bolzplatz oder im Sportunterricht Mannschaften zusammengestellt wurden – jeder kennt das Prozedere –, dann wurde ich immer als einer der Ersten gewählt. Es machte mich stolz, dass meine Fähigkeiten von meinen Freunden, den Kindern in der Nachbarschaft und den Klassenkameraden geschätzt wurden. Ich war aber nie ein Angeber. Es war Bestätigung. Es fühlte sich einfach gut an. Und es tat mir auch gut.
Beim Sport habe ich mir das Selbstvertrauen geholt, das mir in frühen Kindertagen gefehlt hatte. Ich war eigentlich ein ruhiger, ein stiller Junge, zumindest außerhalb unserer Wohnung. Das glaubt mir heute kein Mensch! Denn wenn ich eines genauso gut kann wie schnell und viel essen, dann ist es schnell und viel quatschen. War nicht immer so. Tatsache. Womöglich lag es daran, dass ich als kleiner Junge an Allergien und eine Zeitlang auch an Neurodermitis litt. Meine Mutter war mit mir oft beim Arzt. Auch wenn man in dem Alter noch nicht richtig versteht, was los ist, so spürt man doch, dass irgendetwas mit einem nicht stimmt, und wenn andere Kinder einen dann auch noch komisch angucken, dann ist es eine natürliche Reaktion, sich zurückzuziehen und alles dafür zu tun, nicht im Mittelpunkt zu stehen. So erkläre ich mir jedenfalls im Rückblick, dass ich anfangs so extrovertiert und redselig war wie eine der Laternen in unserer Straße. Ein Stubenhocker war ich dennoch nie, sondern ein Draußenkind, aber erst der Sport hat dafür gesorgt, dass der kleine große Björn so richtig aus sich herauskam.
Wenn ich nicht gerade auf dem Fußballplatz oder in einem Kicker-Käfig bolzte, trieb ich mich irgendwo in meinem Kiez herum. Für Großstadt-Kids sind die Feldwege, Wiesen, Hügel und Bäume eben aus Teer, Pflastersteinen, Beton und Stahl. Im Schlepptau meines Bruders und seiner Kumpels zog ich nach Schulschluss durch die Straßen. Meine Eltern waren meistens noch bei der Arbeit. Wir hingen viel an der U-Bahn-Station Amrumer Straße ab, am Leopoldplatz und der dortigen U-Bahn-Station. Ich erwähnte ja schon, dass es nicht gerade die beste Gegend war. Dort tummelten sich komische Gestalten, und in der Luft hing der Hauch von Rauch, Alkohol, Urin und Gefahr, was natürlich auch einen gewissen Reiz auf einen Heranwachsenden ausübte. Wir sind Treppengeländer heruntergerutscht oder Rolltreppen in entgegengesetzter Fahrtrichtung hochgesprintet, was man halt so macht. Jede Menge Quatsch. Manchmal gingen wir in ein nahegelegenes Kaufhaus. In der Sportabteilung wurden Bälle ausprobiert oder in der Etage für Elektronik die neueste Playstation. So ein gewissenhafter Konsolen-Test konnte schon mal zwei Stunden dauern – ein Kauf folgte natürlich nie, auch wenn das Produkt bei „Stiftung Wernertest“ immer Bestnoten bekam. Fiel uns mal nichts Besseres ein, stiegen wir in die U-Bahn und fuhren ein paar Stationen, einfach so, ohne Ziel. Die Lage checken. In unserem Revier, unserem Kiez. Ich war ein richtiger Berliner City Boy.
Irgendwann kippte es. Aus Quatsch wurde Blödsinn und aus dem Blödsinn Kacke. Ich weiß nicht mehr, wann genau das war, aber ich muss zehn gewesen sein und mein großer Bruder dreizehn, also im ersten Quarter der Pubertät, was die ganze Sache nicht besser machte. Marcel hing mit ein paar falschen Freunden ab und traf falsche Entscheidungen, und auch mein Vater hatte irgendeinen Stress mit Leuten, die er schon ewig kannte. Hinzu kam, dass zu dieser Zeit mein jüngerer Bruder Pascal mit seinen fünf Jahren und den dazugehörigen Wernermaßen dem elterlichen Bett und Schlafzimmer entwuchs, und so beschlossen Mama und Papa, zum Wohl der Familie den Wedding zu verlassen, ihren Kiez, das Werner-Nest, meine Wiege. Dass das im Sinne der Familie war, dass meine Eltern etwas Besseres für uns wollten, ein besseres Umfeld, eine bessere Schule, das wollte damals natürlich überhaupt nicht in meinen Dickschädel.
Die Nachricht warf mich ganz schön aus der Bahn, und es passte irgendwie, dass in dieser Gemengelage, in der ich den Boden unter den Füßen verlor, die Sache mit der Rutsche passierte.
Mein Fuß war kaputt. Wie schon erwähnt, der linke. Ich weiß nicht mehr genau, ob nun etwas gebrochen war oder es ein paar Bänder zerfetzt hatte, aber das ist auch nicht wichtig, denn entscheidend war für mich, dass die Sache etwas dauern würde, und die Konsequenz daraus tat doppelt weh: Fußballpause. Bitter für mich, schlecht für den BAK07, aber vermutlich eine frohe Botschaft für alle anderen Mannschaften in unserer Staffel: Das Anabolika-Kind war außer Gefecht. Bis auf weiteres. Als Fußballer für immer.
Mein Comeback auf dem Platz sollte ich nämlich nicht, wie von meiner Familie und auch mir selbst erwartet, mit der Pille am Fuß geben, sondern mit dem Ball in der Hand. Einem Ball, wie ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte.