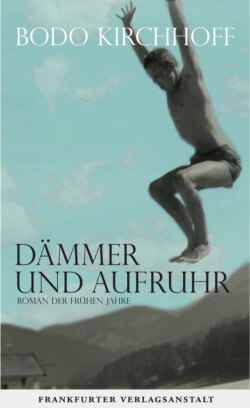Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
Die elterliche Abwesenheit war eine nachgeholte Hochzeitsreise auf einem Frachter, für den kleinen Sohn wie eine Referenz an all seine gezeichneten und im Papierkorb untergegangenen Schiffsquerschnitte; unvergesslich daher der Name des Frachters, MS Pickhuben, und die beiden einzigen Passagiere an Bord, ein immer wieder erwähnter Umstand, fuhren auf einer Route entlang Portugal bis nach Marokko und zurück. Eine Abwesenheit von acht Wochen, in denen zahllose Zeichnungen des Frachters mit der geräumigen Elternkabine entstehen, aber auch ihren Plätzen an Deck mit zwei Liegestühlen bei immer gutem Wetter im März und April. Auf der Rückreise ist es bald Mai, die Sonne brennt schon, und der männliche Passagier kommt als dunkelbrauner Fremder mit rotem Fes auf dem Kopf nach Hause: Das erste unverrückbare Bild von meinem Vater ist das eines dunkelhäutigen, nahezu Fremden in der Wohnungstür, des kaum wiedererkannten Vaters. Aber schau, das ist doch dein Papa, sagt die wienerische Hüterin des Vierjährigen, und das Kind kann es nur glauben, sich an ihr Wort halten, wie es sich auf dem Parkfoto an ihre Hand geklammert hat (seine andere Hand im Übrigen auf dem Rücken, um es den erwachsenen Spaziergängern gleichzutun).
Eltern und Sohn sind wieder vereint, aber wo ist das zu liebende Schwesterchen? Das Rätsel löst sich für den Bruder, der noch keiner ist, erst nach und nach: Die kleine Schwester befindet sich in der Obhut einer braven Familie, wie es bald offiziell heißt, der Familie, aus der das Kindermädchen stammt, das nach der Geburt eingestellt worden ist, die Annegret. Vorerst hat diese Ausweichfamilie aus Moorfleet, einem noch sehr kriegswunden Arbeiterbezirk von Hamburg, ihren Dienst getan, und das Schwesterchen ist jetzt, machtvoll laut im Kinderbett, ständig in der Wohnung mit dem vergitterten Balkon, bisher im Vollbesitz des Nochnichtbruders, wenn Damemammi probt oder Theater spielt und der Vater Himmel und Hölle in Bewegung setzt für seine Apparatebaufirma. Der große Bruder, wie man ihn plötzlich nennt, hat es also gleich mit zwei Fremdkörpern tun, Schwester und Kindermädchen, schuld an der ganzen Veränderung hat aber allein die hinzugekommene Schwester, und so versucht er – obschon er in jedem Kaufladen, in dem die Familie bekannt ist, mit geschwellter Brust erklärt, dass er jetzt eine Schwester habe und damit ein großer Bruder sei –, den Eindringling loszuwerden. Überliefert ist ein Drama, bei dem das Kindermädchen das Schlimmste verhindert haben soll; sie ist beim Einkaufen, nur um die Ecke, aber in der Zeit häuft der Bruder einen Berg Schmutzwäsche auf die Störerin, schnell wird es still im Bettchen, und die Schwester ist schon dem Ersticken nahe, als Hilfe kommt. Die stark kurzsichtige, dafür recht weiblich gebaute Annegret (keine Schönheit, aber eine Type – das großmütterliche Urteil) fühlt sich von da an mehr als verantwortlich für das so knapp gerettete Kind, und die braven Elternleute im verpönten Moorfleet werden für die eigentlichen Eltern zur willkommenen Zweitfamilie. Mal ist die kleine Schwester, wo sie hingehört, viel öfter aber, wo sie nicht hingehört, bis die immer wieder von den einen Eltern zu den anderen Verschobene gar nicht mehr weiß, wo nun ihr richtiges Zuhause ist, und aus diesem Zwiespalt eine Unruhebewegung entwickelt; ganze Stunden gehen Köpfchen und Rumpf vor und zurück, begleitet von den immer selben Lauten. Gogel-Gogel nennen die Erwachsenen dieses Frühzeichen einer Verwahrlosung scherzhaft, und folglich nennt auch der Bruder es so: Sie macht schon wieder Gogel-Gogel, sagt er – und soll auch versucht haben, die Bewegung zu bremsen, ja zu stoppen, vergebens; ein großer Bruder, der nichts für seine kleine Schwester tun kann, außer sie zu bedauern, wofür er erste Blicke von ihr erntet (ich erinnere mich an dieses Gefühl des Bedauerns, auch an die Blicke), und so allmählich anfängt, sie zu vermissen, oder es zu vermissen, dass sie langsam anfängt, ein Auge auf ihn zu werfen. Und damit entwickelt sich der Wunsch, die Schwester in ihrem so ganz anderen, gar nicht paradiesischen Exil zu besuchen.
Einige Male ist der nun Fünfjährige draußen in Moorfleet, wo es auf einem großen ausgebombten Fabrikgelände in den wenigen unzerstörten Gebäuden provisorische Wohnungen im Erd- und Tiefgeschoss gibt. Diese flachen klinkerroten – ein Rot wie verkrustetes Blut – Fabrikbauten mit ihren geborstenen Fenstern und Gestrüpp auf den Plätzen dazwischen und Schutt, der übergeht in noch genutzte Gebäudeteile, wo die Fenster Vorhänge haben, sind für den, der sonst allein in seinem Zimmer sitzt und Schiffe zeichnet, ein fremder Planet. Es gibt sogar ein Kino auf dem Gelände, in einer länglichen Baracke, die Außenwand beklebt mit Filmplakaten, neuen und alten; Western laufen dort und Liebesfilme, und manch ein Gesicht hängt schon in Fetzen. Der Junge mit Baskenmütze und Mäntelchen sieht Männer mit Revolver und schmalen Augen und Frauen mit roten Lippen und Schlitz im Rock, einen Schenkel entblößt. Er streift umher in der Stille eines Sonntagnachmittags, als die meisten Leute in der Kinobaracke sind, ein Stadtkind, das nach warmer Milch und einem Marmeladenbrot bei den fremden Eltern seiner Schwester allein auf dem Gelände ist, kaum noch in Sichtweite von Annegret, der Type, die erst abends mit ihm zurückfährt. Und so trödelt es zwischen den Halbgebäuden und Trümmern, in der Hand, wie auf der väterlichen Zeichnung, ein Stöckchen, damit peitscht es die Fetzen von den Kinoplakaten, den Gesichtern der Frauen und ihren Röcken, es schlägt die Zeit tot. Bis plötzlich helles, flehentliches Schreien aus dem Fenster einer Kellerwohnung dringt, das eines Mädchens wie ein Ruf an ihn, also schleicht er sich pochenden Herzens an und schnappt ein Wort auf, Hoserunter! Das Fenster ist halb offen, dahinter liegt ein Schlafzimmer, ein Bett steht dort, davor ein Tisch, neben dem Tisch sitzt eine Frau mit Lockenwicklern auf einem Schemel. Der Zeuge tritt noch näher, und endlich sieht er das Mädchen, über den bestrumpften Knien der Frau, wohl ihrer Mutter. Sein Kleid ist in den Rücken geklappt, seine Unterhose ist bis zu den Knöcheln heruntergezogen, und die Mutter schlägt es mit einem Kochlöffel, dass ihre Lockenwickler pendeln. Das Aufklatschen der Hiebe mischt sich mit dem Schreien des Mädchens und der Stimme der Mutter, die jeden ihrer Schläge mitzählt. Ton und Bild sind wie eins, ein einziger Ansturm auf den Zeugen; er sieht zappelnde Füße in Strümpfen und zwei weiße Backen, die sich röten, das umgeklappte Kleid, himmelblau, und blondes Haar. Nur vom Gesicht des Mädchens sieht er nichts, sosehr er sich auch vorwagt, dafür hört er ihr jetzt im Weinen ersticktes Flehen und dann ein Sichfügen in die Bestrafung, nur noch mit Wimmern vor dem nächsten Schlag. Und er achtet auf das Zählen der Mutter, die jede Zahl zwischen den Lippen hervorpresst beim Schlagen, danach gleich wieder ausholt, und zählt leise mit, er kann nicht anders, und macht sich dabei in die Hose. Es geschieht einfach, unaufhaltsam, und das Unaufhaltsame tut sogar gut, ein so heißes Verströmen, dass ihm die Schenkel vor dunkler Wonne zittern, und ist erst niederschmetternd, als er in die Wohnung der Kindermädcheneltern zurückkehrt, dort die Blamage zeigt und wortlos ausgezogen wird.
Der noch ergriffene, dabei vor Scham glühende Junge – ergriffen wie auf eine Epiphanie hin: der einer strafenden weiblichen Gottheit und ihrem sich fügenden Opfer – wird gewaschen und danach in fremde, viel zu große Hosen gesteckt. So kommt er abends zu den eigenen Eltern, fürchtend, man könnte ihm anmerken, was er gesehen hat, aber man sieht nur eine äußere Folge, das fremde Kleidungsstück mit Flicken, die Travestie des Sohns als kleines, rührendes Proletenkind. Er bleibt allein mit den Bildern aus Moorfleet, fortan ein innerer Film, wenn er schlafen soll, aber wach liegt, unruhig auch, weil immer öfter vom Umzug in eine andere Welt die Rede ist. Und in dieser nervösen Phase des Abschieds, noch in Hamburg, aber schon zwischen gepackten Koffern, während sich der Vater im fernen Schwarzwald nach besseren Bedingungen für seine Firma umsieht, wird der Junge eins mit dem gesichtslosen Mädchen: als er zum ersten Mal selbst Hiebe bekommt und sich in den Rausch einer außer sich geratenen Mutter fügt.
Der jetzt bald Sechsjährige ist mit seiner jungen Mutter in der Wohnung, er leistet ihr dort still Gesellschaft. Sie geht mit Rollenheft in der Hand auf und ab, murmelt und macht jähe Gesten, er aber möchte auf den Spielplatz hinter den Grindelhochhäusern, um dort im Sandkasten einen Tunnel zu bauen. Darin ist er ein kleiner Meister, das eine und andere Kind hat sogar schon seine kostbaren Murmeln oder Klicker durch die zu einer Seite hin abschüssige Tunnelanlage rollen lassen, der Grabung des fremden Jungen also vertraut, aber Damemammi will nicht, dass ihr Augenstern mit anderen Kindern im Sand wühlt. Wir beiden Hübschen bleiben hübsch zu Hause, danke dem lieben Gott, dass du hier in der warmen Wohnung spielen kannst, sagt sie im Auf-und-ab-Gehen, und da vergisst sich das Unkind (oder ist in dem Moment ganz bei sich): Gott ist ein Arschloch!, schreit es und trifft damit, der Sprache ergeben, ins Schwarze, was augenblicklich einen Tumult auslöst. Auch seine Mutter schreit, das Rollenheft zu Boden werfend, Nimm das zurück!, schreit sie, ja verlangt sogar die Entschuldigung bei ihr, nicht bei Gott. Und als der kleine Gotteslästerer, in sich erstarrt, nur schweigt, reißt sie, wie abgeschaut in Moorfleet, einen Bügel aus dem Schrank, zerrt ihm die Hose herunter und schlägt wild auf ihr Fleisch und Blut ein. Der Gezüchtigte aber hört nur das Klatschen des Kochlöffels auf die Mädchenhinterbacken in der Kellerwohnung und spürt mehr als jeden Schmerz einen Schrecken über die so fremde Mutter, wie in den Minuten, wenn er im Souffleusenkasten saß und sie auf der Bühne eine Szene machte. Dann aber erlahmen die Kräfte der Ungeübten; sie steht nur noch aufgelöst da, den hölzernen Bügel in der Hand, und heißt das Biest von Kind, auf der Stelle ins Bett zu gehen, auf der Stelle zu schlafen! – ein Vorfall mit paradoxem Schlusswort, und fast ein Menschenleben später hat der Sohn einmal den Versuch gewagt, die schon gebrechliche, aber noch wache Mutter daran zu erinnern.
Bei einem Abendessen zu zweit, einem der letzten noch am Esstisch ihres finalen Appartements mit Balkon und Aussicht auf Vorläufer der Alpen, ging es um die Sternstunden des Lebens, wenn sie etwa Rollen gelernt habe in der Hamburger Wohnung, während der kleine Sohn still vor sich hin spielte und das Töchterchen schlief. Es war ein Essen, das der alte Sohn samt gutem Wein in einem nahen Feinkostladen besorgt hatte, und nach dem ersten Glas gab es einen Moment ihres Interesses an einem Beitrag auch des Besuchers an der Unterhaltung, und da sprach er von der Spannung zwischen ihrem Wunsch, als Schauspielerin Erfolg zu haben, und dem Wunsch eines Kindes, in einem öffentlichen Sandkasten einen Tunnel zu graben, den andere Kinder erst bestaunen und dann mit benutzen könnten. Aber ich musste zu Hause bleiben, sagte ich und schenkte meiner Mutter – sie hatte sich für das Abendessen noch einmal in Schale geworfen – Wein nach. Du hast erklärt, ich solle dem lieben Gott danken, dass ich in einer warmen Wohnung spielen könnte und wir beiden Hübschen dort hübsch unter uns blieben, und ich nannte Gott ein Arschloch, und du hast einen Kleiderbügel geholt und mich damit geprügelt, nicht wahr? In einem Atemzug rückte ich mit der alten Geschichte heraus, und die Befragte oder ins Gebet Genommene setzte empört ihr Weinglas ab, ja geriet fast erneut außer sich über den Gebrauch solcher Worte und verlangte eine Entschuldigung, und ich entschuldige mich. Wir setzten unser Essen fort, sie sagte, der San-Daniele-Schinken sei tadellos, dabei war es ein gewöhnlicher Parma, von mir aber als San-Daniele ausgegeben, als den Schinken, den man auch im Grand Hotel Danieli in Venedig auf seinem Teller hat; sie hatte ihn dort als Antipasti auf der Terrasse beim Abendessen mit ihrem zweiten Ehemann, wohl mehr als einmal. Ziemlich schnell waren wir also vom Nachkriegshamburg zum Canal Grande gekommen, und der Vorstoß in die Vergangenheit war vergessen. Ich löste ihr die Rinde von einer Scheibe Ciabatta und strich Butter auf das luftige Innere, legte etwas von dem falschen San-Daniele darauf und gab ihr das Stück, und meine Mutter – das schon hagere, bis auf die Wangen eingefallene Gesicht wie umrahmt von einer perlgrauen Perücke, die fast ein Teil ihrer selbst war – entspannte sich nach diesem Sprung in eine jüngere Vergangenheit ohne dunkle Stellen. Wir sprachen nur noch über Italien, nicht das heutige der Verschuldung und der Verblödung, sondern das Italien der alten und ewigen Schönheit – die sie zum ersten Mal mit meinem Vater erlebt habe, vor tausend Jahren für ein paar Tage, sagte sie (und meinte die Alassio-Tage, von denen ich erst später etwas erfuhr, aus dem Jahresbericht). Sie sprang gleich weiter, zu Italienreisen in ihrer zweiten Ehe, und bis auf einen Vorbehalt in den Augen – Augen, die in ihrer letzten Lebensphase immer größer geworden waren, als wollte sie auch die kleinsten Anzeichen des sich nähernden Todes sehen, um noch dagegenhalten zu können – schien sie jetzt dem Frieden mit mir zu trauen, solange wir bei der Schönheit blieben. Ich schob als Dessert ein Pfirsichkompott über den Tisch und machte ihr ein Kompliment: Wie gut sie aussehe heute Abend, eine gut aussehende ältere Dame, und sie drückte mir die Hände, eine Klammer von erstaunlicher Kraft, als könnte sie damit ein Band, das es so nie gab, doch noch herstellen, das schlichte Lebensband zwischen Mutter und Sohn. Iss das, sage ich zu ihr – irgendwie immer noch an dem Tisch, der alte Sohn und seine unsterbliche Mutter – und warte, bis sie die drei überweichen Pfirsichhälften gegessen hat, mit einer Langsamkeit, als müsste sie schwer daran kauen oder kaute an etwas ganz anderem, dann reicht sie mir die leere Schüssel, damit ich sie vor ihre Tür stelle, auf eine dortige Ablage, von der sie, wie von Geisterhand, über Nacht fortgetragen wird. Kein benutztes Geschirr soll bei ihr stehen und Gerüche verbreiten oder Fliegen anziehen und sie womöglich zwingen, die Balkontür zu öffnen. Wollen wir jetzt zum Bett gehen, sage ich und helfe ihr vom Stuhl auf, eingestellt auf kleinere Schreie; immer ist der Griff unter den Armen nicht zart genug, immer geht alles zu schnell. Sie will im Grunde keine Hilfe, sie will Zärtlichkeit, also geleite ich sie mit einem Arm um die Schulter, ohne sie das Gewicht des Armes spüren zu lassen, zum Bett. Noch kann sie sich allein ausziehen, kann sich auch waschen und die Zähne putzen, ich soll währenddessen im Flur vor der Tür auf und ab gehen, nicht etwa verschwinden. Genau zwanzig Minuten soll ich im Flur auf und ab gehen, das würde auch dem vollen Magen guttun, danach wieder hereinkommen und als Abschluss noch etwas am Bett sitzen.
Also verließ der Sohn das Appartement – geschmackssicher und liebevoll von der Tochter, seiner einstigen kleinen Schwester, gestaltet, mit Schlaf- und Essbereich, Garderobe und Bad, einer ungenutzten Kochnische und dem ungenutzten Balkon. Der Flur vor der Tür war lang und still, die anderen Bewohner bekam der Besucher nie zu Gesicht, seine Mutter aber machte dort ihre tagtäglichen Gänge, auf einen Rollator gestützt, seit die Körperkräfte nachgelassen hatten. Nur verlangte der Flur auch innere Kraft: Es auszuhalten, die immer selbe schnurgerade Strecke zwischen einem rückwärtigen Fenster mit Pflanze und Stuhl davor und dem Treppenhaus mit der gegenüberliegenden Fahrstuhltür im Schein einer Sparbeleuchtung hin- und herzugehen, mit wie durch die Stille und das Licht verlangsamten Schritten, tagein, tagaus jeweils für zwanzig Minuten, immer wieder mit Blicken auf eine kleine goldene Uhr (die ihr noch gestohlen werden sollte von einer Betreuerin), ob nicht etwa mit einem weiteren Gang bis zum hinteren Fenster und dem Rückweg zu ihrer Tür die Zeit schon überschritten wäre. Sie darf nicht zu wenig und darf nicht zu viel gehen, bei jeder zweiten Kehre am Fenster setzt sie sich kurz auf den Stuhl neben der Pflanze, um die Atmung zu beruhigen, und sieht auf die Uhr, da sind erst wenige Minuten um, folglich muss sie noch etliche Male gehen – wie auch ich hin- und herging, um die Minuten herumzubringen. Ein Gehen vorbei an den Ablagen für benutztes Geschirr, da ließen sich die Essensreste anschauen, alle unbekömmlichen Hinterlassenschaften, ein Stück Fisch oder etwas Rosenkohl, und nach weiterem Gehen, wieder bei der Wende an der Fahrstuhltür, ließ sich der dort angebrachte Tageskalenderspruch lesen, in dem Fall ein Goethewort, auswendig gelernt, um die Zeit zu verkürzen – Ich besänftige mein Herz, mit süßer Hoffnung ihm schmeichelnd. Eng ist das Leben fürwahr, aber die Hoffnung ist weit. Und bei jeder Runde die Überlegung, warum man genau das Wort und kein anderes gewählt hatte für diesen Tag, auch so vergingen Minuten, bis plötzlich sogar Eile geboten war; ich musste zügig von der Fahrstuhltür zu der Appartementtür gehen, um noch in der Zeit am mütterlichen Bett zu erscheinen.
Sie hatte die Perücke abgenommen, dafür ein Handtuch um den Kopf geschlungen, ein paar weißliche Fäden hingen ihr über die Wangen. Sieh da nicht hin, sagte sie, war jemand im Flur, hast du gegrüßt? Sie hielt sich eine Hand über die Augen, es war schon die Geste der Entlassung, auch die Geste, mit der sie ein Gespräch platzen ließ. Im Flur war niemand, erwiderte ich, die meisten schlafen schon, bist du nicht auch müde? Ich ging zum Kühlschrank, zu der zweiten Flasche Wein. Nur diese Flasche und die Butter und etwas Käse, vom Essen übrig geblieben, lagen dort wie verbannt. Sie wollte keine Lebensmittel in ihrer Nähe, nichts, was verderben konnte; sie wollte auch keine Blumen, Blumen verwelkten nur, und man könne nicht genau sagen, wann das Verwelken einsetze, ja auch eine frische Blume verwelke schon, man sehe es nur nicht so, man wisse es aber und warte darauf, bis man es sieht, besser also keine Blumen. Vor allem aber nichts Angebrochenes im Kühlschrank, nur der verschlossene Wein durfte dort bleiben, die Flasche war dann schon die Flasche für den nächsten Sohnesbesuch. Ob ich sie heute Abend noch unbedingt öffnen müsste – muss das sein? Meine Mutter war auf einmal bei Stimme, und die Antwort hieß: Ja. Aber sie hätte auch heißen können: Ich kann nicht anders, als jetzt noch zu trinken, am liebsten die ganze Flasche, zum Glück muss ich ja morgen nichts tun, nur im Zug sitzen, warum also die Flasche nicht öffnen? Und ich zog den Korken und schenkte mir ein und setzte mich an ihr Bett, das volle Glas am Mund, und hätte auch gern noch gesagt, dass ich trinke, weil etwas in mir betäubt sein will, wenn die Betäubung durch die Arbeit, das Schreiben, gegen Abend nachlässt. Und dass alles, was sie in Verbindung mit mir stolz macht, an seidenen Fäden hängt. Ebenso gut hätte es auch anders laufen können, auf der schiefen Bahn abwärts; statt dem Erfolg und der Bekanntheit durch Erfinden und Übertreibungen im Roman, statt dem Verführen oder Rache-Üben allein mit Worten, ohne dass jemand dadurch zu Schaden kommt, ein tatsächliches Verlogensein, das einen als Erfolgsbetrüger erst in die Schlagzeilen bringt und zuletzt ins Gefängnis.
All das wollte der Sohn loswerden an dem Abend, dazu den Wein trinken, am besten aus der Flasche, was schon ein Stück reale Rache gewesen wäre: Seiner Mutter im Bett zu zeigen, welche Art des Trinkens ihm am nächsten war, und wenigstens machte er eine Andeutung, tat so, als ob, die Flasche am Mund, um schließlich doch das Glas auf eine nun in sich eingesunkene, wie in ihre Welt zurückgetauchte alte Frau zu erheben. Ich erinnere mich, auf ihr Wohl getrunken zu haben, ausdrücklich auf ihr Wohl und noch viele gute Tage, aber sie war bei der Ungehörigkeit hängen geblieben, der Flasche am Mund, und kippte dadurch noch weiter zurück, sie kam auf ihre frühen Hamburgjahre und meinen Vater: Der habe auch immer aus der Flasche getrunken, ja überhaupt gern Wein getrunken. Warum wollte er denn weg aus Hamburg, unbedingt in den Schwarzwald? Natürlich auch, weil es bei Freiburg die Weinberge gab, einen sogar in der Stadt, das hat er gleich erzählt, als er von seiner Erkundung zurückkam, und ein paar Wochen später saßen wir zu fünft in einem alten VW und fuhren in zwei Tagen durch ganz Deutschland, großer Gott!
Wieso zu fünft? Ein Nachhaken, auch wenn ich die Antwort kannte, aber sie sollte von dieser Weltreise, wie unsere Fahrt damals hieß, etwas erzählen, während ich den Wein aus dem Glas trank, und sollte nicht nur im Bett liegen und eine Art Schnappatmung vortäuschen. Wieso? Weil die Annegret dabei gewesen sei, das Kindermädchen, still vor sich hin heulend im Auto, weil sie schon Heimweh gehabt habe – ob ich die ganze Flasche trinken wollte? Sie unterbrach sich selbst, noch eine Methode, Gespräche platzen zu lassen; ich stellte die Flasche ab und bat sie, weiterzuerzählen, und sie rief mit einer jähen, fast gespenstischen Energie in der Stimme, ob ich mir überhaupt vorstellen könnte, wie jung sie und mein Vater damals auf dieser Weltreise in den Schwarzwald mit Übernachtung hinter Kassel gewesen seien? Und der Sohn konnte sich zwar nicht vorstellen, wie jung sie waren oder sich fühlten im Mai fünfundfünfzig, aber dass sie beide jung waren auf der Reise in eine neue Heimat, die nie ihre Heimat wurde, nur seine der Kindheit, ausgefüllt von ihrer so anderen Sprache, ihrer bewaldeten Landschaft und all den neuen Gerüchen, nach Heu, nach Traktorfett, nach Gülle und Tinte aus dem Tintenfass, das wusste er.
Ja, ihr wart jung, sagte ich. Aber wann sind wir angekommen? Und meine Mutter schüttelte kaum merklich den Kopf, wie immer, wenn sie sich etwas ins Gedächtnis rief, an das sie eigentlich nicht erinnert sein wollte. Wann sind wir angekommen? Irgendwann gegen Abend waren wir in Freiburg und sahen das Münster und den Schlossberg mit Weinstöcken und haben uns umarmt, dein Vater und ich. Nur war Freiburg gar nicht das Ziel, sondern ein Vorort, dort gab es am Fuß einer alten Bergwerkshalde ein Gebäude, in das die Firma einziehen sollte, und wohnen sollten wir in Kirchzarten, einem Dorf in der Nähe. Es gab eine Straße, die führte an der Halde vorbei, einem Hang, der aussah, als hätten Bomben eingeschlagen, von dort ging es zwischen Wiesen und Waldhängen Richtung Kirchzarten, bis die Straße nur noch ein Feldweg war, und an einer Stelle am Wald sah ich einen Gasthof, den Gasthof zur Tanne, dort haben wir die erste Nacht im Schwarzwald verbracht – du wirst dich nicht erinnern, sagte sie, und ihr fielen schon die Augen zu. Aber die Bilder vom Ende unserer Weltreise waren nach allem, was sie gesagt hatte, ganz deutlich: Es gab Würstchen und Limonade, die Bluna hieß, und mein Vater, den ich bewunderte für sein Autofahren mit Zwischengas beim Schalten und das mit einem Fuß, noch dazu dem falschen linken, trank aus einem kelchförmigen Glas seinen ersten Wein aus der Gegend, in der er von nun an leben würde. Wir bezogen in dem Gasthof zwei Zimmer, eines die Eltern, das andere die Geschwister und das Kindermädchen; sie weinte schon wieder vor Heimweh, und mein Vater rief, sie solle sich zusammenreißen. Es war ein milder Maiabend, wir aßen im Freien, meine Mutter streckte sofort ihre Fühler aus nach einer Bleibe, bis wir in dem nahen Dorf etwas Passendes gefunden hätten, und die Wirtsleute erzählten von einem Hof, nur wenige Minuten entfernt, dem Hug’schen Hof, wo wir für den Sommer unterkommen könnten. Mehr sagten sie nicht, aber die Schauspielerin ohne Bühne malte schon die Idylle auf dem Hof aus, und ich sehe noch meine Eltern ihre Weingläser aneinanderstoßen, auf das Paradies, und sehe die Tränen der Annegret hinter ihrer starken Brille und weiß noch, wie ich das erste Wort in der so fremden Sprache aufschnappte, aus dem Mund des Wirts: Sel Glas, sagte er, statt dieses Glas, ob er sel Glas nachfüllen dürfe, und mein Vater rief Jawoll!, mit doppeltem L, und kam dann mit einer Erklärung, später bei jeder Gelegenheit wiederholt: Dass sel in der Sprache hier, im Alemannischen, für der, die, das stehe, für alle Artikel, und die Abkürzung von selbiges sei. Wie maulfaul praktisch, sagte er vielleicht noch, und seine schöne junge Frau schmiegte sich an ihn und summte den Refrain eines Liedes, das sie im Auto sogar gesungen hatte, als es auf Freiburg zuging: Schwarzwaldmädel hübsch und fein, du sollst meine Liebste sein. Wir Kinder sangen es mit, jedenfalls der bald Siebenjährige, überfällig für den Besuch einer Schule, dafür aber von hoher Aufmerksamkeit für alles, was die Erwachsenen sagten, besonders der Vater, und dazu noch, bisher von anderen Kindern weitgehend ferngehalten, ein Beobachter seiner selbst – ich erinnere mich auch an ein Streifen durch den Garten des Gasthofs zur Tanne, während die Eltern rauchten und das Kindermädchen meine kleine Schwester zu Bett brachte. Es gab dort in den Beeten bunte Kugeln auf Stecken, um die Vögel abzuhalten, eine Szenerie wie vor dem Landgasthof bei Kitzbühel, und gleich beim Anblick dieser grünen, blauen und roten Kugeln überfiel mich eine Sehnsucht nach meiner großmütterlichen Hüterin, die uns erst später – im Herbst, hieß es, aber was ist für ein Stadtkind der Herbst – vom fernen Hamburg in den Schwarzwald nachfolgen sollte, was aber hieß, dass ich einen ganzen Sommer schutzlos wäre.
Ja, so war das, sagte meine Mutter mit jetzt erschöpfter Stimme, als hätte sie das alles haarklein erzählt – alles, was mir, Jahre nach ihrem Tod, durch den Kopf gegangen ist und immer noch durch den Kopf geht –, und wie als Beleg für unsere einstige Weltreise und den ersten Abend in der Fremde summte sie sogar noch die alte Melodie vom Schwarzwaldmädel, vermischt mit einem Ringen nach Luft, und der Besuchersohn schenkte sich Wein nach und leerte das Glas in einem Zug. Sie sah es nicht mit ihren zugefallenen Augen, trotzdem war sie noch wach, voller Willen, und erteilte einen präzisen Auftrag, ihr noch ein Wasser für die Nacht zu bringen, das Wasser aber aus einer Flasche, die nicht auf dem Balkon stand, nur ein wenig kühl ist, weniger als lauwarm, und nicht zu voll das Glas – etwas mehr als die Hälfte, hörst du? Und der Sohn hörte heraus, was sie neben dem Wasser eigentlich wollte, ihren Willen durchsetzen, also ging er zur Küchennische und füllte ihr Glas mit Wasser von Vittel, das nach nichts schmeckt und weder lauwarm ist noch kalt, nur flüssig – ich füllte es bis zu einer Markierung, die nur der sah, der meine Mutter kannte, lebenslang, ging wieder zum Bett und stellte das Glas auf den Nachttisch, die dafür vorgesehene Ecke, nah am Rand, aber auch nicht zu nah. Es folgte das Herunterbeugen und zuerst ein Kuss auf die Stirn, während ihr Mund schon leicht vorschnappte für den eigentlichen Gutenachtkuss, wenigstens andeutungsweise auf die Lippen, bevor, auf ihr Geheiß, das Licht am Bett zu löschen war. Nur eine Lampe brannte jetzt noch in dem Appartement, eine Stehlampe mit grünem Schirm in der Sitzecke, sie sollte die ganze Nacht anbleiben, gegen die Dämonen, auch wenn sie das nicht aussprach, nur sah man es ihr an. Da war ein Bangen in ihren Augen, wie bei Kindern, die erstmals für einen Abend allein gelassen werden, und ich sah sie ganz in diesem Bangen, dieser stillen Furcht, sah sie plötzlich als die, aus der ich, wenn es sie nicht mehr gäbe, sie mich allein gelassen hätte, in der Erinnerung erzählend etwas machen würde, das im Moment noch verschwommen war, eine Geschichte ohne Titel. Dann bis morgen, sagte ich, und sie sagte – nicht das erste Mal an dem Abend –, ihren Herrn Abban bitte zu grüßen, wenn der im Foyer sitze, und ich versprach es und entfernte mich rückwärts und sah noch, wie sie an ihren Handtuchturban griff, bereit, seinen Knoten zu lösen, das dünne weiße Haar zu befreien, das der Sohn nicht sehen sollte, noch nicht. Ich ging zur Tür und wünschte ihr jetzt erst gute Nacht, rief es ins Zimmer, Gute Nacht, und sie antwortete mit fast fester Stimme aus dem abgetrennten Schlafbereich, Gute Nacht, mein Sohn! Ein Wort wie eine Hand, die noch einmal nach mir griff, aber da trat ich schon in den Flur und schloss die Tür hinter mir – blieb noch die Arbeit des Einschlafens in der Stille der Wohnanlage, auch im Gästeflügel, aber schon in dem Flur so umfassend, dass man versucht war, aufzustampfen und laut gegen die Wände zu reden. Ich lief an der Fahrstuhltür mit dem Tageswort von Goethe vorbei, lief die Treppe hinunter und durch einen Gang in das Foyer, und dort saß tatsächlich einzig und allein Herr Abban im dunklen Anzug mit Schlips in einem Sessel, ein schmaler, in sich gekehrter Herr, von meiner Mutter, als sie noch das Restaurant der Wohnanlage betreten hatte, als Tischnachbar auserkoren. Er schien zu schlafen, ich ging auf Zehenspitzen weiter, aber da murmelte er ein Guten Abend, die Augen weder auf noch zu, und ich erwiderte den Gruß, verbunden mit seinem Namen, Guten Abend, Herr Abban. Mehr konnte ich nicht sagen, auch wenn es gut gewesen wäre, ihm noch Grüße meiner Mutter zu bestellen, gut für seinen Frieden in dem Sessel, und so wurde es geradezu ein Davonlaufen in den Flügel mit den Gästezimmern, im Grunde die Flucht vor dem Alter.
Ich bewohnte das Zimmer, das auch meine Schwester während ihrer ja tagelangen Besuche, immer bis zum Gehtnichtmehr an der Seite der Besuchten, für ein paar Stunden Schlaf nutzte. Dort lag im Kühlschrank Wein bereit, die eiserne Reserve des Sohns, und ich trank im Stehen aus der Flasche, wie es mein Vater getan hatte, wenn es ihm an Sommertagen, aus reiner Lebensfreude, so gefiel, bis sich eine Chemo zwischen ihn und den Wein oder überhaupt das Leben stellte. An unserem ersten Abend im Schwarzwald aber hatte er sich darin gefallen, aus dem neuartigen kelchförmigen Glas mit seinem dicken geriffelten Stiel zu trinken und es immer wieder an das Glas seiner jungen Frau zu stoßen, vielleicht als Auftakt zu einer Umarmung im gemeinsamen Gasthofbett, der ersten Umarmung in seinem Arkadien, auf das er gesetzt hat, einer Gegend der Süße und des Lichts nach dem grauen Hamburg, während die Kinder bei der heimwehkranken Annegret aus Moorfleet lagen und dem Sohn vor dem Einschlafen noch etwas durch den Kopf ging – ich glaube, mich daran zu erinnern, aber das kann auch an dem Berauschenden liegen, seit die Arbeit des Schreibens am letzten Glücksort der Eltern geschieht, in ihrem Zimmer mit Meerblick für wenige Tage: Warum wohl das Dorf, in das wir ziehen wollten, Kirchzarten hieß.