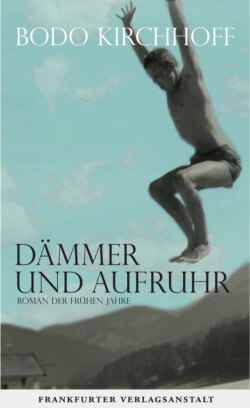Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Das kleine alte Hotel am schmalen Strand von Alassio an der Riviera dei Fiori heißt Beau Sejour, Schöner Aufenthalt, und war für ein paar Tage der Traumplatz meiner Eltern, so heißt es im Ehebericht für das Jahr achtundfünfzig: Wir hatten etwas Traumhaftes in Alassio gefunden, das kleine Strandhotel Beau Sejour, und verbrachten dort die letzten unbeschwerten, märchenhaften Tage, für die wir dem lieben Gott danken. Wir saßen auf unserem Balkon im zweiten Stock, sahen auf das blaue Meer und wussten, dass wir wieder etwas Geld im Rücken hatten, die Firma wenigstens bis Jahresende gerettet wäre. Und danach? Daran durfte man gar nicht denken.
Sie hatten in Nizza die Lizenz für das am zuverlässigsten arbeitende medizinische Gerät aus einer nie ganz auf die Beine gekommenen Apparatebaufirma, in der ihrer beider Träume steckten, nach Frankreich verkauft, das von meinem Vater mitentwickelte handliche Tastotherm, ein immerhin schon elektronisches Instrument für die sofortige Messung der Körpertemperatur – ein kleiner warmer Regen für die bedrängte Firma, ein Teil davon bar auf die Hand. Der Überschwang meiner Mutter rührte wohl auch von dem sichtbaren Geld und war ansteckend genug, damit sie beide unbeschwert über die nahe Grenze nach Alassio fuhren, damals wie heute ein mondänes Seebad in einer von Bergen umgebenen Bucht, bekannt für ein mildes Klima, mit fast noch sommerlichen Tagen bis in den Oktober. Ja, es waren die letzten schönen Tage, ein im Jahresrückblick unterstrichener Satz, als hätte die Verfasserin damit auch die Tage mit ihrem Mann gemeint, während der Sohn, fast ein Menschenleben später, nur das gute Wetter aufnimmt, darin aber verborgen die Melancholie der letzten schönen Tage, mit dem Bangen, wie lange es noch so weitergehe. Jeden Morgen ist es ein Ausschauhalten nach ersten Wolken beim Hinaustreten auf den einzigen Balkon im zweiten Stock des alten Hotels, einst Ferienvilla einer italienischen Familie, dem Balkon des inzwischen begehrtesten Zimmers, schon im Jahr zuvor gebucht, nachdem ich in den Kladden meiner Mutter auf das Beau Sejour in Alassio gestoßen war. Über den Aufenthalt selbst steht dort kaum etwas, nur eben dass er märchenhaft gewesen sei und es im Hotel einen Leseraum gebe (den es noch gibt), man auf einer Terrasse mit Meerblick frühstücken könne und das Zimmer klein sei, mit auch schmalem Bett – alles in allem aber unbeschreiblich schöne Tage, auch wenn mein geliebter Mann oft etwas Fernes hatte, mit einem Wein und einer Zigarette auf dem Balkon, sein ohnehin schon dunkles Gesicht in der Sonne.
Das Bett in dem Zimmer ist inzwischen breiter, ein französisches Doppelbett, kein Kingsize, zumal in das Zimmer nachträglich Dusche und Toilette eingebaut worden sind, während alles Übrige, der Schrank, der Schreibtisch, die Bilder, auch die Balkonstühle und der kleine gusseiserne Außentisch, alt ist oder mir so alt erscheinen will, dass schon meine Eltern diese Stühle genutzt haben könnten, meine Mutter mit Kissen im Rücken, dabei die Füße an der Brüstung, wie einst auf dem Holzbalkon in dem Gasthof oberhalb des Schwarzsees, wenn sie ihre nächste Rolle memoriert hat oder einfach nackt in der Sonne saß, zwei rote Blüten auf den Lidern. Aber was ist das, sich am vermutlich letzten Glücksort seiner toten Eltern aufzuhalten, diesen Raum einzunehmen, ja darin zu schreiben? Eine stille Übertretung, als hätte man als Kind, nachts von rätselhaften Lauten geweckt, die elterliche Schlafzimmertür geöffnet; aber auch eine Verbeugung vor ihren Tagen hier, die sie sich aus dem Leben geschnitten hatten, den Kämpfen um den Erhalt der kleinen Firma – Unternehmer sein, Traum meines Vaters, der als Habenichts mit einem Bein aus dem Krieg kam – und den Kämpfen um den Erhalt der Ehe: Traum meiner Mutter, das Liebesglück mit dem idealen Mann bis ans Ende aller Tage. Die erste Nacht in dem Zimmer war noch zerrissen, traumzerfurcht, und in der zweiten Nacht hat schon das Meer geholfen, die Geräusche der Wellen, ihr Anrollen und Brechen am Strand vor dem Hotel; der alte Sohn einst junger Eltern, die das Zimmer bewohnt hatten – sein Vater zweiundvierzig, die Mutter vierunddreißig –, hat tief geschlafen und war am nächsten Morgen von einer Wachheit wie unter einer Droge, wenn sich das Chronologische auflöst, Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen nebeneinanderstehen und es keine Grenzen der Erinnerung mehr zu geben scheint.
Mit meinem vierten Geburtstag endete das Zweisame und zugleich Einsame der Mittagsschlafstunden in dem Dachzimmer mit dem Geruch des aufgeheizten Moorsees, der in Wellen hereinzog. Wir wechselten wieder in den Gasthof Vordergrub, damit Das Menscherl, wie die Wiener Großmutter ihr Einundalles nannte, auch gefeiert werden konnte. Sie, meine Hüterin, hatte für Gratulanten gesorgt, die Kinder der Wirtsleute eingeladen, einen Buben und ein Mädel, beide mit Spangen im frisierten Haar – Gott, wie adrett, hieß es, als sie auftauchten –, sowie die Buben von dem Bauernhof, auf dem ihre Schwester wohnte, sie kamen barfuß, aber gekämmt immerhin, und jemand machte ein Foto von der Geburtstagsrunde, lauter lachende Kinder, bis auf den kleinen Jubilar, der etwas Abweisendes um seinen Mund hat. Die Eingeladenen sind im Grunde Claqueure zum Bejubeln der ausgepackten Geschenke, Spielzeug aller Art, das sie anschauen und berühren dürfen, aber nicht ausprobieren. Nur das Geburtstagskind darf, nachdem die Gratulanten verabschiedet worden sind, mit einem Ball spielen und ein Blechauto anschieben, damit es von allein weiterfährt, in einem Bilderbuch blättern und schließlich, als Höhepunkt, einen Pappzylinder aufsetzen und den dazugehörigen Zauberstab auf die drei Frauen am Tisch richten. Es darf sie verzaubern, und weil auf der Wiese vor dem Gasthaus Hühner umherlaufen, verwandelt es sie, Abrakadabra, in Hennen: drei, die sich im Hennesein überbieten, gackern und flügelhaft die Arme bewegen, zum Erstaunen aller übrigen Gäste – ein Spektakel, das den Zylinderträger vergessen lässt, was ihm die Mutter in der letzten gemeinsamen Bettstunde, sich den schon leicht gewölbten Bauch streichelnd, als großes Geheimnis erzählt hat: dass er bald ein Geschwisterchen bekomme. Und so fühlt er sich jetzt noch ganz als der Alleinige und lässt sich Zeit, den Zauber wieder aufzuheben, während das Wesen, in das er selbst verwandelt wurde – ein Unkind, das schon haben will, was es hatte, das schon begehrt –, als ihm eigenes Wesen bleibt. Unauslöschlich eingebrannt ist dieser Alpensommer, jedes Geschehen darin, alles so schrecklich Schöne, das unter keinem guten Stern stand, letztlich noch unter dem Unstern, dem Desastrum, das die elterliche Welt keine zehn Jahre zuvor heimgesucht hatte und das, von Kitzbühel und ähnlichen Orten abgesehen, noch überall sichtbar war.
Das Hamburg meiner ersten Jahre war ein Hamburg der entmutigenden, ihrer Farbe beraubten Farben, mit dem rußigen Klinkerrot der Häuser, dem Grau des Hafenwassers, der Werften, des Himmels; dem Düsteren der Speicher mit den Spuren von Ebbe und Flut, dem Schwärzlichen der Kanäle. Dazu am Abend das fahle Licht der Laternen, das Geduckte der Brücken, der eilige Heimweg, die Zigarette in hohler Hand, als gäbe es noch immer Verdunklung und ein Leben mit eingezogenem Kopf. Noch schien der Krieg durch seine Zeugnisse über den Menschen zu wachen, mit Ruinen, mit Bunkern, mit wie ausgebrannten Hochbahnstationen. In den Zügen standen Männer mit leerem Jackettärmel, die Hand, die sie noch hatten, am Haltegriff, während Männer mit leerem Hosenbein auf den Plätzen für Schwerkriegsverletzte saßen, die hochgeschlagenen Hosenbeine oder Ärmel oft nur lose angenäht, als würden sie noch einmal gebraucht, weil das Bein und der Arm vielleicht wieder nachwachsen, wenn es auch allgemein aufwärtsgeht. Aber von diesem Aufwärts war in Hamburg noch nichts zu sehen. Es herrschte ein Halblicht zwischen Tag und Nacht, die Sonne schien lediglich rund um die Alster, das war der Eindruck; dort waren die Villen auch hell (wie eine Vorstufe zu ihrem heutigen Unschuldsweiß), und der Mercedes vor der Tür war schwarz. Noch hielten sich die Reichen im Hintergrund, das Hamburg meiner frühen Kindheit war eine Arbeiterstadt, ein geschundener, aber in sich zäher Stadtleib, mit nicht totzukriegenden Organen, St. Pauli, St. Georg, Altona, Hoheluft oder Winterhude – ich führte diese Namen im Mund, wie die Namen von Spielgefährten, die es nicht gab. Und ich mochte es, an den Ruinen vorbeizugehen, oft noch mit einem kleinen Laden darin, einem Milchgeschäft im Souterrain, oder einer einzelnen Wohnung im ersten Stock, einem Fenster mit Gardine zwischen Ausgebranntem, so gerettet wie verloren. Bis auf die Pracht um die Außenalster ist mir nichts froh in eine Zukunft Weisendes aus den frühen Hamburgjahren in Erinnerung, und letzten Endes zielte die ganze elterliche Anstrengung darauf, aus dieser allgemeinen Düsternis an ein bleibendes Licht zu kommen. Das Desaster des Krieges, das zwei alles andere als füreinander Bestimmte vereint hatte, blieb für die beiden Entronnenen folgenschwer, mit den sichtbaren Folgen der Zerstörung und mehr noch den unsichtbaren, vor allem der ständigen Sorge, wieder in das Chaos zurückzufallen und nur durch unaufhörliche Anstrengungen die Bresche in eine bessere, die hellere Zukunft offenhalten zu können.
Vereint, ein zu romantischer Begriff für das, was zu dieser Verbindung geführt hatte. Ein Zahnarzt und Angehöriger der SA, mit dem meine künftige Großmutter im Wien der letzten Kriegsmonate wohl etwas mehr als eine Affäre gehabt hatte, war mit einem jungen Hauptmann, der dort nach einer Beinamputation im Lazarett lag, in irgendeiner Form bekannt genug, um ihm gegenüber die schöne Tochter seiner getrösteten Kriegerwitwe mehr als einmal zu erwähnen, eine junge Schauspielschülerin, abkommandiert zur Pflege von Verwundeten, aber tätig in einem anderen Flügel des Lazaretts – so weit die Version der einstigen Reinhardt-Seminar-Absolventin, meiner Mutter, als sie schon vom Leben nichts mehr wissen wollte. Dieser SA-Zahnarzt also, beschäftigt in dem Lazarett, in dem mein künftiger Vater lag, hat den jungen Hauptmann, beinamputiert zwar, aber fesch, wie man in Wien sagt, gut aussehend, vorbereitet auf die schöne Hilfsschwester, und noch vor der ersten Begegnung ist der in jeder Hinsicht ausgehungerte Soldat aus Hannover blind genug, um die ihm eigentlich fremde Gefühlslage, das überreizte, von tiefem Kummer geradezu gemästete Glücksverlangen einer Neunzehnjährigen, die erst den Vater und später den Verlobten durch den Krieg verloren hat, zu übersehen: Keine Verwundete tritt da an sein Bett – so verwundet wie er, nur unsichtbar –, sondern ein Engel. Und auch die, die vom Kuppler im Braunhemd mit Kampfbinde an das Bett des Hauptmanns gelotst worden ist, steht dort in herzklopfender Erwartung und erkennt allein, was sie sieht: einen Helden mit blauen Augen und schwarzem Haar, Offizier wie ihr so früh im Krieg als Major gefallener, über alles geliebter Vater, nebenbei zartbesaiteter Amateurdichter. Und sie sieht in dem Beinamputierten eine Art Wiedergeburt ihres Verlobten, als Leutnant in einem U-Boot ertrunken (beider Vornamen bilden meine Mittelnamen). Es hätte damit kaum besser und, aus der Distanz eines Lebens gesehen, kaum schlechter kommen können: Zwei, die sich unter weltfriedlichen Umständen niemals gefunden hätten, der Sohn eines gescheiterten Hannoveraner Möbelhändlers und die Schauspielschülerin aus gehobenen Wiener Kreisen hatten sich auf Anhieb gefunden – auch das, im Grunde, ein Desaster, aber vor dem Weltdesaster beiden als Glücksfall erschienen. Die Hochzeit fand in den letzten Kriegstagen statt, am vierundzwanzigsten März fünfundvierzig in Wien, Trauzeuge war der Zahnarzt, vermutlich noch liiert mit der Brautmutter, und ihm war es geschuldet, dass die Zeremonie trotz eines kirchlichen Rahmens vom Horst-Wessel-Lied begleitet wurde. Das Lied der Kampforganisation der NSDAP galt als zweite deutsche Nationalhymne, und so üblich es auch war, eine Hochzeit damit zu begleiten, um dem jungen Paar den Rücken zu stärken, war es doch keine Pflicht. Aber so kurz vor Kriegsende, bei der Hochzeit eines Hauptmanns, der sein Bein einem Verbrecher geopfert habe, wie er später oft sagte, war es ein Hohn auf den Bräutigam: den er entweder aus Liebe überhört hat oder als Preis für den Kuppler ertragen; denkbar auch, dass beides zusammenkam, ein Überhören und stilles Dulden, während der Brautmutter und ihrer Tochter zuzutrauen war, dass sie vom Erhebenden dieses Liedes trotz allen Leids durch den Krieg mit emporgehoben wurden. In jedem Fall beendete aber die Hochzeit den Kriegskummer offiziell. Der Verlust von Vater und Verlobtem und der Verlust eines Beins und der gemeinsame Verlust von Jugend hatte einen Ausgleich erhalten, nur ein tieferer Schmerz infolge aller Verluste blieb, und er ist im Verlauf dieser Ehe, samt den Versuchen, ihm zu entfliehen – der letzte vielleicht im Hotel Beau Sejour in Alassio –, eine der Ursachen ihres Scheiterns. Beide, mein Vater wie meine Mutter, haben sich immer wieder dorthin gestürzt, wo sie das Glück vermuteten, er das seine, sie das ihre, und in dem Maße, wie diese Stürze Stürze blieben, ohne das Netz eines Alltags, festigte sich, zusammengehalten von Stolz, eine Privatwelt aus Eigensinn, Distanziertheit und Trauer: und noch der Stolz des Sohnes bemisst sich aus dem Abstand, der sich zwischen ihm und der Welt errichten lässt (so offensichtlich auch diese Distanz nur Ausdruck fehlender Mittel ist, sich als Teil der Welt zu erleben).
Einer der Stürze ins Glück, sieben Jahre nach Kriegsende im Frühsommer zweiundfünfzig, war zweifellos der von Kitzbühel mit dem knapp vierjährigen Sohn als Begleiter – Herrgott, ist das schön!, ruft die junge Mutter mit Blick auf die Berge. Und doch gibt noch immer die Kriegskatastrophe den Ton an, nicht nur bei ihr, auch bei dem, der in Hamburg geblieben ist, um die kleine Firma weiter aus dem Boden zu stampfen, obwohl es an Geld fehlt, Tag für Tag. Beide schlingern durch diesen Sommer, beide glauben zu wissen, wo das Glück liegt, beide beschwören es wortreich, während sie in Wirklichkeit, ihrer eigenen und einzigen, die zählt, noch nicht aufgehört haben, durch die ersten Winter nach dem Krieg zu taumeln, mit gefälschten Lebensmittelkarten (mein Vater war Meister darin) und Zigaretten aus Amerika (vom Bruder des Vaters, nach dem ich benannt bin) als Zahlungsmittel auf dem Schwarzmarkt. Und bei all dem ohne jede Aussicht, dass es je wieder anders würde, statt all der Trümmer Paläste aus Glas und Stahl aufragten, statt der leeren Theken ein Überquellen von Waren wäre, von hundert Brotsorten und Feinkost aus aller Welt, und man statt dem En-suite-Spielen auf eisigen Bühnen, in Kiel, in Celle, in Lübeck, in Flensburg, auf den überweichen Händen des Fernsehens getragen würde oder statt Märschen auf einem Bein quer durch Hamburg, um irgendwo Briketts aufzutreiben, die Drehung an einem Knopf genügte, damit es in der ganzen Wohnung warm wird (heute sogar per Smartphone). Beide hatten noch nicht aufgehört, durch ihr Nachkriegsdunkel zu irren, eingeschlossen in etwas unmenschlich Maßlosem, das mit seinem Getöse, seinem Gebrülle und Stechschritt, mit all den grauenhaften Clownerien der Macht – vom Krieg wagt der Sohn gar nicht zu reden auf seinem Hotelzimmerbalkon mit Meerblick – die Oberfläche ihrer äußeren und auch inneren vertrauten Welt bis zur Unkenntlichkeit geschleift hat. Und womöglich ist es dieses Zerstörungsgeräusch, das ihnen noch, gleich einem Tinnitus, in den Ohren liegt und die Laute eines Kindes übertönt, das schon früh lernt, mit sich allein zu sein, nicht zu ertrinken in schier endlosen Nachmittagsstunden. Ein Nachhall des großen Grauens reicht sogar bis in den siebten Ehejahrbericht der jungen liebenden Schauspielerin und Mutter, noch auf der allerletzten Seite, der hinteren Innenseite des Einbands der Kladde, schwingt ein imperativer Ton mit. Dort steht, nach der bereits unterschriebenen Schlusszeile, als Apotheose eine mit Liebeslied überschriebene Hymne: Durch Dich hat die Welt nur ein Gesetz und einen Sinn, ich liebe Dich, solang ich bin / Durch Dich hat die Welt nur ein Gesetz und ein Gebot, ich bleibe bei Dir bis in den Tod / Nichts ist so vollkommen wie das Glück, das uns vereint / Das Dir erscheinen mag als Märchentraum, doch unser wahres Leben ist!
Ich höre meine Mutter deklamieren, wenn ich diese Zeilen lese, Beschwörung war ihr Mittel, zusammenzuhalten, was an sich nicht zusammenpasste, oder zu überspielen, dass jeder, sie und mein Vater, mit seinen Wunden, seinen Wünschen, einem Lebenstraum, letztlich allein war. Die äußere Not nach dem Krieg, der Mangel an Nahrung und Wärme, und etwas später der an Geld, Wissen und Schönheit ist das Siegel über der inneren Not, die dadurch kaum zur Sprache kommt, höchstens zum Ausbruch. Die nicht sichtbaren Wunden aus dem Krieg (die von Millionen, meine Eltern eingeschlossen) sind auch in den Nachkriegsjahren noch ein unbetretenes Gebiet. Alle Anstrengungen zielten darauf, fremdes Gebiet zu erobern und die Eroberer schließlich zurückzudrängen, und das Reich der geheimen verwundbaren Stellen, zu denen man Zuflucht nimmt, wenn einem sonst nichts gehört, blieb sich selbst überlassen (oder klang nur in einem Lied wie Lili Marleen an); die, die das Terrain der Gefühle seit Beginn des Jahrhunderts betreten hatten, waren entweder emigriert oder mehr als mundtot gemacht worden. Neben einem Wissensmangel ist es auch der Mangel an eigener begriffener Sprache, der die Berichte einer Glücksbesessenen, meiner Mutter, über ihre Ehejahre durchzieht, ein Mangel aus dem Überfluss an Bühnensprache, die sich beliebig einsetzen lässt; immer wieder spielt sie junge Damen mit überspannten Worten für überspannte Gefühle, über tausendmal etwa in Oscar Wildes’ Idealem Gatten, Abend für Abend auf jeder ungeheizten Bühne Norddeutschlands.
Es bestand kein Mangel an Wörtern, und so gab es sie auch im Überfluss in dem Sommer, als die Schauspielerin und ihr kleiner Kavalier durch Kitzbühel ziehen und er wildfremde Damen zu grüßen hat, mit einem Diener und der Anrede Gnädige Frau, wobei ein leises Gnä’ Frau genügt; immer zur Teestunde geschieht das, nach längerem Sichfeinmachen in dem Gasthofzimmer, in das man mittags aus der Badeanstalt Seebichel geflüchtet ist, wenn dort alles zu viel wurde, die Leute, die Sonne, die Fliegen. Das Zimmer unter dem Dach mit seiner Mittagsluft zum Ersticken ist eine Höhle, in der man die Welt hinter sich lässt; das Infantenkind hockt zwischen den Kniekehlen der Mutter und folgt den eigenen Blicken, wohin sie fallen, mit seinen Fingern, mit dem Bleistift – im Übrigen ein Vorgehen mit links, wie ein verfrühter Triumph des geborenen Linkshänders, der unter Druck mit rechts das Schreiben lernen sollte (und gleichwohl bis heute nur mit der richtigen falschen Hand sich die Zähne putzt oder einen Regenschirm hält, telefoniert oder imstande ist, jemanden zu streicheln).
Die linke Hand, geschickter zwar, aber anfälliger für Versuchungen, gehörte der Mutter, die andere, unbeweglichere, dafür mehr der Vernunft verbunden, dem Vater. Ihm fehlte das rechte Bein, nicht das linke, und seine Erfahrung war, dass man nicht den Mangel auf der einen Seite durch besondere Artistik auf der anderen ausgleichen kann, es blieb immer ein leichtes Hinterherhinken mit dem Holzbein – für den kleinen Sohn ein Mysterium, besonders der Halt des schweren hölzernen Beins am narbenfaltigen Stumpf. Und jedes seltene Wort des Vaters über den Verlust des richtigen Beins, etwa dass ihm bei einer Schlacht im Winter ein Stahlsplitter von seinem getroffenen Panzer ins Knie gedrungen sei, ohne dass er mehr gemerkt habe als etwas Warmes im Knie, wiegt wie die wenigen Worte der Mutter in dem gemeinsamen Mittagsbett. In das Kind aber dringt damit ein Stück Sprache, an dem es sich fortan bis zur stillen Ekstase reiben kann, wenn es an das fehlende Bein des Vaters denkt, wie es wohl ausgesehen haben mochte und wie sich der narbige Stumpf anfühlt, oder wenn es das mütterliche Schlaflied echohaft nachsingt, um sich an Nachmittagen ohne Anfang und Ende, die Schauspielerinmutter bei der Probe, aufzulösen in der inzwischen elterlichen Wohnung am sogenannten Grindelberg. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck’: Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ganz und gar unbegreifliche Worte sind das (alte Volksworte aus Des Knaben Wunderhorn), Rätselbilder, Rätselwörter, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt. Abend für Abend singt Damemammi, zurück von der Probe, am Kinderbett mit leiser, vom eigenen Gesang gerührter Stimme diese Zeilen, bis damit Schluss ist, sie abends wieder Theater spielt. Doch das Kind weiß sich zu helfen, es singt einfach selbst, es bemuttert sich. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, singt es gegen die Wand gedreht, eine Tapete mit den Konturen von Segelschiffen. Der Glaube an die, die ihn abends in den Schlaf singt, und sein Glaube an Gott sind durch nichts zu erschüttern, auch nicht durch das Alleinsein, ja, sein Ertragen des Fehlenden zeigt nur das Weitreichende der Mutter, ihren beruhigenden Schirm, sonst würde es ja in der Wohnung toben, treten, sein Spielzeug kaputt machen und müsste, wie alle Unartigen, in den Kindergarten und könnte nicht mehr an der Hand seiner großmütterlichen Hüterin nach Belieben durch den nahen Innocentiapark bummeln und sich über die, die dort in Reih und Glied unter Aufsicht eines ältlichen Fräuleins marschieren, lustig machen: Kindergarten, Schweinebraten! Also lieber vor sich hin singen, zur Tapete gedreht, lieber all die Schiffe zählen und ihre Linien mit dem Finger nachfahren.
Im Leseraum des kleinen alten Hotels, in das meine noch jungen Eltern vor dem Leben geflüchtet waren, ohne die Flucht zu bemerken, nur ihr unverhofftes Glück während der letzten Sonnentage an der Blumenriviera, einem holzgetäfelten Raum mit Messingschildchen an der Tür, camera dei libri, fand sich, zwischen Liebes- und Kriminalromanen in den verschiedensten Sprachen, auch ein Werk von Freud auf Italienisch, Psychologie des Unbewussten, Psicologia dell’inconscio, eine alte Ausgabe, gut erhalten. Und ihrem Erscheinungsjahr nach, dem meiner Geburt, könnte sie längst in der kaum geordneten Büchersammlung der camera dei libri gestanden haben, als meine Eltern in dem Hotel waren, mein Vater sich auf dem Balkon sonnte, Wein und Zigaretten bei der Hand, und meine Mutter mit Sicherheit auch im Leseraum saß, am bevorzugten späteren Nachmittag in einem von drei Sesseln, kaum jünger als die Freud-Ausgabe – vom Sohn Seite für Seite durchgesehen, als wäre darin ein Hinweis zu finden, eine Art Bücherflaschenpost, die nicht nur beweisen könnte, dass seine junge Mutter hier war, sondern auch belegen, dass ihr der Name Freud zu der Zeit schon etwas sagte und sie vielleicht, obwohl es eine italienische Ausgabe ist, glaubte, beim Blättern darin würde sie daraus etwas anwehen: ein Hauch von Verständnis für sich selbst, das Unglück hinter ihrem Glück in diesen Tagen.
Der Sohn hat es da leichter, er ist damit erwachsen geworden, sich weit zurückzuerinnern, und weiß, dass jeder Blick auf das eigene früheste Glühen ein Lüften von Vorhängen ist, ohne dass sich je die ganze Bühne von einst öffnet – und dass der große Wiener Erinnerungsforscher durch die neue und zugleich mythische Sicht auf das erste Liebesgeschehen ebenso viel Verwirrung gestiftet hat wie Wege bereitet, sich diesem Geschehen erzählend zu nähern. Und damit weiß er auch, dass jedes Erzählen von Eigenem immer ein Stück Theater ist, es gibt kein Jenseits davon, man selbst ist Teil der Handlung und führt sein altes Drama auf. Da ist der gültige Sommer, da sind die Berge und der Moorsee und die hölzerne Badeanstalt; und da ist mittags, im gedämpften Licht, der Körper der jungen Schauspielerin, die auch die Mutter gibt, den Text dazu kennt, die Lieder, die Gesten, den Sohn erst gewähren lässt, dann in den Schlaf singt, ihm die Idee der Liebe zu ihr souffliert, bis er, liebestextsicher, auf seiner unsichtbaren Bühne steht – die noch im selben Sommer zu einer sichtbaren wurde.