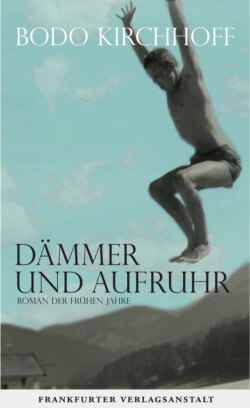Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление6
Der Name des neuen Lebensorts südöstlich von Freiburg im Dreisamtal erschien mir als Willkommensgruß oder Verbeugung vor meinem Familiennamen, eine Auffassung, die dem bald Siebenjährigen half – endlich war ich in die Schule gekommen, zu anderen, echten Kindern, etliche noch barfuß unterwegs –, damit fertigzuwerden, dass sein weltenferner norddeutscher Vorname bei den Dörflern zu einem landläufigen Bruno wurde. Und wem das so fremde Kind mit Baskenmützchen auf einer der noch ungeteerten Dorfstraßen über den Weg lief, der sah es an und fragte: Wem g’hörsch au’ du?
Der Umzug in den Schwarzwald im Frühsommer fünfundfünfzig, die kleine Schwester noch keine drei, hat alles bisherige Kindsein buchstäblich gesprengt. Wir wohnten in den ersten Monaten, während des ganzen Sommers bis in den Herbst hinein, auf jenem Hug’schen Hof weit außerhalb von Kirchzarten, einem Bauernhof mit Getier aller Art in Verbundenheit mit den Menschen. Da gab es Schweine im Pfuhl und ein sich drängendes Vieh in warmer Stallung, gewaltige Gäule, dampfend um ihre Nüstern, und Puter mit rot schwellendem Kropf; es gab einen Höllenhund und zahme Kaninchen, rundliche Ferkel und eine gewaltige, kaum auf die kurzen Beine kommende Sau; es gab Hühner und Gänse, Katzen und Mäuse und Kälber mit Augen, die das Stadtkind vertrauensvoll ansahen. Und inmitten all dieser Lebendigkeit, wie dessen Achse, fuhrwerkte ein Altknecht, der Blasius, genannt Bläsi, für die Geschwister eine Art Zentaur durch seine Figur und eine tierlautartige Sprache. Er saß entweder auf dem Traktor oder war im Stall zu finden, wo sich auch der frisch Eingeschulte oft aufhielt und gebannt zusah, wie sich das Vieh gleichmütig entleerte. Die Volksschule lag mitten im Dorf, der Weg dorthin mit einem Ranzen auf dem Rücken, jeden Morgen, kam mir unendlich weit vor, nur gab es bis zu den Sommerferien einiges nachzuholen, weil die anderen schon seit Ostern eingeschult waren, Buben und Mädchen, und die Gescheiteren bereits alle Buchstaben auf ihre Schiefertafeln schreiben konnten. Der Neue hinkte hinterher, dafür gewann er einen ersten Freund, seinen Banknachbarn mit rotem Haar und Sommersprossen, Bertram Auerbach aus einer richtigen, großen Familie, fünf Kinder, die Eltern und eine Oma, alle unter einem Dach; noch war es keine Alltagsfreundschaft, der eine wohnte im Dorf, der andere außerhalb. Aber wenn der Junge aus dem fernen Hamburg abends mit Vater und Mutter, kleiner Schwester und Kindermädchen, den Knechten des Hofs und den alten Hugs, denen alles gehörte, um den bäuerlichen Tisch saß, versuchte er, immer ein Wort von der so fremden Sprache aufzugreifen, um es am nächsten Tag in der Schule anzuwenden und den Banknachbarn vielleicht noch mehr zu gewinnen.
Unvergessen, wie ich erstmals den Sinn eines Ausdrucks erfasste, der jeden Abend beim Essen fiel, wenn der alte Bauer den jungen Knechten oder auch seinen Logiergästen etwas erklärte, vom Wetter, vom Vieh, vom launischen Herrgott, und die kleine Rede stets mit diesem dunklen Ausdruck oder Wort, vuhdämmhär, beschloss, was ja nur heißen konnte: von da her oder deshalb – für einen, der die Welt durch die Sprache entdeckt hat und dem die Sprache darum als Welt erschien, ein Kinderspiel. Alles andere als ein Spiel, die Nagelprobe war es dagegen, den neuen Ausdruck am nächsten Tag in der Schule tatsächlich zu gebrauchen, möglichst mit der gleichen, leicht dunklen und versteckt besserwisserischen Stimmlage am Ende einer Erklärung, etwa der für meinen seltsamen Namen: Weil man mich nach einem Onkel in Amerika benannt habe, als Dank für seine Care-Pakete nach dem Krieg, vuhdämmhär. Und dieser so welterschließende Sprechakt wurde am abendlichen Esstisch dann wiederholt, zum Schrecken und Entzücken meiner Mutter, während die Knechte immerhin aufsahen von den Holztellern mit Speck, den sie von der Klinge ihrer Sackmesser aßen – noch ein Wort, nach dem ich schnappte. Mein Vater trank zu dem Speck den Wein der Gegend, und die Schauspielerin ohne Bühne machte mit den Knechten Konversation, in einem Operettenwienerisch, das in völligem Gegensatz stand zu der Sprache, die der frisch Eingeschulte sich anzueignen bemüht war, eine Sprache, die das sehr hamburgische Kindermädchen – damals Mitte zwanzig – noch mehr in Heimweh stürzte, auch wenn sie sich zusammennahm beim Essen, nur unter der Brille die roten Augen rieb, zitternd in den Brüsten, wenn sie ein Schluchzen unterdrückte für meinen Vater (der bei Gelegenheit ihr heimlicher Tröster werden sollte).
Der große Hof mit seinen Stallungen hatte viele Neben- und Zwischenräume, Gelasse im Boden und Kammern unter dem Dach, ich könnte nicht sagen, wo und wie wir dort gewohnt haben; umso genauer dafür die Erinnerung an Geräusche und Gerüche und immer neue Wörter, die mir zuflogen. Neben all den Tierlauten und den Wolken von Gülle und Heuduft oder dem von Most aus Krügen gab es aus jedem Mund das Alemannische wie eine Musik, die ich aufnahm. Und oft mischten sich Wörter mit bis dahin unbekannten Gerüchen wie dem von altem Zeitungspapier, in handlichen Fetzen auf einen Nagel gespießt, und feuchtem Holz in Gestalt eines Verschlags, darin ein Sitz mit Loch in der Mitte: der Abort, wie die Toilette auf dem Hof und auch in der Schule hieß, gesprochen mit doppeltem B und leichter Verschleppung des A. Unvergessen mein erster Blick in die Grube unter dem Loch im Holzsitz, auf ein bräunliches Schimmern in der Tiefe, und wie der alte Hofbauer, Pius Hug, dem Hamburger Jungen, dem es grauste vor dem Verschlag voller Spinnweben und Gestank, Verständnis entgegenbrachte, mit wunderbaren neuen Worten: Wenn de nur saiche musch’, Bub, brusch’ it auf de Abbort, gohsch’ dehinder.
Es war der Nachklang dieser Sprache, der den Buben zu tragen begann auf dem täglichen Weg zur Schule, der ihn aber auch in Erregung stürzte wie in ein Lampenfieber, weil es galt, in der Schule, genau diesen Klang zu treffen, ohne als Betrüger dazustehen; ich ging den langen Weg vor mich hin murmelnd, ein Repetitorium im Gehen, immer in dem Bewusstsein eines möglichen Skandals. Der Hof lag, wie gesagt, weit außerhalb des Dorfes, etwas erhöht an einem Hang, der Weg führte zunächst ein Stück bergab und dann durch Wiesen und schon wogende Felder vorbei an zwei Kruzifixen, das erste aus rostigem Eisen, wenig vertrauenerweckend, das zweite aus altem bemoostem Stein hinter einem Brückchen über den Rotbach, und vor diesem schöneren Kreuz blieb ich immer stehen für ein Gebet: dass mein Vater mich abholen möge von der Schule. Und manchmal wurde das Gebet erhört, ich kam mittags aus dem Gebäude, und da stand schon der graue VW, aus dem Fahrerfenster hing ein gebräunter Arm mit Zigarette in der Hand, welch eine Rettung. Meistens aber blieb nur der Rückweg zu Fuß, der Bub mit Ranzen trödelte durch die Wiesen und Felder, die Mittagssonne warm im Rücken, nicht ahnend, was sich dabei schon in ihm sammelte, ein bleibendes Empfinden von Heimat – das ist mein Tal, mein Boden.
Erst eine höhere Gewalt beendete diesen prägenden Schulweg: Ich kam unter eins der Pferde auf dem Hof, durchgegangen, weil es der launische Herrgott so gewollt habe. Es galoppierte über mich hinweg – bühnenreife Schreie meiner Mutter, während mein Vater wie auf zwei Beinen heraneilte. Er trug mich zum Auto, ein aus Wunden an allen Körperteilen blutendes Kind, er stoppte die Schreie der Mutter und lud sie mit ein, tat, kriegserprobt, das Nötige und fuhr rasend dorthin, wo mit Hilfe zu rechnen war, zum Dorf, und bei dem ersten, dem rostigen Kreuz kam es zum Zusammenprall mit einem entgegenbrausenden Motorrad. Der abgeworfene Fahrer wurde gleich mitgenommen, zwei Blutende saßen jetzt im Wagen, und natürlich wusste der Einheimische, wo der Dorfarzt wohnt, und meine Mutter dankte laut dem lieben Gott für das Glück dieses zweiten Unfalls, der mich ohne Umweg in rettende Hände brachte. Es waren die Hände von Dr. Eckart mit großem Haus, von da an unser Kontakt in Kirchzarten, bezahlt mit meinen Wunden, die aber so eindrucksvolle Verbände nötig machten, dass ich von den restlichen Schultagen vor den Sommerferien befreit wurde. Und auf einem Bett im Schatten eines Apfelbaums – dem ersten Bett, das je auf dem Hug’schen Hof ins Freie gestellt wurde, durchgesetzt von meiner Mutter – lernte der allseits bedauerte Patient unter bestmöglichen Umständen die ihm noch fehlenden Buchstaben des Alphabets mit der für ihn falschen Hand zu schreiben. Nur das Alphabet an sich, die richtige Reihenfolge der Buchstaben, hat der vom Unterricht Befreite zu lernen versäumt, jedenfalls ab dem N, ein Mangel, der sich nicht beheben ließ, der sich immer wieder zeigt, und wenn es hier nur im deutsch-italienischen Wörterbuch ein Wort etwa mit R am Anfang zu suchen gilt – R wie Reibeisen, grattugia, um dem afrikanischen Zimmermädchen zu erklären, warum ich für den Balkonstuhl ein Sitzkissen möchte.
Es war ein Frühsommer der Rekonvaleszenz in der bäuerlichen Umgebung, einer Aneignung der neuen Welt von meinem Lager aus. Aber kaum waren die Wunden etwas verheilt, begann ich mit Streifzügen rund um den Hof und erlebte die erste Ernte, das erste Gewitter, den ersten Gewaltausbruch, eine Prügelei zwischen Jungknechten, und auch das erste geschlechtliche Schauspiel: Eine der Mägde, die für einen Unbekannten mit schwarzem Hut den Rock hob, sich ihm darbot mitten am Nachmittag, ihm das behaarte Geheimste zeigte und die Möglichkeit gab, sich an sie zu pressen, ohne den Zeugen im Heu zu bemerken. Von da an war es eine Zeit des verstörten Alleinseins, mit immer ausgedehnteren Streifzügen in die Umgebung – ich sprach mit mir selbst, wie die Leute auf dem Hof sprachen, die neue Sprache wurde mein Begleiter. Es war eine Zeit der Entdeckungen, von meiner Mutter im Ehejahresbericht nur mit wenigen Sätzen aus ihrer Scheuklappensicht erwähnt: Wir lebten auf einem wunderschönen Bauernhof, unser kleiner Sohn lernte dort Lesen und Schreiben. Wir aber gingen ans Werk und versuchten, aus dem Hoffnungsfaden, der uns nach Freiburg gezogen hatte, ein Tau zu machen. Privat kam uns dabei ein Wunder zu Hilfe, wir fanden in Kirchzarten ein Haus mit Garten, das wir nach dem Sommer beziehen konnten, die Besitzerin, eine liebe alte Dame, hat ihr Zimmer unter dem Dach. Wieder einmal war es ein Aufatmen, und das Wunder für die Firma, dachten wir, würde bald auch noch kommen. Man muss an solche Wunder nur fest glauben!
Das Haus lag in der Höfener Straße vierundzwanzig, und die liebe alte Dame war schon etwas umnachtet, für meine Schwester und mich war sie nichts als unheimlich, zumal sie nie in Erscheinung trat, ein Art Gespenst oben im Haus, ein Haus, mit dem wir Kinder Glück hatten durch den alten Garten (groß genug, dass dort längst ein weiteres Haus steht), ein Garten mit Obstbäumen, einer Tanne und Kieswegen, ja sogar einem kleinen verwilderten Labyrinth, angelegt aus mehreren Hecken, und dann gab es noch eine hohe Birke, deren Äste über einen Schuppen ragten, meinem Spielreich. Inzwischen hatte die Volksschule wieder begonnen, und durch eine neue Aufteilung von Jungen und Mädchen kam ich in eine Klasse mit der Tochter des Arztes, der mir die Wunden aus dem Frühsommer behandelt hatte – Doris Eckart, weichwangig, katzenäugig, dazu mit schönem Mund und Pferdeschwanz, erfüllte alle Voraussetzungen für die ersten schwärmerischen Gefühle. Und als dann auch noch im großen Haus ihres Vaters ein Zimmer für meine aus Hamburg nachgezogene Hüterin frei wurde, dort ein neues Exil entstand, ich wieder pendeln konnte zwischen dem Machtbereich der Eltern und einem Schlaraffenlandzimmer mit dem summenden, halb singenden Atmen der einstigen Sängerin, mit ihren so verlässlichen kleinen Geschenken und all den Extramahlzeiten, war dort einer Kinderliebe Tür und Tor geöffnet. Immer wieder saß ich auf den Stufen zum Arzthaus neben Doris, ergriffen von ihrer Schönheit, und im elterlichen Garten spielte ich mit dem Schulbanknachbarn Bertram, endlich um die Ecke wohnend, ergriffen von der Idee der Freundschaft: das erste Stück einer nicht weiter auffallenden, einer gewöhnlichen Kindheit – von der Chronistin dieser Zeit mit keinem Wort erwähnt. Im jährlichen Ehebericht meiner Mutter, dem für das Jahr neunzehnhundertfünfundfünfzig, geht es fast nur um die Finanznöte der kleinen Firma, von welcher Seite mit welchen Mitteln etwas Geld besorgt werden könnte, mal fünftausend Mark, mal zehn- oder achttausend, jeweils Beträge, die alles hätten zum Besseren wenden können – Dieses ständige Zittern, ob es uns morgen noch gibt, heißt es da an einer Stelle, dieser tägliche Kampf um etwas Balance, den nächsten gesicherten Tag! Und war es wieder einmal in letzter Sekunde geglückt, ein Finanzloch zu stopfen, dankte die Verfasserin in großen Lettern dem lieben Gott: der fest an ihrer Seite stehe, immer. Sie und ihr bewunderter Mann und Gott als Retter in höchster Not waren die Hauptakteure in dem Bericht, die Kinder blieben im Hintergrund, als Glückslieferanten. Zweifellos gab es eine Liebe für sie, überschäumend, ein Auge für ihr Tun gab es nicht, weder für den Sohn, der schon in einer eigenen Welt lebte, mehr mit sich sprach als mit anderen, noch für sein Schwesterchen, das weiter die Schaukelbewegungen machte, sich nur langsam von dem Familienhinundher ihrer ersten Jahre erholte – auch das ein täglicher Kampf um Balance. Der große Bruder fand seinen Ausgleich dagegen auf dem niederen Dachboden des Gartenschuppens, in einem dämmrigen Reich, das er zu gestalten anfing, indem er seine frühen übermächtigen inneren Bilder nach außen kehrte: Ich baute mir dort eine Geisterbahn.
Die kleine Schwester, nunmehr vier und im Kindergarten, behielt ihr Los, eben kleine Schwester zu sein, hintanzustehen, für sich, während der Bruder die Gespenster tanzen ließ, vor Augen noch das Bild der Mutter, nackt auf dem Holzbalkon, rote Blüten auf den Lidern, vor Augen auch das blonde Mädchen aus Moorfleet mit heruntergezogener Hose, wie es sich zappelnd der Bestrafung beugt, die Bilder der Magd, die den Rock hebt und den Mann gewähren lässt, seine Stöße empfängt, oder die Köpfung eines Huhns vor dem Hofabort. Und so entstanden Nachempfindungen in Form von Installationen unter dem Schuppendach, schauderhaft wie das Gerippe in der echten Geisterbahn, wenn es jäh erscheint, ein Bilderparcours, um damit den eigenen Schauder zu vertreiben. Da gab es Puppenbeine an Drähten und einen Stoffbären ohne Augen; es gab eine entkleidete Puppe, aufgespießt auf einer Gabel, aber auch einen nassen Lumpen, der von einer der Latten herunterhing. Und als Höhepunkt gab es ein Hinterteil wie das des bestraften Mädchens, geformt aus Knetgummi, allen vier Stangen einer Packung, der roten, der grünen, der blauen und der weißlichen (noch ein Kindheitsgeruch: Knete an den Fingern), einen Po mit brennender Kerze darin. Ihr Licht war das einzige auf dem Dachboden, durch den man nur kriechen konnte, und es grenzte an ein Wunder, dass der ganze Schuppen bei diesem so ernsten Spiel – mit der unerschrockenen kleinen Schwester als erster Besucherin der Geisterbahn – dabei nicht abgebrannt ist.
Alles, was mit Feuer zu tun hatte, jede Flamme unter meiner Kontrolle, schlug mich in ihren Bann – einen Jungen, der nun schon fast wie die anderen in der Klasse sprach, aber nicht wie die anderen war, etwa das Foto von sich und dem größten Boxer bei sich trug. Ich stand mit Freund Bertram und dessen Brüdern im Herbst vor einem der Kartoffelfeuer auf den nahen Feldern, fachte es mit an, dass die Funken sprühten, und das Beweisfoto steckte in meinem Anorak; ich spielte mit Doris, der Arzttochter, zündelte auf den Stufen zu ihrem Elternhaus und suchte nach einer Gelegenheit, meine Berührung mit der Filmwelt zu erwähnen. Bisher hatte ich das Foto nur Freund Bertram gezeigt, ihm als Geheimnis anvertraut; ich hielt es zurück wie einen Trumpf, den auszuspielen jederzeit rettend sein könnte, besonders auf dem jetzt zwar kurzen, aber dafür gefahrvollen Schulweg, gefahrvoll, weil dort auch ältere Jungs liefen, solche, die in der Schule wegen Frechheit Stockhiebe bekamen, bis sie brüllten, und die ihre Prügel nach der Schule gern weitergaben. Dieser Weg über eine noch ungeteerte Dorfstraße führte vorbei an einem Haus mit gelegentlich eigener Schlachtung, mal schrie dort ein herbeigezerrtes Schwein, mal stürzte das Gedärm aus einem aufgeschlitzten Leib; außerdem war da noch eine Blechnerei, vor der immer Lehrlinge standen und rauchten. Und eines Tages packten sie den Bruno, der ich war, den Imitator des Alemannischen, und stießen ihn vor sich her in den Werkraum, dort sollte er in ein gerade gefertigtes Rohr Sätze nachsprechen, und er glaubte, sich aus der Affäre ziehen zu können, indem er seinen Trumpf auswarf und Ich! sagte, mit der ganzen Impertinenz dieses persönlichsten Fürworts – Ich und Max Schmeling. Die Lehrlinge aber beugten sich über das Foto und befanden es für unecht, für Aufschneiderei, erst das Autogramm auf der Rückseite tat seine Wirkung: Der Kräftigste versetzte dem Filmkind einen Hieb, dass es umfiel. Er wollte es prüfen, prüfen, ob der Boxer ihm etwas beigebracht habe, aber es gab keine Gegenwehr, nur ein leicht entrüstetes Heiland, wie ich es bei anderen, wenn sie etwa im Schwitzkasten waren, gehört hatte. Und da drückte der Schlägerlehrling den Aufschneider mit dem Mund an die Rohröffnung und sprach ihm Wörter vor, die er laut rufen sollte, Brutsäckel, Arschlecker, Futt, und er rief sie ins Rohr, nur genügte das noch nicht. Er sollte auch eine Gotteslästerung rufen, etwas vom Vaterunser, fast die Worte, für die ihn seine Mutter mit dem Holzbügel geschlagen hatte, Vaterunser, der du bist im Arsch, sags, Kerle! Er drohte, das Foto zu zerreißen, also rief ich die Worte ins Rohr, einmal, zweimal, dreimal, dann durfte ich gehen, samt Max Schmeling: der mir nicht hatte beistehen können und von da an zu Hause blieb, verwahrt in meiner Geisterbahn auf dem Dachboden des Schuppens.
Und noch unter dem Eindruck dieser erteilten Lehre in der Blechnerei auf dem Hinweg zur Schule bin ich an dem Tag gar nicht in die Schule gegangen, sondern weiter auf der Straße, die Schulstraße hieß und am Ende in einen schmalen Weg zum Haus von Dr. Eckart führte. Ich floh zu meiner Hüterin, so zuverlässig in ihrem Zimmer, wie meine Eltern abwesend waren (beide ganztägig in dem gemieteten Firmengebäude unterhalb der stillgelegten Bergwerkshalde). Sie lag noch im Bett mit einem Kreuzworträtsel, als ich auftauchte, und ich erzählte ihr nichts von dem Vorfall, ich sagte nur, mir sei nicht gut, ich wollte nicht in die Schule, und sie setzte gleich Wasser auf für eine Wärmflasche. Und als wir dann beide im Bett lagen, sahen wir uns Fotos aus der letzten Sommerfrische an – in den großen Ferien war ich jetzt wieder Begleiter von Mutter und Großmutter in der Gegend von Kitzbühel, als hätte es meine Schwester noch nicht gegeben. Die kleinen Schwarzweißfotos zeigen immer nur den Jungen in Gesellschaft von einer, zwei oder drei Frauen, im Dirndl, im Kostüm, im Badeanzug, und über eins der Badebilder hielten wir ein Vergrößerungsglas, das Glas, das sonst dazu diente, Garn durch ein Nadelöhr zu fädeln, um mir etwa einen abgerissenen Knopf anzunähen, den außerhalb meines süßen Exils niemand angenäht hätte.
Der Junge und seine Hüterin stehen auf den Planken der Badeanstalt Seebichel am Schwarzsee. Sie – Jahrgang 1896, Anfang sechzig zu dem Zeitpunkt – in gewagtem Einteiler, die Schulterpartie frei, den Enkel halb vor sich; er, die Hände verschränkt wie zum Gebet, in schwarzer wollener Badehose, abstechend vom hellen Bauch. Und fast milchweiß ist auch die Haut der Frau, die ihn vergöttert, eine ihrer großen Brüste ist unter dem Badeanzug erkennbar, die andere bedeckt der kindliche Kopf, als wäre das runde Gesicht Teil ihres Fleisches. Ebenfalls gut erkennbar: das nasse, angeklatschte Pagenhaar des Jungen, während das Haar seiner Beschützerin wirr absteht – sie fand sich schirch auf dem Foto, nicht eben hübsch, einer ihrer wie aus einer reicheren Welt geretteten Ausdrücke, die in mir, noch vor dem Alemannischen, eine semantische Manifestation geschaffen haben, einen intimen Vokabelschatz (inzwischen nur noch mit der kleinen Schwester von damals geteilt – zwei, denen eins dieser Wörter schon reicht, damit sie mit ihrer unsterblichen Großmutter beim Abendbrot sitzen).
Wörter, keine Worte, die sich weitergeben ließen ohne eine Geschichte dazu, auch wenn ich sie bei Gelegenheit vor den eigenen Kindern gebraucht habe; die schüttelten dann nur etwas den Kopf, und der Erwachsene war versucht, ihnen ein Verzeichnis der Kleinode aus diesem Sprachschatz zu erstellen, nach dem Alphabet der Erinnerung, einer Reihenfolge, für die es keine Algorithmen gibt, um ihrer Logik beizukommen, höchstens den unterschiedlichen Herzschlag beim Schreiben des einen und anderen Worts. Ein Feudel, so hätte mein Verzeichnis anfangen können, ist ein Lappen, und Potschen sind Hausschuhe; der Römmel ist ein Popel, und Polken ist das Nasebohren. Zippi heißt das Geheimste beim Mädchen, Schwaffl das beim Buben und der Halbschlaf im Sessel heißt bei ihr Tunken, ferner ist Urschel eine blöde Kuh, Hermper die große Nase, dährisch ist schwerhörig, und Hatschen meint langsames Gehen. Lulatsch heißt jeder ab eins achtzig, Nachtkastel jedes kompakte Kind, und ein mageres ist und bleibt ein Krischpirdel, dagegen jedes dicke Mädchen eine Plunzen; wenig nett auch das Wort mirchdeln, gemeint ein Ausdünsten als gesamte Person, und ebenso unfreundlich der Ausdruck HabedieEhre, eine klare Abfuhr, während Abpfirten die Zeremonie der Verabschiedung meint, das Kreuzerlmachen, auf dass man sich wiedersehe. Und wenn meine Hüterin mit mir am Sonntagnachmittag ins Kirchzartener Kino ging, in die Dreisam-Lichtspiele, wir in der fußfreien Reihe saßen auf den teuersten Plätzen für zwei Mark, vor uns auf den billigen die Halbstarken aus der Blechnerei und anderen Betrieben im Dorf, darunter immer auch ein Lulatsch, der für freies Sehen den Platzwechsel erforderlich machte, und alle im Kino auf Peter Alexander und Gunther Philipp oder Sissi, die junge Kaiserin, warteten und endlich das Licht im Saal schwächer wurde, sagte sie, selbst schon etwas dährisch, mit unüberhörbarer Stimme: Also, wenn du noch einmal wiescherln musst, dann jetzt!
Frühes Beschütztsein durch eine intime Sprache heißt auch, von ihr umschlungen zu bleiben und sich in dieser Fessel zu zeigen: als einer von gestern – das Kopfschütteln der Kinder, wenn ihr Vater bei Gelegenheit auf diese Sprache, nach außen hin zum Spaß, im Grunde aber allen Ernstes zurückgegriffen hatte, war das Kopfschütteln über seine nur lose Verankerung in der Gegenwart; ja, eins dieser Wörter reicht wie ein Geruch von früher, um mit seinem Klang die Gegenwart aufzuheben: Ich sitze auf dem Balkon des einstigen Elternzimmers im Hotel Beau Sejour, weiterhin in milder Sonne, aber bin im Dorf der Kindheit, wo es über Nacht geschneit hat, alles in stillem Weiß liegt; meine Hüterin bindet mir einen Schal um, damit ich mich nicht verkühle, sondern pumperlgesund bleibe – auch zwei ihrer Ausdrücke, verkühlen statt erkälten und die Steigerung von gesund –, und ich eile vors Haus, um mit Doris, der Arzttochter, zu spielen. In der Schule reden wir kaum miteinander, hier aber sind wir ein Paar, seifen uns ein mit dem weißen Pulver, und nachts, im Bett meiner Hüterin, träume ich von Doris und erwache fast mit ihr, während das Frühstück schon am Bett steht, Kakao und eine Semmel mit Wurst.
Die Weihnachtsferien hatten begonnen, also durfte ich auch unter der Woche in dem Exil bleiben, konnte dort etwa Briefmarken sortieren, die mir mein Vater monatlich zusteckte, oft samt Kuvert, Marken selbst aus fernsten Ländern, Chile, Pakistan oder Indonesien, all den Weltecken, in die er seine medizinischen Apparate zu verkaufen versuchte und aus denen abschlägige oder hinhaltende Antworten gekommen waren. Ich löste die Marken im Wasserbad ab und setzte sie in ein dickes Album (das es noch gibt, oben auf den Seiten, in meiner Kinderschrift, jeweils die Ländernamen). Es war kein Einsortieren nach den Gesichtspunkten der Philatelie, es war eins nur nach Größe und Schönheit, darum finden sich vorn in dem Album Marken aus Formosa, dem heutigen Taiwan, mit bunten Paradiesvögeln, aber vor allem die aus Österreich, viele für ein Alpental werbend, immer mit einer Schönen des Tals als Motiv. Und auf der Zillertalbriefmarke war ein Mädchen, das aussah wie Doris mit seinen weichen Wangen und einem Blick für den, der die abgelöste Marke vorsichtig über der Heizung getrocknet hat, um sie dann unter Glas zu plätten und ihr später einen Platz in dem Album zu geben (den Platz, den sie heute noch innehat). Es war ein Tun im Zustand zwischen Wachen und Träumen, oft ganztägig im Schlafanzug; im Winter brannte auch den ganzen Tag eine Stehlampe im Zimmer, herübergerettet aus ihrem Vorkriegsleben, ebenso ein Porzellanpapagei auf einem Sekretär mit Geheimfächern (verloren gegangen wie alles aus jenem großmütterlichen Reich, bis auf wenige Fotos). Eine sich um den Enkel wölbende Welt war dieses Zimmer und seine Bewohnerin mit ihrem aus der Atmung kommenden Vor-sich-hin-Summen, während er Briefmarken aus ihrem geliebten Österreich in eine Hierarchie der Schönheit brachte; und oft wurde aus dem Summen auch ein Wiener Lied, das Überwechseln in ein paar gesungene Zeilen – mit Worten, die einen Jungen von sieben oder acht bereits ahnen ließen, dass alles Schöne einmal ein trauriges Ende hat.
Keine meiner Fantasien in diesen Jahren war schlimmer als die vom Tod der so leise Singenden mit einem schwachen Herzen, über das sie gern klagte, auch wenn es sie gar nicht im Stich ließ, ihr eher als Druckmittel zur Seite stand. Mein Vater dagegen klagte kaum über sein fehlendes Bein, und wenn ihn Schmerzen im Stumpf befielen, er bei Tisch Hüpfer auf dem Stuhl machte, die mir Rätsel aufgaben, sagte er dazu kein Wort, während meine Mutter fast täglich von ihrem Ischiasnerv sprach, so überzeugend wie von einem zusätzlichen Körperteil, das aber außer ihr niemand sah. Dieser Nerv war ihr Besitz und war ihr Widersacher, den der kleine Sohn bekämpfen durfte, wenn keine Masseuse zur Verfügung stand; die Leidende lag dann schon im Elternschlafzimmer bereitwillig auf dem Bett, Pullover hochgestreift bis zu den Schulterblättern, Rock geöffnet und leicht nach unten gezogen, damit die noch kindlichen, noch unausgebildeten, aber schon nicht mehr unschuldigen Hände nach Belieben ans Werk gehen konnten.
Der Körper, in dem man steckt, der eigene, wie es gewöhnlich heißt, ist ein Körper der anderen – mein kindlicher Jungenkörper war besetzt vom Körper des Vaters, wenn wir bastelten oder im Heizkeller Feuer anfachten oder er Auto fuhr und den Motor erklärte, aber auch, wenn er ein Wort zu seinem Holzbein verlor; der zweite Okkupantenkörper war der meiner Mutter, wenn sie mich wusch oder eincremte oder mir einen Schmerz wegstreichelte, aber auch am Badeabend mein verborgenstes Teil nach Lust und Laune benannte. Und der dritte Körper, der mit meinem verschmolz, war der großmütterliche, als hätten wir eine gemeinsame Haut, und ihr problematisches Herz wäre auch meins gewesen, das eines Neunjährigen – ich war in dem Alter, als mein Vater eines Tages mit blinder Wut auf den sogenannten eigenen Körper, den Sohneshintern, einschlug, nachdem mir, auf Verhängung eines Zimmerarrestes hin, etwas aus gewiss nicht heiterem Himmel herausgerutscht war: Die Omi habe ich viel lieber als euch! Der väterliche Ausbruch, einmalig in der Art, war die Wut auf ein Kind, das nicht die Liebe für einen empfand, die man verdient zu haben meinte, indem man eine Firma über Wasser hielt.
Nicht lange nach dieser Züchtigung traten die Herrin meines sichtbaren Körpers und die Hüterin des verborgenen, meine Mutter und meine Großmutter, eine Zugfahrt nach Wien an, für beide die erste Reise an ihren Sehnsuchtsort nach dem Krieg. Mein Vater und ich brachten sie zum Freiburger Bahnhof, wir lösten Bahnsteigkarten für je zehn Pfennig und begleiteten sie durch die Sperre zum Zug, ich trug das Gepäck ins Abteil und konnte mich dort kaum trennen, drückte mich an die eine und an die andere, bis der Schaffnerpfiff ertönte, und beim Hinauseilen auf den Bahnsteig hob sich mein Magen. Beide standen jetzt an ihrem heruntergelassenen Fenster, und als der Zug anfuhr, begann ich, seitlich unter dem Fenster mitzulaufen, erst ganz langsam, dann immer schneller, und das nicht nur vor Abschiedsschmerz. Da lief einer neben dem Zug her, die zwei Frauen seines Lebens im Blick, der im Laufen kleine Schreie ausstieß, als etwas wie aus Bauch und Schenkeln kommend, in einer Körpermitte, die ihm entrissen zu sein schien, umso mehr zusammenströmte, je schneller er lief. Fast ist es ein Rennen auf dem langen Bahnsteig dicht neben dem fahrenden Zug, gefährlich anzusehen, aber der einbeinige Vater kann nichts tun, nur laute Warnungen hinterherrufen, während der Neunjährige jetzt gar versucht, die aus dem Fenster gestreckten vier Hände zu fassen, die Spitzen der Finger, und das Zusammenströmen in ihm wie ein Schwärmen kleinster Vögel zwischen den Beinen ist, so flatternd fremd, berauschend zugespitzt, dass er nur mit den Schreien dagegenhalten kann, nicht aber den irren Lauf stoppen: Er läuft auch noch außerhalb des überdachten Bahnsteigs neben dem Zug, dort, wo der Belag schon von Gräsern gesprengt wird, bis er hinter dem letzten Wagen mit einer Tür ins Leere und den Schlusslichtern herrennt und nur noch von weitem die winkenden Hände sieht und den Duft des warmen Gleisschotters atmet und etwas aus seinem Innersten wie durch ein Öhr in die Weltleere um ihn strömt, als glühendes Pissen, während er, nahezu blind, bis an das Ende des Bahnsteigs läuft, die Kante über dem Schotter.
Sicher ist, dass mir sekundenlang schwarz war vor Augen oder mir der davonfahrende Zug samt den Gleisen dahinter schwarz vor Sonne vorkam und dass ich plötzlich glaubte, ganz allein auf der Welt zu sein, nass zwischen den Beinen wie schon einmal, noch in Hamburg, als stiller Zeuge einer Bestrafung, nur jetzt von etwas nass, für das jedes Wort fehlte, jede Idee. Und als wäre damit eine von keinem bemerkte Verwandlung einhergegangen, von etwas in mir, das nie wieder würde wie vorher, ging ich in der Erwartung, verstoßen zu werden, zurück zu meinem Vater, der vor der Wartehalle auf einer Bank saß und rauchte.