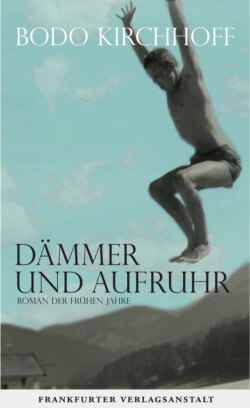Читать книгу Dämmer und Aufruhr - Bodo Kirchhoff - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Wer spricht da, wenn einer von früher erzählt, auf sein erstes Glühen in der Kindheit blickt, wessen Stimme macht hier den Anfang, sagt Es war einmal – ein unvergesslicher, gültiger Alpensommer. Jubelrein der Himmel, wie gestochen die Berge, die Spitzen, hell ihre Hänge und Matten, bläulich der Wald darunter, dunkel ein Moorsee zum Baden; und oberhalb des Sees ein Gasthof mit Gewölbegang, davor zwei Liegestühle auf fetter Wiese, in einem, das Gesicht verdeckt, ein Kind mit Sonnenhut, im anderen die noch junge Mutter, tagelang seine Allmächtige. Der Hut gehört ihr, das Kind trägt ihn samt der Idee, ihn zu tragen, wie es auch, ganz kleingeduldiger Kavalier schon, die Badetasche trägt, wenn es zum See geht. Fiebrige Tage sind das, eins fließt ins andere, das Himmelsblau ins dunkle Wasser, tanzender Heustaub im Hausgewölbe in das Wirken einer Spinne, der Glanz ihrer Fäden in den Schimmer der Mutterbeine. Sie sonnt sich in Shorts, welch ein Wort aus ihrem Mund. Beim Aufbruch zu dem Gasthof war sie noch im Wollrock trotz der Hitze am späten Vormittag, als alles Sichtbare schon etwas Vollendetes hatte, der Wald, die Wiesen, die Almen, darüber das Geröll, der Fels – Herrgott, ist das schön!, ihr verzückter Ausruf oder die denkbare Zeile unter einem Foto von Mutter und Sohn, Frühsommer zweiundfünfzig.
Die junge Mutter präsentiert sich, Hände an den Hüften, der Kamera, darin ein Rollfilm, sechs mal neun, schwarzweiß, während das Kind, blinzelnd blicklos, am Rand eines Feldweges auf dem gemeinsamen Koffer sitzt – eine Abschiedsszene, aber Abschied von wem? Das Foto zeigt nur, wo die Szene stattfand, in der Umgebung von Kitzbühel, mit dem Wilden Kaiser im Hintergrund. Die Erinnerung reicht jedoch über das Bild hinaus, sie hat auch eine Tonspur, und da gibt es noch einen zweiten Ausruf, ein Abschiedswort als Stoßgebet, wie es nur von der Wiener Mutter der Mutter gekommen sein kann: Gott beschütz dich und die Mammi! Das saß. Lange vor der Schule, dem Alphabet, zerlegte der so Beschützte die Wörter, die ihn umschwirrten, Mammi, Kitzbühel, Gott; kein Ich ohne Sprachtheater, und das leichteste Spiel hatten die Selbstlaute, das A, das I, das Ü, das O. Erst will man den klangvollsten Buchstaben, später das letzte Wort – als der, der sich hier erinnert, längst Vater der Frau mit Kind und Koffer hätte sein können, erschien ihm die Anrede Mutter als einzig schlüssige, wann immer er die besuchte, deren Sommerkavalier er einst war. Nur gab es noch ein späteres Wort, das aber nicht dem gehörte, der es aussprach – wenn ich leise stockend am Telefon Mütterchen sagte, Mütterchen, wie geht es dir heute?
Die junge Frau auf dem Abschiedsfoto ist Schauspielerin, Ende des Sommers wird sie in Hamburg wieder auf einer Bühne stehen. Ihr Fach: die flattrige Schöne, die dem Helden den Kopf verdreht, die noch verpuppte Dame, auch dafür hat der kleine Sohn schon Augen, sie sind ihm früh geöffnet worden, Schau, das bin ich, die rauchende Dame auf dem Zeitungsbild! Dazu kommt noch eigener Eindruck, wenn er im Souffleusenkasten des Deutschen Schauspielhauses sitzen darf; dort hört er die vertraute und doch andere Stimme von der Bühne und sieht die Beine der Dame Mammi – zwei Wörter, zusammengeschnürt ein treffliches Wort, Damemammi. Ihre Beine verlieren sich in einem Dunkel unter dem Rock, das für den Dreijährigen schon kein Dunkel mehr ist, weil er auch dabei sein darf, wenn die Mutter massiert wird, entblößt auf dem Bett, mal in Bauch-, mal in Rückenlage. Es ist ein Zuschauen mit großen Augen, Wonneaugen genannt, Augen, denen nichts anderes übrig bleibt, als wieder und wieder hinzuschauen, bis das Erspähte, Geschaute, zur inneren Welt wird, so gültig wie die Sommertage mit Damemammi oberhalb des Moorsees.
Der schönste aller Kitzbüheler Sommer, hieß es mit leisem Seufzen, wann immer das Aufbruchfoto später von Hand zu Hand ging. Erst seufzte die Wiener Großmutter (bis zu ihrer Hochzeit mit einem deutschen Offizier Mitte der zwanziger Jahre Primadonna an der Volksoper in Wien), dann seufzte ihre Tochter, die junge Schauspielerin, und zuletzt der, der sich auf dem Koffer sitzen sah, um sich mit dem Seufzer auch schon erinnerungsselig zu geben: Ja, dieser Sommer, die Tage in dem Gasthof bei Kitzbühel, der Aufbruch dorthin! Mutter und Sohn sind sichtlich zu zweit, mit nur einem Koffer, die Person, die das Foto macht, kommt nicht mit – hätte das auch der Vater sein können? Auf keinen Fall; er ist nicht nur in der Szene abwesend, er ist überhaupt ein Abwesender während der Sommerfrische, wie die Urlaubszeit in der noch wienerischen Welt der Großmutter heißt. Nein, der Vater ist in Hamburg, er versucht dort finanziell auf das Bein zu kommen, das ihm nach dem Krieg geblieben ist; die beiden Frauen, Mutter und Tochter, und der knapp Vierjährige sind ohne ihn mit dem Nachtzug nach Kitzbühel gereist. Erst verbringt man ein paar gemeinsame Tage im Gasthof Vordergrub unterhalb des Kitzbüheler Horns, dann separiert sich die junge Schauspielerin mit ihrem kleinen Kavalier, und bei dem Aufbruch sitzt er in kurzer Lederhose auf dem Koffer, die Hände im Schoß gekreuzt. Zu der Lederhose trägt er ein helles Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, seine Füße stecken in Söckchen und Halbschuhen, die nicht ganz den Boden erreichen, obwohl er auf einem Koffer von nur mittlerer Größe sitzt, in praller Sonne, daher das blicklose Blinzeln; der Koffer wirft kaum einen Schatten, es ist ein Mittag Anfang Juli, um seinen Geburtstag herum. Und dann geht es ein Stück über den Feldweg bis zur nächsten Straße, wo ein mondgelber Postbus für die zwei Fahrgäste anhält. Der Bus fährt nach Kitzbühel hinein, und die Mutter grüßt fremde Leute, die zusteigen. Der dort ist ein Herr, sagt sie dem Kind ins Ohr, und die da ist eine Frau, keine Dame, siehst du’s? Und das Kind nickt und sieht aus dem Fenster. Die Fahrt geht auf ein Tor zu, gleich daneben ist ein Kino mit Schrift über dem Eingang – Lichtspiele, spricht die Mutter mit Theaterstimme. Nach dem Tor geht es bald aus dem Ort hinaus, auf einer Landstraße zum nahen Schwarzsee. Dort verlassen sie den Bus bei einer Badeanstalt, und die Mutter sieht schon den alten Gasthof mit Holzbalkonen und überdachtem Glöckchen auf dem Giebel. Schau, das ist das Glöckchen, das zum Essen läutet, sagt sie. Aber auch läutet, wenn ein Gewitter droht. Und wehe, man ist dann nicht rechtzeitig im Haus, hörst du? Und das Kind lauert von da an auf das Läuten.
Der Gasthof liegt an einem flachen Hang, unten eine Weide für Kühe mit prallem Euter, weiter oben eine Wiese für plustrige Hühner, und durch beides führt ein schmaler Weg. Damemammi trägt den Koffer, aber ihr Begleiter hilft, zwei Hände um einen Griff. Erst vor dem Gartenbereich des Gasthofs wird der Weg breiter und führt an Sträuchern entlang, kleine rote Beeren glänzen in der Sonne, und die Mutter schenkt dem Kind ein Wort, Ribiseln. Sie pflückt zwei der Beeren, nimmt eine in den Mund, kaut sie und schüttelt sich leicht und gibt die andere dem Kind, und es zerbeißt sie und schüttelt sich auch. Und wieder tragen sie beide den Koffer, es geht an Beeten vorbei, darin rote, grüne und blaue Kugeln auf Stöcken, ein buntes Gefunkel. Gegen die Vögel, sagt die Mutter, aber überall zwitschern Vögel, und Schwalben schießen unter dem Dach des Gasthofs hervor. Eine Frau tritt ihnen entgegen, Die Frau Wirtin, heißt es, und die Frau Wirtin begrüßt sie mit einem wie in Nase und Rachen erzeugten Singsang, den die Angekommene sofort nachahmt, ja übertrifft. Als Nächstes erscheint ein Knecht, so wird es dem Kind leise gesagt: Schau, das ist der Knecht vom Haus. Er bittet um den Koffer, damit er ihn aufs Zimmer bringt, so kann es gleich zum Mittagessen gehen, durch den Gewölbegang in die Wirtsstube, wo es nach Fett und Schnittlauch riecht. Sie haben einen Ecktisch, den besten am Fenster, auf dem Tisch ein Glasständer mit einer Vertiefung für Salz und einer für Pfeffer und in der Mitte einem Hals, aus dem Zahnstocher ragen; und die Teller mit dem Essen, das schon gebracht wird, haben ebenfalls drei Abteilungen, für das Schnitzel, für die Erdäpfel, für den Gurkensalat. Zu trinken gibt es ein Kracherl in der Farbe der Ribiseln, so prickelnd auf der Zunge wie das neue Wort im Ohr, und als Nachtisch einen Kaiserschmarrn, auch das wird dem kleinen Esser vorgesprochen, bis er es mit rollendem R nachsprechen kann, Kaiserschmarrn. Er teilt ihn sich mit der Mutter, und noch mit pudriger Süße im Mund fällt er in einem Zimmer unter dem Dach ins gemeinsame Bett. Halbschlaf und Schlaf verschwimmen ihm, er ist wach und träumt zugleich, und irgendwann taumelt er, traumtrunken, auf den Holzbalkon, und da sitzt Damemammi nackt auf der Bank, die Füße an der Brüstung mit Blumenkästen. Sie sonnt sich, auf jedem Lid eine rote Blüte, als hätte ihr wer die Augen ausgestochen.
Die ersten Stunden, der erste Tag, mit einem Abend, an dem es kaum abkühlt, gipfelnd in einem Unwetter mit Wind und Blitzen, noch ohne Regen, als man schon im Bett liegt, nur unter einem Laken, Kopf an Kopf, und das Läuten des Glöckchens ausbleibt. Dafür redet die Mutter, sie flüstert – was Blitze anrichten könnten, großer Gott, sogar einen Mann in der Mitte spalten. Sie nutzt die Pausen zwischen dem Donner, spricht von erschlagenen oder brennenden Menschen auf freiem Feld, um ihren kleinen Zuhörer am Ende beruhigend in den Schlaf zu summen, während es vor dem überdachten Balkon endlich schüttet. Wie aus Kübeln, sagt sie und singt für ihn Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.
Und am anderen Morgen der gültige Alpensommer mit dem Frühstück im Freien; es gibt frische Semmeln und Honig, es gibt Fliegen und Wespen und eine Klatsche – Aber mach sie richtig tot, sagt die Mutter. Und später geht es durch die Wiesen zum Schwarzsee hinunter, das Kind trägt die Badetasche, mit der anderen Hand köpft es Pusteblumen. Sie lösen Karten für die Badeanstalt, aber nicht für die nahe gelegene, wo es laut sein soll, sondern für die auf der anderen Seeseite, nach einem Weg durch Tannenwald. Das Seebichel, wie man zur dortigen, kleineren, ganz in Holz gefassten Anstalt sagt, ist das Bad der Kitzbüheler Gesellschaft, zu der die junge Schauspielerin Anschluss sucht, gleich durch ein deutliches Grüß Gott auf dem Weg zu den Umkleidekabinen. Schon riecht man das moorige Wasser neben dem Duft des erwärmten Holzes, dazu kommt die Süße von Tiroler Nussöl auf all den Beinen und Schultern, den Armen und Wangen, die das Kind im Vorbeigehen sieht. Die Leute liegen auf ihren Handtüchern oder flach auf den Planken, sie dösen oder lesen oder winken denen zu, die im Wasser sind. Es gibt ein Sprungbrett für die Großen, und es gibt ein holzumrandetes Kinderbecken. Aber zuerst eincremen, die Brust, die Bäckchen, die Stirn, den Rücken. So macht man das, sagt die Mutter im weißen Badeanzug, und ihr Begleiter macht es gleich nach, cremt ihr die Schultern ein, den Nacken, die Schenkel. Ach, wie gut er das schon kann, von wem er das nur gelernt hat? Sie möchte eine Antwort, hörbar für alle im Umkreis, und der kleine Kavalier ruft: Von dir, von der Mammi! Es ist ein Fest der Selbstlaute, und so von der eigenen Sprache umgarnt, liegen sie auf dem warmen Holz, vor ihnen der dunkle See mit Waldrand, hinter den Tannen, leicht ansteigend, eine gestaffelte Landschaft, aus der in einiger Ferne, fast wie ein Bühnenbild, der Wilde Kaiser aufragt, seine Zinnen, seine Tore, ein strahlender Felsgarten, darüber der gewaschene Himmel. Damemammi liegt auf dem Bauch, sie liest in einem Buch, bald ist ihr einer Fuß in der Luft, bald der andere, und das Augenkind, gelegentlich auch Augenstern genannt, frei nach dem Lied Du bist mein Augenstern, verfolgt, wie sich aus dem Wechsel der Füße Falten im Badeanzug ergeben oder die Kniekehlen straffen. Aber es hat auch etwas anderes im Blick, ein anderes Kind – das erste andere Kind, das sich überhaupt in seinem Gedächtnis festsetzt –, einen schon gebräunten Jungen, der angelt und sogar einen kleinen am Haken peitschenden Fisch fängt, ihn packt und den Haken aus dem Maul zieht, samt rötlichen Fetzen, und ihn auf die Planken wirft, wo er noch ab und zu mit dem Schwanz schlägt. All das steigt dem Kind zu Kopf, es löst die Zeit auf. Schon ist es Mittag, und sie kehren zurück zu dem Gasthof, endlich läutet auch das Glöckchen, und man geht gleich zu Tisch, wie es heißt, zu den Tellern mit den Abteilungen. Das Essen sättigt, nur macht es auch müde, man will jetzt liegen, will faul sein. Also geht es über knarrende Treppen, vorbei an Geweihen und einer ausgestopften Eule, in das Zimmer unter dem Dach. Dort ist die Luft erdrückend, und die Schauspielerin ruft Ich ersticke! Aber sie erstickt gar nicht, sie zieht sich aus. Ich muss mir die Kleider vom Leib reißen, sagt sie, nur ist es auch kein Reißen, es ist ein Pellen und Fallenlassen. Sie bückt sich nach Rock und Bluse und einem langen Tuch, das auch am See dabei war, nach einer blassen Unterwäsche, und legt alles über den einzigen Stuhl; danach legt sie sich selbst auf das einzige Bett. Komm, sagt sie, auch ausziehen, ja? In ihrer Stimme ist etwas Atemloses, als hätten die Stunden am See und das Essen sie zwar erschöpft, aber doch nicht gänzlich erschöpft, eher etwas Unausgeschöpftes zurückgelassen. Und ihr kindlicher Begleiter zieht sich aus, wie verlangt, das Hemdchen, die kurze Lederhose, und was er darunter trägt, nur die Sonnenbrille behält er auf. Na, da schau her, wie schick, sagt die, die schon im Bett liegt, auf der Decke, nicht darunter, aber das möchte er selbst sehen und stellt sich vor einen Spiegel in der Schranktür. Er tänzelt, er macht Faxen, und vom Bett kommen Laute der Missbilligung, die zugleich ermunternde Laute sind, ja was denn nun, er darf es sich aussuchen, die Ermunterung reizt ihn mehr, sie bringt ihn auf eine Idee. Da ist das Tuch der Mutter auf dem Stuhl, das nimmt er und schlingt es sich um, für erneute missbilligend ermunternde Laute, wie Klapse in Richtung Spiegel. Also tritt er wieder vor den Schrank, zupft sich am Mund, am Haar, am Tuch, ein einsamer kleiner Geck. Und von der Mutter eine hastige Anweisung: den Vorhang zu schließen, das Fenster aber weit zu öffnen; beides geschieht, und der Geruch des aufgeheizten Moors zieht in Wellen herein. Vom geschlossenen Vorhang geht das Dienerkind zum Bett, dort wird ihm das Tuch gelöst und die Sonnenbrille abgenommen, ein vorläufiger Platz am Fußende zugeteilt, und ein Theaterseufzer kündigt eine Mittagsstunde jenseits der gewöhnlichen Welt und ihrer Gesetze an.
Fast ein Menschenleben später, wieder im Sommer, starb die Mutter im Alter von neunundachtzig, und in den Wochen danach sah der Sohn erstmals in eines ihrer Tagebücher, die eigentlich nur Jahresberichte über die Ehe mit seinem Vater sind, festgehalten in zwei Kladden, anfangs noch in flattriger Mädchenschrift. Und dort kommen die Kitzbüheler Tage im Bericht über das siebte Ehejahr nur am Rande vor: Der Sommer kam, die Ferienzeit, und Omi (meine wienerische Großmutter mit einer monatlichen Pension durch ihren gefallenen Mann, einen Major der Wehrmacht) lud mich nach Österreich ein. Mein über alles geliebter Mann konnte die Firma in Hamburg nicht im Stich lassen, und nach vielen Debatten – und einem Intermezzo, das zu erwähnen ich mir schenke – fuhren wir, mein Augenstern, Omi und ich, für vier Wochen nach Kitzbühel.
Dem Sommerintermezzo mit dem Augenstern ist also ein anderes vorausgegangen, für die Verfasserin nicht der Erwähnung wert und damit eben doch erwähnt, in einer Schrift der bald Achtundzwanzigjährigen, die immer noch etwas Instabiles zeigt, und der Seufzer hat dieses gar nicht erwähnte, still übergangene Zwischenspiel eingeleitet, dafür die Bühne frei gemacht: Ein knapp Vierjähriger kniet zwischen den Fersen der Mutter, die nackt auf dem Bauch liegt, das Gesicht in der Armbeuge; er folgt der Trägheit seiner Augen und kann etwas vom Geheimen sehen, wo die Schenkel sich treffen, von den Fältchen dort, dem dunklen Gras der Haare, den Mulden und den Kräuselungen, und was er sieht, gräbt sich ein, als leeres Schlüssellochbild. Er sieht Allesundnichts, aber ehe er sichs versieht, ist die Schlüssellochsicht schon die bleibende. Es ist ein fast lautloses Geschehen, nur mit Schleif- und Knistergeräuschen, als sich die Schläfrige ein Kissen unter den Schoß schiebt, um den Bauch zu entlasten (sie ist im vierten Monat, aber davon weiß der kleine Sohn nichts). Etwas aufgebockt liegt sie nun da, und ihr Augenstern erkundet die Kniekehlen und die weichen, im Halblicht so schimmernden Backen und was sich dazwischen verbirgt. Warme Luft drückt ab und zu gegen den Vorhang, bläht ihn, einzige Bewegung neben der der Finger, ihrem Tun in der Mittagsruhe; nur manchmal ist eins der Hühner auf der Wiese vor dem Gasthof zu hören, die kurze Erregung im Hals, wenn der Hahn es scheucht. Das Kind thront jetzt auf den Fersen der Schläfrigen, ein Infant, gekürt in aller Stille; seine Augen, schwimmend vor Wonne, folgen jeder Bewegung der Finger, und die tun, was sie wollen. Der Mutterleib ist ein vaterloses Gebiet, der Sohn reißt es sich unter den Nagel und prüft seinen Wert, kostet von den Fingern, wie auf Spaziergängen mit der Großmutter, wenn er die fingernagelkleinen wilden Himbeeren gepflückt hat, einen ganzen Strauch geräubert. Die Tage der Sommerfrische sind grenzenlos, zuerst im Gasthof Vordergrub, wo die großmütterliche Hüterin ihm erlaubt, zum Wiener Schnitzel schon etwas Bier zu trinken, das macht schön müde, dann in dem Gasthof mit Damemammi, da ist es erlaubt, auf ihr zu sitzen, an ihr zu spielen, sie zu erkunden, das macht schön neugierig. Der kleine Sommerkavalier trinkt schon und begehrt auch; er trinkt sogar bei der Mutter, seine Augen trinken und die Fingerkuppen.
Mehr als einmal sitzt er in diesen Tagen, in der Mittagsruhestunde, zwischen ihren Fersen oder den Kniekehlen, vorgebeugt, und sieht und befühlt das mütterlich Rückwärtige mit dem Spalt in der Mitte, darin noch immer ein Geheimnis. Die Liegende, das Gesicht halb im Kissen, schweigt. Gleich neben dem Kissen liegt ein Rollenheft, diese Nähe soll Wunder wirken, den Text von selbst ins Gedächtnis treiben; die junge Schauspielerin übt bereits für ihre kommende Rolle (dem Jahresbericht nach die der Lysistrata in der gleichnamigen Komödie von Aristophanes). Immer nach dem Frühstück ist sie auf dem Balkon, Füße an der Brüstung, das Heft auf den Knien, in der Hand einen kleinen grünen Bleistift zum Anstreichen ihrer Sätze, dazu Gemurmel und auch leises Lachen. Der Stift gehört zu dem Heft, als gäbe es nur den einen, und diesen einen holt sich der kleine Mittagsgalan schließlich, nimmt ihn in die Finger: ein Instrument, wie gemacht, um damit vorzudringen in das Geheime, dorthin, wo er herzukommen glaubt. Also erkundet er das Dunkel damit, ohne dass ihm Einhalt geboten wird. Er hat freie Hand bei seinem Tun und entdeckt, noch vor jedem Wissen um die Schrift, etwas nahezu Kreisförmiges, in das er den Stift senkt, seinen Buchstaben O. Die Schläfrige im Bett öffnet sich ihm, sein Tun ist kein Nehmen, eher ein Geben, ein zartes Versorgen. Der Infant stillt seine Mutter. Der kleine grüne Bleistift ist ein Teil von ihm, und es liegt ein unbestimmter Schmerz in seiner so sichtbaren Abnutzung und in dem Bemühen der jungen Schauspielerin, das nahende Ende seiner Bestimmung als Bleistift auf die Art noch hinauszuzögern, als gäbe es eben nur den einen Stift für beide Bestimmungen. Der Bleistift ist aber auch ein zierlicher Taktstock, sachte im Rhythmus bewegt, wenn die Mutter ihrem Augenstern etwas vorsingt, ein Lied, in dem das Weltdesaster, das seine Eltern zusammengebracht hat, nachhallt: Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer flieg. Sie singt es leise ins Kissen, am Ende ist es nur noch ein Flugsummen, als wären sie nun beide beflügelt, träumerisch fliegend im Zimmer; die Schwerkraft scheint aufgehoben und damit auch andere Gesetze, eine Desperadostunde. Der kleine Gesetzlose aber nutzt den Bleistift, um in seinen Buchstaben O einzudringen, und da fallen unvergessene Worte: Aber nicht mit der spitzen Seite, mit der guten – eine nur geringe Einschränkung, die doch alles verändert, den Stift beseelt, während die anderen Dinge im Raum bleiben, was sie sind, der Koffer auf dem Boden ein Koffer, der Stuhl am Tisch ein Stuhl, die Waschschüssel eine Waschschüssel, das Textheft ein Textheft.
Der Unschuldsschlummer meiner frühen Jahre endete in diesen Mittagsdämmerstunden der Jahre, an die es nur verwischte Erinnerungen gibt, Bilder von sprachloser Wahrheit, die, in Worte gefasst, eine Brücke zum Wahrscheinlichen bilden: Ja, wahrscheinlich ist es so gewesen, alle Bilder sprechen dafür. Und doch könnte ich nicht einmal sagen, ob ich im Alter von drei, von vier, ein eher glückliches oder eher unglückliches Kind war; sicher ist nur das Alleinsein in diesen Jahren, das Fehlen eines Alltagsanderen und damit die so großartige wie traurige Idee, dass einem kein fremdes Wesen die Welt streitig macht. Wer oder besser gesagt: was war dann aber dieses alleinselige Kind in seinem Zimmer? Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten, dass es sich selbst genug war. Es summte sich zum Beispiel oft ein Lied vor, das es nur von der Mutter gehört haben kann – In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee –, eine Melodie von universeller wehmütiger Leere, die mir noch immer, sobald sie irgendwo anklingt, nahegeht. Und es tat, was ich heute noch tue, wenn ich mich langweile, auf einem Stück Papier etwas kritzeln.
Gab es also den, der sich hier erinnert, bereits als das Kind, an das er sich kaum erinnert? Den, der im Moment in einem kleinen Hotel in Alassio schreibt, woran er schon länger sitzt, es nun aber beenden will in dem Hotel, das seine Eltern im Spätsommer 1958 nach einem Geschäft in Nizza, ihrem letzten finanziellen Aufatmen innerhalb der Ehe, für einige Tage bewohnt hatten – ich denke, ja. Es gab den, der hier zurückblickt, schon zu der Zeit, als er Kind war, ein Alleiniger auf der Welt, der noch in ihm steckt, ihn denken lässt, dass die eigene Geschichte auch eine allgemeine sei und er es sich herausnehmen könne, von seiner Welt und Zeit zu sprechen. Das ist das eine; das andere ist die stete Sorge jedes Infanten, unberechtigt das letzte Wort zu haben, als Regent (oder Chronist) also irgendwann zwangsläufig aufzufliegen.