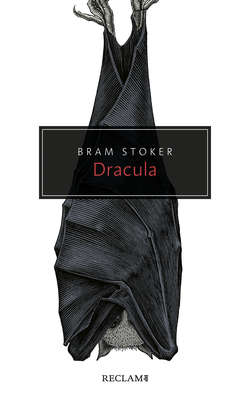Читать книгу Dracula - Bram Stoker - Страница 10
Viertes Kapitel Jonathan Harkers Tagebuch
Оглавление(Fortsetzung)
Ich erwachte in meinem eigenen Bett. War das alles nun ein Traum oder nicht? Wenn ja, musste mich der Graf hierhergetragen haben. Ich versuchte, die Frage zu klären, kam aber zu keinem befriedigenden Resultat. Zwar fand ich ein paar kleinere Indizien, die für ein reales Geschehen sprachen. So waren meine Kleider in einer Art gefaltet und zurechtgelegt, wie ich es nie getan hätte. Meine Uhr war nicht aufgezogen, und ich ziehe sie immer auf, bevor ich zu Bett gehe. Und es gab noch mehr Details, die in die gleiche Richtung deuteten. Doch sie alle waren kein Beweis; sie ließen sich ebenso gut dahingehend erklären, dass mein Geist eben nicht in der gewohnten Verfassung war, weil ihn irgendetwas gewaltig verwirrt hatte. Ein echter Beweis steht also noch aus. Über eines immerhin bin ich froh. Wenn mich wirklich der Graf hierhergetragen hat, muss ihn dabei große Eile getrieben haben: meine Taschen sind nämlich unberührt, mein Tagebuch ist also noch da. Ich bin sicher, die Existenz eines solchen Schriftstücks wäre ihm unerträglich gewesen, zumal er es ja nicht zu entschlüsseln vermag. Er hätte es an sich genommen oder vernichtet. Ich schaue mich in meinem Zimmer um. War es bisher für mich ein Ort der Ängste, ist es mir jetzt eine Art Asyl. Denn nichts kann entsetzlicher sein als jene grässlichen Frauen, die unbedingt mein Blut saugen wollten – und wollen.
18. Mai. – Ich plante, mir den Raum unten noch einmal zu besehen, und zwar bei Tageslicht, denn ich muss die Wahrheit ergründen. Als ich zu der bewussten Tür am Ende des Ganges kam, konnte ich sie nicht aufdrücken. Splitter lagen herum; anscheinend hatte jemand die Tür mit heftiger Wucht gegen ihren Rahmen gedrückt und diesen dabei beschädigt, wie herumliegende Splitter bezeugten. Abgeschlossen war die Tür zwar nicht, aber irgendetwas verhinderte von innen her das Öffnen. Es war wohl alles leider doch kein Traum. Daran werde ich mein Handeln auszurichten haben.
19. Mai. – Eindeutig, ich sitze in der Falle. Gestern abend bat mich der Graf höflichst, ich möge drei Briefe schreiben. Der erste sollte beinhalten, dass meine Arbeit hier nahezu beendet sei und ich in wenigen Tagen die Heimreise antreten würde; der zweite, dass ich am – vom Datum des Briefes ab gerechnet – nächsten Morgen aufbräche; der dritte, dass ich das Schloss verlassen hätte und in Bistritz angekommen sei. Ich wollte zunächst protestieren, aber ich sah ein, dass es bei der gegenwärtigen Lage der Dinge Wahnsinn wäre, mit dem Grafen offen zu streiten, da ich gänzlich in seiner Gewalt bin. Eine Weigerung hätte nur seinen Argwohn erregt und seinen Zorn gereizt. Er weiß, dass ich zu viel weiß und dass er mich nicht am Leben lassen darf, weil ich ihm sonst gefährlich werden könnte. Meine einzige Chance liegt darin, Zeit zu gewinnen. Vielleicht bietet sich mir ja doch irgendeine Gelegenheit zur Flucht. In seinen Augen sah ich Unmut aufsteigen – eine Spur jenes Grimms, der sich gestern entladen hatte, als er die schöne Frau von sich wegstieß. Er erklärte mir seinen Wunsch damit, dass in dieser Gegend die Post selten und unregelmäßig abgehe; wenn ich jetzt gleich schriebe, sei eher die Gewähr gegeben, dass meine Botschaften, die meine Freunde ja beruhigen sollten, diese auch rechtzeitig erreichten. Er versicherte mir nachdrücklich, dass der dritte Brief bis zum angegebenen Tag in Bistritz liegenbleibe, und sollte ich mich etwa entschließen, meinen Aufenthalt zu verlängern, würde er eben nicht verschickt. All dem widersprach ich nicht, um ihm nicht neue Verdachtsgründe gegen mich zu geben. Ich spiegelte ihm daher vor, die Sache genauso zu sehen, und fragte ihn, wie ich die Briefe denn datieren solle. Er überlegte einen Moment und rechnete nach; dann antwortete er: »Den ersten auf den 12. Juni, den zweiten auf den 19. Juni und den dritten auf den 29. Juni.«
Jetzt weiß ich, wie lange ich noch zu leben habe. Gott stehe mir bei!
28. Mai. – Es gibt doch eine Möglichkeit, zu entkommen oder wenigstens meine Leute daheim zu benachrichtigen. Ein Trupp Zigeuner ist aufs Schloss gekommen und hat im Hof Lager bezogen. Die Zigeuner heißen hier cigány. Ich habe über sie einiges in meinem Notizbuch stehen. Sie sind eine Eigentümlichkeit dieser Gegend, aber verwandt mit den Zigeunern der übrigen Welt. Tausende von ihnen leben in Ungarn einschließlich Transsilvaniens, und zwar außerhalb aller Gesetze und bar aller Rechte. Sie stellen sich daher meist unter den Schutz eines mächtigen Edelmannes oder Bojaren und nennen sich nach seinem Namen. Sie sind furchtlos, haben keine Religion außer ihrem Aberglauben und sprechen nur Zigeunersprache, das sogenannte Romani beziehungsweise eine regionale Mundart desselben.
Ich will ein paar Briefe nach Hause schreiben und die Zigeuner irgendwie bewegen, sie für mich zur Post zu bringen. Ich habe schon durch mein Fenster ersten Kontakt zu ihnen aufgenommen. Sie zogen ihre Hüte, verbeugten sich und machten mir jede Menge Zeichen, die ich aber genauso wenig verstand wie ihre Sprache …
Die Briefe sind geschrieben. Der an Mina ist stenographiert; der an Mr. Hawkins enthält nur die Bitte, sich mit meiner Verlobten in Verbindung zu setzen. Ihr habe ich meine Situation offen geschildert, freilich ohne die Greuel zu erwähnen, die ich mir vielleicht doch nur einbilde. Es würde sie sicherlich zu Tode erschrecken oder ängstigen, wenn ich ihr mein Herz ausschüttete. Sollte der Brief in falsche Hände fallen, bliebe dem Grafen wenigstens verborgen, was ich weiß und wie viel ich weiß …
Ich habe die Briefe weitergereicht. Ich warf sie durch die Gitter meines Fensters den Zigeunern zu, sandte ein Goldstück hinterdrein und bedeutete ihnen, so gut ich es vermochte, sie aufzugeben. Der Mann, der sie an sich nahm, drückte sie gegen sein Herz, verneigte sich und legte sie in seine Mütze. Mehr konnte ich vorerst nicht tun. Ich schlich zurück in die Bibliothek und begann zu lesen. Da der Graf offenbar nicht kommt, habe ich mich hier niedergesetzt und Obenstehendes geschrieben …
Der Graf kam dann doch noch. Zwei Briefe hielt er in der Hand, beide geöffnet. Er setzte sich neben mich, holte die Blätter heraus und sagte mit äußerst sanftem Tonfall: »Das haben mir die Cigány gegeben. Ich weiß zwar nicht, woher die Briefe stammen, aber da sie hier gefunden wurden, werde ich mich natürlich um sie kümmern. Schauen Sie!« Keine Frage, er hatte den Inhalt schon geprüft. »Dieser ist von Ihnen und an meinen Freund Peter Hawkins gerichtet. Der andere hingegen« – er nahm ihn heraus und blickte auf die ihm fremden Zeichen der Kurzschrift; seine Miene verfinsterte sich, und die Augen funkelten böse – »der andere hingegen ist eine Gemeinheit, ein schnöder Missbrauch von Freundschaft und Gastrecht! Er trägt keine Signatur. Nun, so wollen wir ihn rasch vergessen.« Und seelenruhig hielt er Brief und Umschlag in die Flamme der Lampe, bis beides verbrannt war.
»Den Brief an Hawkins bringe ich selbstverständlich auf den Weg, da er ja von Ihnen stammt. Ihre Briefe sind mir heilig. Ach bitte verzeihen Sie, mein Freund, jetzt habe ich versehentlich das Siegel erbrochen. Sie möchten den Brief sicher wieder schließen.« Er hielt mir den Bogen hin und reichte mir mit höflicher Verbeugung ein frisches Kuvert. Was blieb mir übrig? Ich schrieb die Adresse auf das neue Kuvert und gab es ihm schweigend zurück. Nachdem er den Raum verlassen hatte, meinte ich zu hören, dass sich der Schlüssel sacht umdrehte. Einen Augenblick später ging ich zur Tür und versuchte sie zu öffnen; sie war tatsächlich verschlossen.
Eine bis zwei Stunden später trat der Graf leise wieder ins Zimmer. Ich war auf dem Sofa eingenickt, und sein Kommen weckte mich. Er gab sich äußerst höflich und liebenswürdig. Als er bemerkte, dass ich geschlafen hatte, sagte er: »Aha, mein Freund, Sie sind müde? Gehen Sie zu Bett. Da ruht es sich am sichersten. Leider kann ich mir heute abend nicht das Vergnügen gönnen, mit Ihnen zu plaudern, denn ich habe zu viel zu tun. Aber Sie dürfen sich getrost schlafen legen, ich bitte Sie sogar darum.« Ich begab mich in mein Zimmer und ging zu Bett. Merkwürdigerweise schlief ich ganz ohne Träume. Auch die Verzweiflung hat eben ihre Flauten.
31. Mai. – Kaum war ich heute morgen erwacht, entschloss ich mich, ein paar Blatt Papier und ein paar Umschläge aus meinem Koffer zu nehmen und mir in die Tasche zu stecken. So, dachte ich, wäre ich gewappnet für den Fall, dass sich irgendwann doch noch eine Gelegenheit ergäbe, Briefe zu versenden. Aber – wieder eine schlimme Überraschung, wieder ein Schlag!
Sämtliches Papier war verschwunden, vom großen Bogen bis zum kleinsten Zettelchen. Fort meine Notizen zu Land und Leuten, zu Streckenverlauf und Abfahrtszeiten der Eisenbahnen und Postkutschen, fort auch mein Kreditbrief, kurz: alles, was mir, wenn ich wirklich einmal hinausgelänge, nützlich wäre. Ich saß und grübelte eine Weile, dann kam mir eine Ahnung. Wie stand es um meine Garderobe? Ich durchsuchte mein Gepäck und den Kleiderschrank.
Und tatsächlich: der Anzug, den ich auf der Herreise trug, war weg, ebenso mein Mantel und meine Decke. Noch so ein übler Streich, hinter dem bestimmt ein perfider Plan steckte …
17. Juni. – Als ich heute morgen auf dem Rande meines Bettes saß und mir das Hirn zermarterte, hörte ich plötzlich draußen lautes Lärmen. Peitschen knallten, und Pferdehufe scharrten und trappelten den felsigen Pfad empor, der auf der anderen Seite des Schlosses in den Hof mündet. Voller Freude stürzte ich zum Fenster und sah zwei große Leiterwagen hineinfahren, jeder gezogen von acht stämmigen Pferden und angeführt von einem Slowaken mit breitem Hut, mächtigem, nietenbeschlagenem Gürtel, schmutziger Schaffellweste und hohen Stiefeln. Beide Männer trugen lange Stäbe in der Hand. Ich wollte zu ihnen hinunter; das erschien mir möglich, denn wenn sie ins Gebäude sollten, musste doch, dachte ich mir, das Tor der großen Eingangshalle für sie geöffnet sein. Doch da – der nächste Schlag: ich kam nicht einmal aus meinem Zimmer; die Tür war von außen verriegelt.
Ich rannte zum Fenster und rief sie um Hilfe an. Stumpfsinnig glotzten sie zu mir empor und zeigten auf mich. In dem Moment aber trat der hetman der Cigány hinzu, und als er sah, dass sie fragend in Richtung meines Fensters deuteten, machte er eine Bemerkung, woraufhin sie lachten und sich abwandten. Kein verzweifeltes Schreien, kein flehentliches Wimmern konnte sie fortan bewegen, mir auch nur einen Blick zu schenken. Die Männer ignorierten mich demonstrativ. Auf dem Leiterwagen lagen große viereckige Kisten. Sie hatten Griffe aus dickem Seil und waren offenbar leer, denn die Slowaken hoben sie ohne jede Mühe, und wenn sie mit ihnen bei ihrem groben Hantieren irgendwo anstießen, polterte es hohl. Als sie alle abgeladen und in einem Winkel des Hofes zu einem hohen Stapel zusammengestellt hatten, gab der Cigány den Slowaken Geld. Sie spuckten darauf – nach hiesigem Glauben soll dies Glück bringen –, schlurften träge zurück zu ihren Gespannen und zogen ab. Schon bald hörte ich das Knallen ihrer Peitschen in der Ferne verklingen.
24. Juni, vor Tagesanbruch. – Letzte Nacht verließ mich der Graf zeitig und schloss sich in seinem Zimmer ein. Sobald ich es wagen konnte, rannte ich die Wendeltreppe hoch und spähte aus dem Fenster, das nach Süden liegt. Dort wollte ich warten, bis der Graf sich zeigt, und ihn genau überwachen. Denn irgendetwas ist im Gange. Die Cigány sind jetzt irgendwo im Schloss untergebracht und verrichten irgendeine Arbeit; das weiß ich bestimmt, denn immer wieder höre ich in einiger Entfernung den dumpfen Klang von Hacke und Spaten. Was immer hier vorgeht, eins steht fest: es dient einer skrupellosen Schurkerei.
Knapp eine halbe Stunde geschah nichts; dann rührte sich etwas am Fenster des Grafen. Ich beugte mich sicherheitshalber zurück, beobachtete aber hinter meiner Deckung weiter und sah, wie der Mann nach und nach mit dem ganzen Körper herauskam. Und wieder traf mich ein Schock: der Graf trug meinen Reiseanzug! Über seinen Schultern hing jener Sack, in dem neulich die grauenvolle Abendgabe für die drei Frauen gesteckt hatte. Was sein Jagdgang bezweckte, war nur allzu klar und schlimm genug – aber er unternahm ihn auch noch in meiner Garderobe! Das ist also seine neue Strategie der bösen Tat: er will, dass die Bewohner der umliegenden Dörfer und Städte glauben, sie hätten mich gesehen. Gelänge dies, erreichte er zwei Ziele. Erstens: Die Menschen werden später bezeugen, dass ich selbst meine Briefe zur Post gebracht habe. Zweitens: Sämtliche Greuel, die der Graf in nächster Zeit verübt, werden die Leute mir zuschreiben.
Und all dies kann er draußen ungehindert betreiben; mich aber hält er hier eingesperrt, wo ich ein Gefangener bin im wahrsten Sinne, freilich ohne den Schutz des Gesetzes, ohne jenes Recht, das selbst dem übelsten Verbrecher noch einen letzten Halt bietet. Wenn ich daran denke, möchte ich rasend werden!
Ich wollte unbedingt die Rückkehr des Grafen mitbekommen und blieb daher beharrlich am Fenster stehen. Da machte ich eine seltsame Entdeckung. Vor mir, im strahlenden Mondschein, trieben merkwürdige kleine Flöckchen. Winzig wie Körner feinsten Staubes, wirbelten sie umher und sammelten sich zu nebelhaften Schwärmen. Ich wusste nicht warum, aber der Anblick milderte meine innere Spannung, mehr noch, es beschlich mich eine eigenartige Ruhe. Ich lehnte mich in der Laibung zurück; so saß ich bequemer und konnte den luftigen Reigen in seiner ganzen Anmut auf mich wirken lassen.
Ich zuckte zusammen, denn plötzlich zerriss klägliches Hundegeheul die Stille. Es ertönte irgendwo tief unten im Tal, das meinem Blick verborgen lag, vorerst noch leise. Dann meinte ich, es würde immer lauter, und die flatternden Staubwolken bewegten sich zu diesem Klang und nähmen dabei ständig neue Formen an. Ich spürte, wie meine Instinkte mich warnten und wie ich darum kämpfte zu erwachen. Ich? O nein, meine Seele selbst war es, die da kämpfte, und endlich rappelte sich mein zwischenzeitlich matt gesetztes Empfindungsvermögen hoch und mühte sich schläfrig, dem Appell zu folgen. Fest stand nun: Ich wurde hier hypnotisiert! Schneller und schneller tanzte der Staub. Die Mondstrahlen schienen zu zittern, als sie an mir vorbei in das Dunkel hinter meinem Rücken fielen. Immer dichter drängten sich die Flöckchen zusammen, bis sich schließlich die Umrisse verschwommener Phantome abzeichneten. Ein zweiter Schreck durchzuckte mich; diesmal aber war ich hellwach. Im wiedererlangten Vollbesitz meiner Sinne erkannte ich meine Lage und rannte schreiend davon. Die Phantome, die sich dort langsam aus dem Mondlicht materialisierten, waren jene drei Geisterfrauen, denen ich anheimfallen sollte. Ich floh und fühlte mich erst in meinem Zimmer etwas sicherer, wo kein Mond schien, dafür aber die Lampe hell brannte.
Ein paar Stunden vergingen, da hörte ich ein Geräusch aus dem Zimmer des Grafen; es klang wie ein schrilles Wehgeschrei, das rasch unterdrückt wurde. Dann wieder Stille, eine tiefe, grässliche Stille, die mich erschauern ließ. Mit pochendem Herzen probierte ich die Tür; aber ich war in meinem Gefängnis eingeschlossen und völlig machtlos. Ich setzte mich hin und konnte nur noch weinen.
Während ich so dasaß, drang plötzlich wieder ein Leidenston an mein Ohr: unten im Schlosshof schallten die qualvollen Klagerufe einer Frau. Ich stürzte zum Fenster, stieß es auf und spähte durch die Gitter. Richtig, da stand eine Frau mit wirrem Haar und hielt die Hände auf die Brust gepresst; das schnelle Laufen hatte ihr wohl zugesetzt. Sie lehnte sich gegen einen Winkel in der Toreinfahrt. Als sie mein Gesicht am Fenster erblickte, stürzte sie vor und schrie mit einer Stimme, in der eine verzweifelte Drohung schwang: »Du Scheusal! Gib mir mein Kind!«
Sie warf sich auf die Knie, hob die Hände und schrie noch einmal die gleichen Worte; der Klang zerriss mir das Herz. Dann raufte sie ihr Haar, hieb sich gegen die Brust und überließ sich ganz der Gewalt eines grenzenlosen Schmerzes. Endlich stürmte sie noch näher zum Schloss heran; jetzt sah ich sie nicht mehr, aber ich hörte, wie sie mit bloßen Fäusten gegen das Tor schlug.
Irgendwo hoch über mir hörte ich die Stimme des Grafen. Wahrscheinlich stand er oben auf dem Turm und rief etwas herab, allerdings eher leise: ein hartes, metallisches Zischen. Als Antwort ertönte nah und fern das Heulen der Wölfe. Nur wenige Minuten später schoss ein Rudel in den Schlosshof wie aufgestautes Wasser durch geöffnete Schleusen.
Die Frau schrie nicht, und auch die Wölfe heulten nur kurz auf. Bald zogen sie einzeln wieder davon, wobei sie sich die Mäuler leckten.
Ich vermochte die Frau nicht einmal zu bedauern, denn ich wusste ja, welches Los ihr Kind getroffen hatte. So betrachtet war der Tod für sie eine Gnade.
Was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie entrinne ich dieser grässlichen Welt aus Nacht, Spuk und Angst?
25. Juni, morgens. – Niemand, der nicht schon einmal unter der Nacht gelitten hat, weiß, wie süß und willkommen für Herz und Auge der Morgen sein kann. Als die Sonne heute früh das Dach des großen Torbogens erreichte, der meinem Fenster gegenüberliegt, strahlte die hohe Spitze derart hell, dass ich meinte, die Taube aus der Arche Noah hätte sich dort niedergelassen. Meine Furcht fiel von mir ab wie ein Gewand aus Nebeldunst, das sich in der Wärme auflöst. Ich muss irgendetwas unternehmen, solange mir die Tageshelle Mut eingibt. Gestern abend ging einer meiner vordatierten Briefe zur Post, der erste jener verhängnisvollen Reihe von Schreiben, welche die Spuren meiner Existenz auf Erden auslöschen sollen.
Nicht daran denken! Handeln!
Eines fällt mir jetzt erst auf. Wenn ich hier bedrängt oder bedroht wurde, wenn ich in Furcht oder Gefahr geriet, war es immer Nacht. Ich habe bis heute den Grafen noch nie bei Tageslicht gesehen. Vielleicht schläft er ja, während die anderen wachen, damit er wach ist, während die anderen schlafen? Könnte ich doch nur in sein Zimmer! Aber das geht eben nicht. Die Tür ist immer verschlossen. Nein, für mich führt da kein Weg hinein.
Doch, es gibt einen Weg – wenn man ihn denn zu gehen wagt. Wo der Graf geklettert ist, kann doch auch ein anderer klettern. Ich habe ihn selbst aus seinem Fenster steigen sehen; warum sollte ich es ihm nicht nachtun und in sein Fenster steigen? Meine Chance ist verzweifelt gering, aber meine Lage ist noch verzweifelter. Ich werde es riskieren. Im schlimmsten Fall droht mir der Tod, aber dann stürbe ich wenigstens wie ein ganzer Mann und nicht wie ein Kalb auf der Schlachtbank. Und mir steht ja vielleicht noch das gefürchtete Jenseits offen. Gott helfe mir bei meinem Vorhaben! Adieu, Mina, wenn ich scheitere. Adieu, Mr. Hawkins, mein treuer Freund und zweiter Vater. Adieu, ihr alle, und ein letztes Mal: adieu, Mina!
Gleicher Tag, später. – Ich habe mich getraut und es mit Gottes Hilfe unversehrt zurück in mein Zimmer geschafft. Aber der Reihe nach. Ich wollte aktiv werden, während mein Mut noch frisch war. Also ging ich entschlossen zum erwähnten Fenster, das nach Süden liegt, und stieg auf den schmalen Sims, der hier am Gebäude entlangläuft. Die Steine sind groß und roh behauen; den Mörtel zwischen ihnen hat die Zeit weggespült. Ich zog meine Stiefel aus und wagte mich an die verzweifelte Kletterpartie. Einmal schaute ich bewusst und gezielt nach unten, damit mich gleich nicht etwa ein zufälliger Blick in die grausige Tiefe überwältigte. Anschließend aber hielt ich die Augen abgewandt. Ich wusste recht genau, wo das Zimmer des Grafen lag und wie weit es bis dahin war. Also bewegte ich mich, alle vorteilhaften Umstände nutzend, in diese Richtung, so gut ich eben konnte. Schwindel spürte ich keinen; ich war wohl zu aufgeregt dazu. Es ging geradezu lächerlich schnell. Viel eher als gedacht stand ich auf dem Außenbrett des Fensters. Ich versuchte es hochzuschieben; auch dies gelang. Nervosität erfüllte mich jedoch, als ich mich bückte und Füße vorweg durch die Öffnung gleiten ließ. Sofort sah ich mich nach dem Grafen um, stellte aber zu meiner Überraschung und zu meiner Freude fest: Das Zimmer war leer! Die Einrichtung bestand aus seltsamen Möbeln, die wirkten, als wären sie nie benutzt worden. Vom Stil her glichen sie denen in den anderen Zimmern auf der Südseite. Eine dicke Staubschicht bedeckte auch sie. Ich suchte nach dem Schlüssel; er steckte aber nicht im Schloss und war auch sonst nirgends zu finden. Entdeckt habe ich lediglich in einer Ecke einen großen Haufen Goldstücke, Münzen sämtlicher Art und Herkunft: römische, britische, österreichische, ungarische, griechische, türkische – alle freilich verschmutzt, als hätten sie lange in der Erde gelegen, und alle mindestens dreihundert Jahre alt. Es lagen auch Ketten und Schmuck aus Gold dabei, teilweise edelsteinbesetzt, aber alles eben alt und voller Flecken.
In einer Ecke des Zimmers war eine schwere Tür. Ich versuchte sie zu öffnen. Wenn ich schon weder den Schlüssel zu diesem Zimmer noch den zum Außentor finden konnte, der ja das Hauptobjekt meiner Suche darstellte, musste ich wenigstens die Örtlichkeit genauer kennenlernen, sonst wären all meine Anstrengungen von vorhin umsonst gewesen. Besagte Tür war offen; dahinter lag der Durchgang zu einer Wendeltreppe, die steil in die Tiefe führte. Ich stieg hinab und gab dabei acht, wohin ich trat, denn die Treppe lag im Dunkeln; nur durch ein paar schmale Schießscharten im dicken Mauerwerk drang etwas Licht herein. Unten kam ich in einen finsteren, tunnelartigen Gang, aus dem mir ein widerlicher Todesgeruch entgegenschlug – der Geruch uralter, aber frisch gewendeter Erde. Je weiter ich in den Gang hineinschritt, desto näher rückte der Gestank und desto intensiver wurde er. Schließlich gelangte ich zu einer schweren Tür, die einen Spalt offen stand. Ich öffnete sie ganz und trat in eine verfallene Kapelle, die augenscheinlich als Friedhof genutzt wurde. Das Dach war eingestürzt. An zwei Stellen führten Stufen zu unterirdischen Gewölben hinab. Den Boden aber hatte man kürzlich umgegraben und die Erde dann in wuchtige Holzkisten geschaufelt. Es handelte sich zweifellos um jene Kisten, welche die Slowaken gebracht hatten. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen. Ich forschte nach einem zweiten Ausgang, doch da schien keiner zu sein. Sorgfältig untersuchte ich jeden Zollbreit Boden, um nur ja keine Öffnung zu übersehen, die mir die Möglichkeit zur Flucht bot. Ich stieg sogar, obwohl mich dies starke Überwindung kostete, in die Gewölbe hinab, wo trübes Dämmerlicht gegen die Finsternis ankämpfte. In zweien davon fand ich nichts als die Reste alter Särge und jede Menge Staub. Im dritten Gewölbe jedoch machte ich eine Entdeckung.
Viele große Kisten standen hier herum, wohl so an die fünfzig. Und in einer davon lag auf einer Schicht frischer Erde – der Graf! Er war entweder tot, oder er schlief. Was von beiden, konnte ich nicht genau bestimmen. Die Augen standen offen und blickten starr, was eher für die erste Annahme sprach, doch fehlte ihnen die typische Glasigkeit. Auch hatten die Wangen ungeachtet aller Blässe die Wärme des Lebens, und die Lippen waren rot wie immer. Andererseits: keinerlei Bewegung, kein Puls, kein Atem, kein Herzschlag. Ich beugte mich über ihn, horchte und schaute nach einem eindeutigen Lebenszeichen, aber vergeblich. Übrigens konnte er noch nicht lange dort gelegen haben, denn der Geruch frisch umgegrabener Erde pflegt binnen weniger Stunden zu verfliegen. Neben der Kiste lag der dazugehörige Deckel, in den hier und da Löcher gebohrt waren. Vielleicht, so dachte ich mir, hatte der Graf den Schlüssel bei sich? Doch als ich ihn durchsuchen wollte, fiel mein Blick auf seine toten Augen. Und so leblos sie auch schienen: ich sah darin – obwohl ich oder meine Anwesenheit ihm doch schwerlich zu Bewusstsein gelangt sein konnte – einen solchen Ausdruck wilden Hasses, dass ich floh. Eilends stürmte ich ins Zimmer des Grafen, verließ es durchs Fenster und kletterte an der Schlossmauer empor. Nachdem ich mein Zimmer wieder erreicht hatte, warf ich mich keuchend aufs Bett und versuchte meine Gedanken zu ordnen.
29. Juni. – Das letzte meiner Schreiben trägt das Datum des heutigen Tages, und der Graf hat alles getan, um mögliche Augenzeugen glauben zu machen, ich selbst hätte den Brief aufgegeben. Er hat nämlich wieder das Schloss durch das bewusste Fenster verlassen, und zwar in meinen Kleidern. Als er wie üblich nach Eidechsenart die Mauer hinabstieg, wünschte ich mir, ich hätte ein Gewehr oder sonst ein Tötungsgerät, um ihn zu vernichten. Aber leider muss ich bezweifeln, dass eine von Menschenhand gemachte Waffe ihm irgendetwas anhaben könnte. Ich wagte nicht, am Fenster auf seine Rückkehr zu warten, denn ich fürchtete, dann würde ich auch die unheimlichen Schwestern wiedersehen. Ich ging in die Bibliothek und las dort, bis ich einschlief.
Ich wurde geweckt vom Grafen. Er blickte mich mit dem grimmigsten Gesichtsausdruck an, der sich denken lässt, und sagte: »Morgen, mein Freund, müssen wir uns trennen. Sie kehren zurück in Ihr schönes England, und ich nehme meine Arbeit wieder auf – eine Arbeit, die zur Folge haben könnte, dass wir uns nie wiedersehen. Ihr Brief nach Hause ist zur Post gegeben. Morgen bin ich nicht da, aber für Ihre Reise ist alles vorbereitet. In der Frühe kommen die Cigány und ein paar Slowaken, die auch noch ein paar Arbeiten hier zu verrichten haben. Wenn sie wieder weg sind, holt mein Wagen Sie ab und bringt Sie zum Borgópass; dort können Sie dann die Postkutsche aus der Bukowina erwarten, mit der Sie zurück nach Bistritz gelangen. Ich hege indes die Hoffnung, dass ich Sie doch noch einmal auf Schloss Dracula begrüßen darf.«
Ich traute ihm nicht und wollte seine Aufrichtigkeit prüfen. Aufrichtigkeit! Man entweiht dieses Wort ja fast, wenn man es mit einem solchen Scheusal in Verbindung bringt. Ich fragte ihn also unverblümt: »Warum kann ich nicht heute nacht fahren?«
»Weil mein Kutscher und meine Pferde noch unterwegs sind, bester Herr.«
»Dann laufe ich eben, das macht mir nichts aus. Ich möchte sofort gehen.«
Er lächelte ein so sanftes und verbindliches Lächeln, dass ich gleich vermutete, dass hinter dieser Freundlichkeit irgendeine Tücke steckte. Dann fragte er: »Und Ihr Gepäck?«
»Nicht so wichtig. Lasse ich bei Gelegenheit holen.«
Der Graf stand auf und erwiderte mit einer feinen Höflichkeit, die so echt wirkte, dass ich mir die Augen reiben wollte: »Ihr Engländer habt da einen Spruch, der mir sehr zusagt, denn er umreißt sehr genau, was auch wir Bojaren über diese Dinge denken: ›Den Gast, der eintrifft, heiße willkommen; den Gast, der fortstrebt, halte nicht auf.‹ Also dann, mein lieber junger Freund. Nicht eine Stunde länger sollen Sie in meinem Hause bleiben, als Sie selbst wünschen – obwohl es mich betrübt, dass Sie schon aufbrechen wollen, und noch dazu so plötzlich. Kommen Sie!« Würdevoll und gemessenen Schrittes stieg er vor mir mit seiner Laterne die Treppe hinab und führte mich durch die Halle. Plötzlich blieb er stehen: »Horchen Sie!«
Wölfe heulten auf, ganz nahebei und in großer Zahl. Man mochte glauben, ihr Lärm setzte just in dem Moment ein, da er seine Hand hob, so wie ein großes Orchester genau dann loszulegen scheint, wenn der Dirigent seinen Taktstock emporschwingt. Der Graf wartete einen Augenblick; dann schritt er, immer noch würdevoll und gemessen, auf den Eingang zu, schob die mächtigen Riegel zurück, hakte die schweren Ketten aus und zog das Tor auf.
Zu meinem höchsten Erstaunen war es nicht verschlossen. Misstrauisch verfolgte ich das Geschehen, aber so weit ich sah, wurde nirgends ein Schlüssel in ein Schloss gesteckt und umgedreht.
Kaum öffnete sich das Tor, wurde das Geheul der Wölfe draußen lauter und grimmiger. Sie fletschten die Zähne in ihren roten Mäulern, sprangen auf ihren mit stumpfen Klauen bewehrten Pfoten herbei, drängten sich vor dem sich öffnenden Tor. Ich musste erkennen, dass es sinnlos wäre, den Kampf gegen den Grafen aufzunehmen, zumindest jetzt. Was vermag ich wider jemanden, der über solche Verbündete gebietet! Das Tor indes öffnete sich langsam immer weiter, und immer breiter wurde der Spalt, den nur noch der Körper des Grafen versperrte. Plötzlich fuhr es mir durch den Sinn: So also hatte er meinen Untergang geplant! Hier und jetzt sollte ich sterben, und dies war die für mich vorgesehene Todesart. Ich würde den Wölfen anheimgegeben – noch dazu auf eigenes Verlangen! Eine teuflische List von ungeheurer Schlechtigkeit, aber dem Grafen ohne weiteres zuzutrauen. Im letzten Moment schrie ich doch noch: »Schließen Sie die Tür! Ich warte bis morgen früh!« Und ich schlug die Hände vors Gesicht, um die Tränen der bitteren Enttäuschung zu verbergen. Mit einer einzigen Bewegung seines mächtigen Armes warf der Graf das Tor zu. Die mächtigen Riegel sprangen zurück in die Schließstellung – so laut, dass die Halle erdröhnte.
Schweigend gingen wir wieder hoch in die Bibliothek, und nach ein, zwei Minuten begab ich mich in mein Zimmer. Ich sah mich noch einmal kurz um nach dem Grafen. Da warf er mir eine Kusshand zu, mit vor lauter Triumph rot leuchtenden Augen und mit einem Lächeln, auf das Judas in der Hölle stolz wäre.
In meinem Zimmer wollte ich mich schon niederlegen, da war mir, als hörte ich ein Flüstern vor meiner Tür. Leise ging ich hin und lauschte. Wenn meine Ohren mich nicht täuschten, sagte da draußen die Stimme des Grafen: »Zurück! Zurück! Ab mit euch, wohin ihr gehört! Eure Zeit ist noch nicht gekommen. Wartet! Habt Geduld! Die heutige Nacht gehört noch mir. Die morgige Nacht aber gehört euch!«
Ein leises, süßliches Kichern war die Antwort. Wütend stieß ich die Tür auf und erblickte draußen die schrecklichen Weiber, die sich begierig die Lippen leckten. Als sie mich sahen, brachen sie alle drei in ein grausiges Lachen aus und rannten davon.
Ich ging wieder in mein Zimmer und sank auf die Knie. So nahe also ist es schon, mein Ende? Morgen! Morgen! Gott, hilf mir und all jenen, die mich lieben!
30. Juni, morgens. – Das Folgende sind vielleicht die letzten Worte, die ich in dieses Buch schreibe. – Ich schlief bis kurz vor Tagesanbruch. Nachdem ich erwacht war, kniete ich erneut nieder, denn wenn der Tod schon käme, sollte er mich wenigstens nicht unvorbereitet finden.
Da aber spürte ich jene feinen Veränderungen in der Luft, die signalisieren, dass der Morgen kommt. Dann ertönte der ersehnte Hahnenschrei, und – ich fühlte mich gerettet. Frohen Herzens öffnete ich meine Tür und rannte hinunter in die Halle. Gestern abend hatte ich genau registriert, dass das Tor nicht verschlossen war. Nun lag der Weg zur Flucht frei. Meine Hände zitterten vor Erregung, als ich die Ketten aushakte und die massiven Riegel zurückschob.
Aber das Tor bewegte sich nicht. Verzweiflung packte mich. Ich zerrte und zerrte und rüttelte daran, bis die dicke Holzpforte trotz aller Schwere in ihrem Rahmen rappelte. Umsonst: ich merkte, dass der Schlossriegel in der Zarge steckte. Der Graf musste, nachdem ich ihn gestern abend verlassen hatte, noch einmal hinuntergegangen sein und zugesperrt haben.
Da ergriff mich ein wildes Verlangen, mir um jeden Preis diesen Schlüssel zu beschaffen. Noch einmal sollte es die Mauer hinab in das Zimmer des Grafen gehen. Vielleicht würde er mich töten, aber der Tod erschien mir verglichen mit dem, was mir sonst bevorstand, als das freundlichere Übel. Ohne zu zögern, stürzte ich hinauf zu dem ostwärts gelegenen Fenster und kletterte von dort, wie beim letzten Mal, die Außenwand hinunter und landete schließlich im Zimmer des Grafen. Es war leer, aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Einen Schlüssel indes konnte ich nirgends erblicken, doch der Haufen Goldmünzen lag noch dort. Ich ging durch die Ecktür, die Wendeltreppe hinab und durch den dunklen Gang, bis ich in die alte Kapelle gelangte. Ich wusste inzwischen sehr genau, wo das Ungeheuer zu finden war, das ich suchte.
Der große Kasten stand nach wie vor nahe der Wand; doch jetzt lag der Deckel darauf. Er war zwar nicht befestigt, aber die Nägel steckten schon und brauchten nur noch eingeschlagen zu werden. Es half nichts; wenn ich den Schlüssel wollte, musste ich die Kleider des Grafen durchsuchen. Also hob ich den Deckel und drehte ihn waagerecht zur Wand hin. Dann aber erblickte ich etwas, das mein Herz mit Grauen erfüllte. Da lag der Graf wie tot, aber er sah aus, als wäre er in jüngere Jahre zurückgekehrt. Haar und Schnauzbart, vordem weiß, waren nun von dunklem Eisengrau, die Wangen voller, und unter der weißen Haut schimmerte es rubinrot. Der Mund leuchtete röter als je, denn auf den Lippen standen dicke Tropfen frischen Blutes, das ihm auch aus den Mundwinkeln sickerte und über Kinn und Hals lief. Selbst die feurigen Augen lagen nicht mehr so tief; offenbar hatte sich neues Fleisch um sie gebildet, denn die Lider und die Tränensäcke darunter wirkten regelrecht gedunsen. Es war, als hätte sich die ganze grässliche Kreatur geradezu vollgepumpt mit Blut. Er lag da wie ein schäbiger Egel, erschöpft vor Übersättigung. Ich schauderte, als ich mich über ihn beugte und ihn berührte. Jeder meiner Sinne sträubte sich dagegen, aber ich musste ihn doch durchsuchen, sonst war ich verloren, und morgen nacht würde mein Körper ein Festmahl für die drei Entsetzlichen werden, die sich über mich dann genauso hermachten wie der Graf über sein jüngstes Opfer. Ich tastete seinen ganzen Körper ab – nirgendwo ein Schlüssel, nicht eine Spur. Dann hielt ich einen Augenblick inne und schaute dem Grafen ins Antlitz. Ein höhnisches Lächeln spielte auf dem gedunsenen Gesicht, das mich fast zum Wahnsinn trieb. Dieses Wesen würde nun mit meiner Hilfe nach London übersiedeln. Er käme jetzt in eine wimmelnde Metropole; unter den Millionen und Abermillionen Menschen würde er, womöglich jahrhundertelang, seine Blutgier befriedigen und eine sich ständig vergrößernde Schar von Halbdämonen schaffen, die sich ihrerseits an den Wehrlosen gütlich täten. Allein der Gedanke machte mich verrückt. Es überkam mich eine unheimliche Lust, die Welt von solch einem Ungeheuer zu befreien. Eine Tötungswaffe hatte ich nicht zur Hand; so ergriff ich denn eine der Schaufeln, welche die Arbeiter zum Füllen der Kisten benutzt hatten, und holte weit aus, um mit der scharfen Kante in das abscheuliche Gesicht zu schlagen. Doch gerade in dem Moment wandte sich der Kopf des Grafen, und grässliche Basiliskenaugen richteten sich in voller Glut auf mich. Der Anblick schien mich zu lähmen; die Schaufel zitterte mir in der Hand, und der Hieb streifte das Gesicht nur flüchtig: immerhin hinterließ er eine tiefe Wunde oberhalb der Stirn. Dann glitt mir die Schaufel aus der Hand und landete auf dem Sarg. Sie lag nun quer über dem Deckel. Ich wollte sie dort wegziehen; dabei hakte sich die Oberkante des Blattes in der Längsseite des Deckels fest, der nun in die ursprüngliche Position zurückglitt, so dass sie den Kasten wieder verschloss und die Grässlichkeit meinen Augen verbarg, nachdem ich noch einmal kurz das gedunsene, blutbefleckte Gesicht erblickt hatte. Das boshafte Grinsen, das starr darin saß, hätte wohl in der allertiefsten Hölle kaum seinesgleichen gefunden.
Ich grübelte und grübelte, was der nächste Schritt sein müsste, aber mein Hirn schien in Flammen zu stehen. Ein Gefühl der Verzweiflung bemächtigte sich meiner. Ich konnte nur warten.
Während ich so dastand, vernahm ich plötzlich aus der Ferne ein Zigeunerlied. Fröhliche Stimmen brachten es zu Gehör. Der Gesang kam näher, und zwischendrin rollten schwere Räder und knallten Peitschen. Es waren die Cigány und die Slowaken, von denen der Graf gesprochen hatte. Ich warf einen letzten Blick um mich und auf die Kiste, die den scheußlichen Körper barg, und rannte hoch in das Zimmer des Grafen. Dort blieb ich erst einmal; wenn die Leute zu den Gewölben wollten, mussten sie ja hier durch, dachte ich mir. Also legte ich mich auf die Lauer, bereit hinauszuschlüpfen, sobald die Tür sich öffnete. Angespannt lauschte ich und hörte, wie sich unten ein Schlüssel in irgendeinem großen Schloss drehte und das schwere Tor aufgestoßen wurde. Hoch kam keiner; es muss also noch einen anderen Zugang zur Krypta geben, von draußen vielleicht; oder jemand besitzt auch einen Schlüssel zu einer der zahlreichen sonst abgeschlossenen Türen innerhalb der Burg. Jedenfalls vernahm ich nun das Trappeln vieler Füße, ein lautes Gedröhn, dessen Widerhall bis zu mir heraufschallte. Dann verlor sich das Geräusch in irgendeinem Gang. Rasch wollte ich wieder hinunter zu den Gewölben, denn dort musste ich ja wohl den unentdeckten Ausgang suchen. Aber in diesem Augenblick fegte ein gewaltiger Windstoß heran, und die Ecktür zur Wendeltreppe fiel mit solcher Gewalt zu, dass der Staub von der Bekrönung flog. Als ich hinsprang, um sie wieder aufzudrücken, musste ich feststellen, dass sie hoffnungslos klemmte. Ich war erneut ein Gefangener, und das Netz des Verderbens zog sich noch enger um mich.
Während ich dies schreibe, tönen wieder zahlreiche stampfende Schritte aus dem Gang unten empor, desgleichen das polterige Absetzen schwerer Lasten, offenbar der erdgefüllten Kisten. Nun wird gehämmert; jetzt nageln sie also die Kiste mit dem Grafen zu. Und da kommen sie zurück, die stampfenden Schritte, und trampeln durch die Halle, gefolgt vom leichtfüßigen Getrappel jener vielen, die sich vor dem Tragen drücken konnten.
Das Haupttor wird geschlossen; die Ketten rasseln, dann knirscht ein großer Schlüssel im Schloss. Ich höre, wie er herausgezogen wird. Dann öffnet und schließt sich eine andere Tür; wieder knarren Schloss und Riegel.
Horch! Das Rollen schwerer Räder, erst im Hof, dann den Felsweg hinab; eine Weile noch das Peitschenknallen und der Chor der Cigány, bis alles in der Ferne verhallt.
Ich bin allein im Schloss mit den schrecklichen Frauen. Obwohl – Frauen? Pah! Mina ist eine Frau, sie und jene drei Weiber haben nichts gemein. Das sind Dämonen der Unterwelt!
Ich werde nicht allein mit ihnen hierbleiben. Ich werde versuchen, die Schlossmauer tiefer hinabzusteigen, als ich es bisher wagte. Ich will mir auch etwas von dem Gold mitnehmen; womöglich kann ich es später brauchen. Vielleicht finde ich ja doch einmal einen Weg hinaus aus dieser Stätte des Schreckens.
Und dann fort! Heim! Fort zum nächsten und schnellsten Zug! Fort von diesem verfluchten Ort, aus diesem verfluchten Land, wo jetzt noch der Teufel und seine Kinder in irdischer Gestalt umherwandeln!
Auf Gottes Gnade kann man gewiss eher zählen als auf die jener Ungeheuer. Der Abgrund ist steil und tief. In seinem Schoß mag ein Mann schon Ruhe finden – er wäre dann doch ein Mann geblieben und ein Mensch. Lebt wohl, ihr alle! Und lebe wohl, Mina!