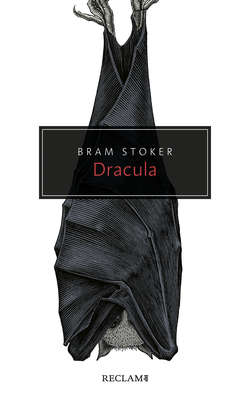Читать книгу Dracula - Bram Stoker - Страница 9
Drittes Kapitel Jonathan Harkers Tagebuch
Оглавление(Fortsetzung)
Als mir bewusst wurde, dass ich ein Gefangener war, packte mich eine wilde Raserei. Ich rannte die Treppen hinauf und hinab, rüttelte an jeder Tür und spähte aus jedem Fenster, das ich entdecken konnte. Bald überwog jedoch die Erkenntnis vollkommener Hilflosigkeit alle anderen inneren Regungen. Wenn ich mir jetzt mein Verhalten während der letzten paar Stunden vergegenwärtige, glaube ich fast, dass mich eine Wahnsinnsattacke heimgesucht hat. Mein Benehmen glich dem einer Ratte, die in der Falle sitzt. Nachdem ich mir aber einmal klargemacht hatte, dass ich völlig hilflos war, zwang ich mich zur Ruhe – wohl energischer als je zuvor in meinem Leben –, setzte mich hin und überlegte, was nun am besten zu tun wäre. Ich überlege immer noch, bin aber bisher zu keinem befriedigenden Ergebnis gelangt. »Nur eines steht fest«, sagte ich mir: »Ich darf den Grafen nicht merken lassen, wie es in mir aussieht. Dass ich hier gefangen bin, weiß er ja; schließlich hat er selbst es so eingerichtet und hat bestimmt seine Gründe dafür. Teilte ich ihm nun freimütig mit, was ich beobachtet habe und welche Schlüsse ich daraus ziehe, würde er doch bloß auf Heimtücke sinnen. Soweit ich die Dinge zu beurteilen vermag, kann ich im Moment nicht mehr tun als mein Wissen und meine Ängste sorgsam verbergen und die Augen offenhalten. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: Entweder narrt mich meine eigene Furcht, und ich falle darauf herein wie ein kleines Kind. Oder aber ich befinde mich wirklich in einer verzweifelten Klemme. Trifft letzteres zu, benötige ich jetzt und fürderhin meine ganze Geisteskraft, um sämtliche Gefahren zu überstehen.« Kaum hatte ich den Gedanken beendet, hörte ich unten das große Tor zugehen und wusste: der Graf war zurück. Er kam jedoch nicht sofort in die Bibliothek hoch. Ich ging leise in mein Zimmer und stutzte: da stand der Graf und machte mein Bett. Dies verdutzte mich zwar, bestätigte mir aber lediglich, was ich schon seit längerem vermute, nämlich, dass es hier im Schloss gar kein Personal gibt. Als ich später durch einen Türspalt sah, wie er im Esszimmer den Tisch deckte, schwanden alle Zweifel: Wenn er die ganzen häuslichen Verrichtungen selbst erledigt, muss man doch wohl folgern, dass er eben keine Dienerschaft besitzt. Die Erkenntnis erschreckte mich; denn stimmte dies, so war der Kutscher, der mich herbrachte, auch niemand anderes als der Graf selbst. Ein furchtbarer Gedanke. Welch unheimliche Macht hat dieser Mann, dass er Wölfe in Bann zu halten vermag, dass er sie zum Stillschweigen bringt, indem er bloß die Hand hebt? Wieso hatten all die Leute in Bistritz und meine Reisegefährten so schreckliche Angst um mich? Warum gab man mir Kruzifix, Knoblauch, wilde Rosen und Eschenzweige mit? Gesegnet sei die liebe, gute Frau, die mir das Kruzifix um den Hals hängte! Denn wenn mir Mut und Kraft zu schwinden drohen, brauche ich es nur zu berühren, und ich fühle mich sicherer. Seltsam; da hat man uns beigebracht, dergleichen verächtlich als Götzendienst abzutun, und nun, in Einsamkeit und Not, bringt gerade solch ein Gegenstand mir Erleichterung. Liegt dies wohl im Wesen des Gegenstandes selbst? Oder ist es vielmehr eine Art Medium, ein Hilfsmittel, greif- und tastbar, dessen Wirkung darauf beruht, dass es Erinnerungen an Menschen weckt, die uns freundlich Trost spendeten? Der Frage möchte ich unbedingt einmal nachgehen – sofern mir noch Gelegenheit dazu bleibt. Bis dahin aber hat anderes Vorrang. Ich muss so viel wie irgend möglich über den Grafen herausfinden; denn nur dann habe ich eine Chance zu verstehen, was sich hier tut. Vielleicht erzählt er heute abend selbst einiges von sich, wenn ich die Konversation geschickt in diese Richtung lenke. Doch höchste Vorsicht bleibt geboten, denn er darf keinen Argwohn schöpfen.
Mitternacht. – Ausgedehnte Plauderei mit dem Grafen. Ich stellte ihm diverse Fragen zur Geschichte Transsilvaniens – ein Thema, das ihn erstaunlich auftauen ließ. Seine Berichte von bestimmten historischen Personen und Ereignissen klangen, als wäre er seinerzeit immer dabei gewesen; besonders plastisch gelang ihm die Schilderung von Schlachten. Der Graf erklärte dies so: Für einen Bojaren ist der Stolz seiner Ahnen sein eigener Stolz; ihr Ruhm ist sein Ruhm, ihr Schicksal ist sein Schicksal. Sprach er von seiner Familie, sagte er stets »wir« und benutzte den Plural, wie Könige zu tun pflegen. Gern würde ich, was er darbot, exakt in seinen Worten hinschreiben, denn ich fand es faszinierend. Es war, als rollte er die gesamte Geschichte seines Landes vor mir aus. Während des Redens geriet er mehr und mehr in Wallung. Er zerrte an seinem dicken weißen Schnurrbart, packte mit seinen mächtigen Händen bald diesen, bald jenen Gegenstand und zerdrückte ihn fast. Eine Stelle seiner Ausführungen will ich aber hier möglichst getreu wiedergeben, denn sie erzählt auf besonders kennzeichnende Art den Werdegang seines Volkes:
»Wir Szekler haben alles Recht der Welt, stolz zu sein. Denn in unseren Adern fließt das Blut vieler tapferer Völker, die den gleichen Kampf kämpfen wie der Löwe im Tierreich – den um die Herrschaft. Seit Jahrhunderten zieht unsere Gegend die europäischen Völker gleich einem Strudel an und wirbelt sie durcheinander. In dieses Gewirr brachten die ugrischen Stämme von Island her den Kampfgeist, welchen Thor und Wotan ihnen verliehen hatten. Den bewies ihre Vorhut, die berüchtigten Berserker, an den Küsten Europas, ja auch Asiens und Afrikas derart eindrucksvoll, dass die Leute glaubten, da komme eine Horde Werwölfe. Als sie dann hierher gelangten, stießen sie auf die Hunnen, deren wilde Kriegslust wie eine lebendige Flamme über die Erde hinweggefegt war. Die sterbenden Stämme glaubten, die Hunnen müssten doch wohl Nachfahren jener alten Hexen sein, die sich einst, aus Skythien vertrieben, mit den Teufeln in der Wüste paarten. Diese Narren, diese Narren! Welcher Teufel oder welche Hexe war je so mächtig wie Attila, dessen Blut in diesen Adern kreist?« Er reckte die Arme empor. »Ist es bei solchen Ahnen ein Wunder, dass wir ein Stamm von Eroberern wurden, ein stolzer Stamm? Ist es merkwürdig, dass wir die Magyaren, die Lombarden, die Aaren, die Bulgaren und die Türken zurücktrieben, als sie zu Tausenden über unsere Grenzen strömten? Ist es erstaunlich, dass, als Árpád und seine magyarischen Legionen das heutige Ungarn besetzten, seine große Landnahme, die Honfoglaglás, hier an der Grenze ein Ende fand, wo sie uns begegneten? Als die Ungarnflut sich dann nach Osten wandte, erkannten die siegreichen Magyaren in den Szeklern – aufgrund einiger Gemeinsamkeiten hinsichtlich Ursprung und Sprache – eine verwandte Rasse und vertrauten uns über Jahrhunderte den Schutz der Grenze zum Türkenreich an. Fürwahr, ein schwerer, endloser Dienst, denn wie sagt der Türke: ›Das Wasser schläft, aber der Feind nie.‹ Welches unter den vier Völkern in unserem Gebiet empfing freudiger das ›blutige Schwert‹ oder scharte sich eiliger hinter des Königs Fahnen? Wann wurde die große Schmach unserer Nation getilgt, die schändliche Niederlage auf dem Amselfeld, wo die Banner der Wallachen und Magyaren vor dem Halbmond in den Staub sanken? Und wer hat dies vollbracht? Ein Mann aus meinem Geschlecht, Woiwode seinerzeit, der die Donau überschritt und die Türken auf ihrem eigenen Boden schlug – ein Dracula! Leider hatte er einen unwürdigen Bruder, der, kaum war er gefallen, sein Volk an die Türken verkaufte, wodurch er es in schmachvolle Knechtschaft brachte! Jedoch beflügelte der erste, der tapfere Dracula, einen bedeutsamen späteren dieses Namens zu großer Tat. Immer und immer wieder fiel er über den großen Strom ins Türkenland ein, wurde zurückgetrieben, versuchte es erneut, kehrte einmal gar als einziger heim aus der blutigen Metzelei, in der all seine Leute den Tod gefunden hatten, und kam doch wieder, weil er wusste, dass nur er letztlich den Sieg würde erzwingen können! Nun behaupten manche, ihm sei es nur um die eigene Macht gegangen. Pah! Was taugen denn Bauern ohne einen Führer? Wie soll ein Krieg ein gutes Ende finden, wenn Hirn und Herz fehlen, ihn zu leiten? Und dann, als unser Stamm nach der Schlacht von Mohács das magyarische Joch abschüttelte, standen wir aus dem Geblüte Dracula wieder in den ersten Reihen. Unser stolzer Geist litt es nicht, dass Ungarn uns die Freiheit vorenthielt. Ja, junger Herr, die Draculas als Herzblut, Hirn und Schwert der Szekler können mit einer Vergangenheit prangen, auf die Emporkömmlinge wie die Habsburger und die Romanows niemals werden zurückblicken können. Allein die kriegerischen Zeiten sind vorbei. Blut ist in diesen Zeiten ehrlosen Friedens ein zu kostbar Ding, und die ruhmreiche Geschichte alter Geschlechter klingt nur noch wie ein Märchen.«
Unterdessen war schon fast wieder Morgen, und so gingen wir zu Bett. (NB: Meine Notizen erinnern erschreckend an Tausendundeine Nacht, wo die Erzählerin auch immer abbricht, wenn der Tag kommt, oder an den Geist von Hamlets Vater, der beim ersten Hahnenschrei verschwinden muss.)
12. Mai. – Ich will mit Tatsachen beginnen, bloßen Tatsachen, mit reinen Gegebenheiten und nüchternen Zahlen, die dokumentarisch belegt und deshalb nicht in Zweifel zu ziehen sind. Ich muss sie scharf von allem Subjektiven trennen, von Dingen, die ich selbst erfahren und beobachtet habe oder an die ich mich erinnere. Gestern abend also kam der Graf aus seinem Zimmer und stellte mir gleich jede Menge Fragen. Sie betrafen rechtliche Angelegenheiten; besonders interessierte ihn, welche Schritte bei der Abwicklung bestimmter Geschäfte zu beachten seien. Nun war ich ziemlich erschöpft, denn ich hatte den ganzen Tag über den Büchern gehockt. Ich wollte unbedingt meinen Geist beschäftigen, und da war mir die Idee gekommen, einfach ein paar der Themen meines letzten Examens vor der Anwaltskammer zu repetieren. Es lag eine gewisse Methode in den Fragen des Grafen. Daher möchte ich sie hier möglichst der Reihe nach wiedergeben. Vielleicht sind mir diese Aufzeichnungen irgendwie oder irgendwann einmal von Nutzen.
Zuerst fragte er mich, ob man sich in England statt einem auch zwei oder mehr Anwälte nehmen dürfe. Ich antwortete, er könne ein ganzes Dutzend engagieren, wenn er wolle. Es wäre aber nicht sehr klug, mehr als einen Anwalt mit einem Geschäft zu befassen, denn es könne doch immer nur einer zur Zeit handeln, und ständig von einem zum anderen zu wechseln würde einen Wirrwarr schaffen, der seinen Interessen heftig zuwiderliefe. Er verstand dies durchaus, schien mir, und schob gleich die nächste Frage hinterdrein. Gesetzt den Fall, er betraute einen Anwalt am Ort A mit Banksachen, und dann ergäbe sich die Notwendigkeit eines Eingreifens am Ort B, einer Hafenstadt etwa, die weit vom Ort A entfernt liegt. Da wäre es doch sinnvoll, man bestellte am Ort B einen zweiten Anwalt, möglichst einen, der in Schifffahrtssachen Bescheid wüsste. Ob das wohl ginge? Ich bat ihn, sich näher zu erklären, schon um zu vermeiden, dass ich ihm falsch riete, und er antwortete: »So lassen Sie mich denn erläutern. Da kauft also unser gemeinsamer Freund Peter Hawkins durch Ihre gütige Beihilfe für mich ein Grundstück. Nun steht die Kanzlei des Mr. Hawkins jedoch im Schatten Ihrer wunderschönen Kathedrale zu Exeter, mein neuer Besitz aber befindet sich fern von dort in London. Es mag Sie befremden, dass ich einen derart entlegenen Sachwalter beauftragte statt einen in London selbst. Wohlan, ich werde Ihnen offen sagen, warum ich so verfuhr. Ich wollte, dass alles einzig nach meinem Wunsche geschehe und sich nicht etwa irgendwelche lokalen Belange hineinmengten. Ein Londoner Anwalt, dachte ich mir, würde vielleicht seine genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse nutzen, um sich selbst oder einem Freunde etwas Gutes zu tun. Deshalb wählte ich einen weitab ansässigen Vermittler, denn ein solcher scheint mir eher die Gewähr zu bieten, dass er wirklich allein meinen Interessen dient.«
Ich erwiderte, bei diesem Vorgehen sähe ich keine Probleme, teilte ihm aber zusätzlich mit, dass es unter uns Advokaten ein Delegierungssystem gibt. Dieses ermögliche es, dass ein nicht ortsansässiger Anwalt einen Kollegen bestimmt, der nach Anweisungen des ersten die Dinge vor Ort regelt. Der Mandant könne seine Sache also unbesorgt in die Hand eines einzigen legen; auch dann sei garantiert, dass seine Wünsche und nur diese zur Geltung kämen.
»Aber«, wandte er ein, »mir bleibt doch unbenommen, es so zu machen wie bisher und meine Anordnungen selbst zu erteilen, finden Sie nicht auch?«
»Natürlich«, bestätigte ich. »Für diesen Weg entscheiden sich Geschäftsleute sogar oft, wenn sie nicht all ihre Angelegenheiten einer einzigen Person zur Kenntnis geben möchten.«
»Schön!«, versetzte er und erkundigte sich dann danach, wie man Schiffstransporte richtig organisiert, welche Formalitäten man erfüllen und mit welchen Schwierigkeiten man rechnen muss; minutiös erörterte er alle nur denkbaren Probleme, die bei einem solchen Unternehmen möglicherweise auftreten, und Methoden, ihnen wirksam zu begegnen. Ich antwortete, so genau ich vermochte; während des Gesprächs gewann ich mehr und mehr den Eindruck, dass er selbst einen ausgezeichneten Anwalt abgegeben hätte, so sorgfältig erwog und kalkulierte er sämtliche Eventualitäten. Für jemanden, der noch nie mein Land besucht und in Geschäftsdingen offenkundig kaum Erfahrungen hatte, waren seine Kenntnisse und sein Scharfblick erstaunlich. Ich erteilte ihm die gewünschten Auskünfte und belegte sie anhand der vor Ort verfügbaren Literatur. Nachdem er sich in allen Punkten, die ihn interessierten, genügend unterrichtet glaubte, erhob er sich plötzlich und fragte: »Haben Sie unserem Freund Mr. Peter Hawkins noch einmal geschrieben? Oder an sonst jemanden Post verschickt?«
Mit einer gewissen Bitterkeit im Herzen verneinte ich. Bisher hätte ich leider keine Gelegenheit gehabt, Briefe zu versenden, an wen auch immer.
»Dann schreiben Sie jetzt, mein junger Freund«, bestimmte er. »Schreiben Sie an unseren Freund und an wen Sie sonst wollen, dass Sie ungefähr noch einen Monat in meinem Schlosse verweilen werden.«
»Möchten Sie denn wirklich, dass ich so lange bleibe?«, fragte ich, denn es überlief mich eiskalt bei dem Gedanken.
»Ich wünsche es fürwahr, ja mehr noch, ich nähme es Ihnen sogar übel, wenn Sie abschlügen. Mit Ihrem Herrn oder Chef oder Arbeitgeber oder wie man das nennt, der Sie als seinen Vertreter eingesetzt hat, ist klipp und klar vereinbart, dass meine Belange in jeder Hinsicht vorgehen. Schließlich zahle ich ja auch, und ich war nicht knauserig – oder etwa doch?«
Was blieb mir übrig? Ich erklärte mich bereit. Hier standen Mr. Hawkins’ Interessen auf dem Spiel, nicht meine, und an ihn musste ich jetzt denken, nicht an mich. Außerdem lag, während Graf Dracula sprach, ein Ausdruck in seinem Blick und seinem Gebaren, der mich daran erinnerte, dass ich ein Gefangener war und mir gar keine andere Wahl blieb, selbst wenn ich unbedingt hätte abreisen wollen. Der Graf erkannte seinen Sieg in meiner zustimmenden Verbeugung und seine Position der Stärke in meinen von innerem Kampf gezeichneten Gesichtszügen. Den Triumph begann er gleich auszunutzen, freilich in seiner gewandten, über alle Widerstände hinweggleitenden Art: »Bitte, mein werter junger Freund, sprechen Sie in Ihren Briefen nur Geschäftliches an. Für Ihre Lieben daheim indes mögen Sie hinzusetzen, dass es Ihnen gutgeht und Sie sich schon auf ein Wiedersehen freuen. Dann sind die froh, und das genügt doch, finden Sie nicht auch?«
Während er dies sagte, reichte er mir drei Bögen und die Kuverts. Sie waren von dünnstem Überseepapier. Ich blickte erst auf sie, dann zu ihm. Er lächelte gelassen, wobei die spitzen Eckzähne über die rote Unterlippe ragten. Da begriff ich so klar, als hätte er es ausgesprochen, was er mir bedeuten wollte: ich sollte vorsichtig sein bei meiner Korrespondenz, denn ich müsste damit rechnen, dass er alles läse. Ich beschloss deshalb, dem Grafen die gewünschten förmlichen Schreiben zu liefern – eins für Mr. Hawkins, eins für Mina –, insgeheim aber beiden eine Nachricht zu schicken, welche die volle Wahrheit enthüllte. Die Botschaft an meine Braut würde ich in Stenographie verfassen, denn Mina beherrscht diese, der Graf hingegen wohl kaum; selbst wenn er das Blatt zu Gesicht bekäme – er könnte es nicht enträtseln. Nachdem ich meine beiden offiziellen Briefe beendet hatte, saß ich eine Weile still und las. Währenddessen schrieb der Graf seinerseits ein paar Zeilen, wobei er immer wieder ein paar der Bücher auf seinem Tisch zu Rate zog. Dann legte er meine Briefe zu den seinen und trug sein Schreibzeug hinaus. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, beugte ich mich über seine Briefe, die mit der Schriftseite nach unten lagen, und drehte sie um. Skrupel hatte ich dabei keine, denn in meiner Situation, so glaube ich, muss ich jede Möglichkeit nutzen, mich zu schützen.
Die Adressen lauteten: erstens »Samuel F. Billington, 7, The Crescent, Whitby«; zweitens »Herrn Leutner, Warna«; drittens »Coutts & Co., London« und viertens »Herren Klopstock & Billreuth, Bankiers, Budapest«. Der zweite und der vierte Umschlag waren noch unversiegelt. Eben wollte ich nach dem Inhalt schauen, als ich sah, dass sich die Türklinke bewegte. Mir blieb gerade noch Zeit, die Briefe wieder so hinzulegen, wie sie gelegen hatten, mich in meinen Sessel sinken zu lassen und mein Buch zu ergreifen, ehe der Graf, ein fünftes Schreiben in der Hand, das Zimmer betrat. Er wandte sich wieder den Briefen auf dem Tisch zu, nahm einen nach dem anderen und frankierte jeden sorgfältig. Dann richtete er erneut das Wort an mich: »Sie sind mir gewiss nicht gram, dass ich nun gehe; ich habe heute abend noch sehr viel privat zu erledigen. Aber ich hoffe, Sie werden alles vorfinden, was Sie brauchen.«
An der Tür drehte er sich noch einmal um, zögerte kurz, dann fuhr er fort: »Ein Rat, mein lieber junger Freund – oder nein, eine Warnung, und zwar in allem Ernst. Wenn Sie diese Räume verlassen und andere Teile des Schlosses aufsuchen, vermeiden Sie unbedingt, dort einzuschlafen. Das Schloss ist alt und birgt viele Erinnerungen und hält böse Träume für jeden bereit, der seinen Schlummerplatz unbedacht wählt. Seien Sie denn gewarnt! Sollten Sie irgendwann spüren, dass der Schlaf Sie zu übermannen droht, so eilen Sie beim geringsten Anzeichen sofort in Ihr Zimmer oder eines dieser Gemächer, denn nur hier werden Sie in Sicherheit ruhen. Sind Sie in dieser Hinsicht jedoch unachtsam, dann –« Es wirkte unheimlich, wie er an dieser Stelle seine Rede abbrach, zumal er dabei mit seinen Händen eine Bewegung machte, die andeuten sollte: dann wasche er diese in Unschuld. Ich verstand ihn vollkommen. Freilich bezweifelte ich, dass je ein Traum schrecklicher sein konnte als das Unnatürliche und Schaurige, das Grauenvolle und Mysteriöse, das ich in diesen Mauern wach erlebe und das sich wie ein Netz um mich zu schließen scheint.
Später. – Den letzten Satz meiner vorigen Eintragung kann ich nur voll unterstreichen. Nur ist inzwischen jeder Zweifel entschwunden. Ich werde ohne Furcht schlafen, wo ich will – Hauptsache, ›er‹ ist nicht in der Nähe. Zusätzlich habe ich das Kruzifix über das Kopfende meines Bettes gehängt, und dort soll es bleiben, denn so, denke ich, ist meine Ruhe freier von Träumen.
Nachdem also der Graf sich verabschiedet hatte, ging ich in mein Zimmer zurück. Ich wartete eine Weile und lauschte, und als ich keinen Laut mehr hörte, verließ ich den Raum wieder und stieg die steinerne Treppe empor bis zu der Stelle, von der aus man nach Süden schauen kann. Die weite Ebene barg eine kleine Ahnung von Freiheit, verglichen mit der dunklen Enge des Hofes – einer Freiheit allerdings, die mir für den Moment unerreichbar blieb. Gerade dieser Ausblick ließ mich nur umso stärker fühlen, dass ich in einem Gefängnis steckte. Mir war, als müsste ich dringend einen Hauch frischer Luft einsaugen, und sei es Nachtluft. Ich spüre, dass diese nächtliche Lebensweise an mir zehrt. Sie zerschleißt meine Nerven. Ich erschrecke vor meinem eigenen Schatten und bilde mir die grausigsten Dinge ein. Gott weiß, dass dieser verwünschte Ort Grund genug zu entsetzlicher Angst bietet! Ich sah hinaus auf die wunderschöne Weite, die sanfter gelber Mondschein taghell überströmte. In dem weichen Licht verschwammen die Umrisse der fernen Berge, und die Schatten in den Tälern und Schluchten gewannen samtene Schwärze. Ich beugte mich ein wenig aus dem Fenster, da nahm etwas meinen Blick gefangen, das sich ein Stockwerk tiefer bewegte, sozusagen halblinks unter mir. Nach Lage der Räume konnten die betreffenden Fenster nur zum Zimmer des Grafen gehören. Das Fenster, an dem ich stand, war hoch und durch dickes Mauerwerk geschlagen. Es hatte ein steinernes Mittelkreuz, verwittert zwar, aber noch ganz gut erhalten. Sollte es indes je einen Rahmen besessen haben, musste dies länger her sein. Ich verbarg mich hinter dem Steinpfeiler und spähte vorsichtig hinaus.
Als erstes entdeckte ich, dass unten der Graf seinen Kopf aus dem Fenster steckte. Zwar sah ich sein Gesicht nicht, doch erkannte ich ihn an der Form des Rückens und des Halses sowie an seinen typischen Bewegungen. Mehr noch freilich verrieten ihn seine Hände, die ich ja schon oft in Augenschein genommen hatte. Zuerst reagierte ich interessiert und fast belustigt. Man muss wahrhaft staunen, wie wenig es bedarf, um Interesse und Amüsement bei jemandem zu erregen, der gefangen sitzt. Aber was ich jetzt sah, wandelte meine Empfindungen zu Abscheu und Entsetzen. Denn nun schob der Graf langsam seinen ganzen Körper aus dem Fenster und begann, mit dem Kopf nach unten an der Schlossmauer hinabzukriechen, während sein Mantel sich wie ein Paar gewaltiger Flügel um ihn bauschte. Anfangs traute ich meinen Augen nicht. Da spielte mir wohl, dachte ich, das Mondlicht einen Streich mit irgendeinem tollen Schatteneffekt. Doch beobachtete ich weiter, und schließlich musste ich mir eingestehen: nein, es war keine Täuschung. Ich sah genau, wie seine Finger und Zehen die Steine um die Kanten packten, zwischen denen nach all den Jahrhunderten kaum noch Mörtel saß. Indem er so jede Vorkragung und jede Unebenheit nutzte, kletterte er wie eine Eidechse die Mauer hinunter.
Was ist das für ein Mensch, oder vielmehr, was für eine Kreatur verbirgt sich da in Menschengestalt? Der Schrecken dieses grauenvollen Ortes überwältigt mich; ich fühle nur noch Angst, entsetzliche Angst, und nirgendwo zeigt sich ein Ausweg. Ich bin von furchtbaren Bedrohungen umringt, die ich mir gar nicht näher vorstellen mag.
15. Mai. – Wieder habe ich den Grafen nach Eidechsenart aus dem Schlosse klettern sehen. Er stieg erst etwa hundert Fuß in schräger Linie hinab, dann noch ein gutes Stück waagerecht nach links. Schließlich verschwand er in irgendeinem Loch oder Fenster. Kaum sah ich seinen Kopf nicht mehr, beugte ich mich hinaus und spähte, gewann aber keinen weiteren Aufschluss: zu große Entfernung, ungünstiger Blickwinkel. Immerhin wusste ich jetzt, dass er das Schloss verlassen hatte. Die Gelegenheit wollte ich nutzen, mehr zu erforschen, als ich bisher gewagt hatte. Ich ging in mein Zimmer zurück und holte eine Laterne. Dann probierte ich eine Tür nach der anderen. Sie waren, wie nicht anders zu erwarten, alle verschlossen; die Schlösser erwiesen sich übrigens als verhältnismäßig neu. Da ich hier nicht weiterkam, stieg ich die steinerne Treppe hinab und gelangte in die Halle, durch die ich vor zehn Tagen das Schloss erstmalig betreten hatte. Die Riegel am Tor ließen sich recht leicht zurückschieben, die großen Ketten ohne weiteres aushaken – aber der Schlüssel fehlte! Dieser musste sich im Zimmer des Grafen befinden. Es galt also zu prüfen, ob seine Tür vielleicht unverschlossen war. Dann könnte ich mir den Schlüssel greifen und entfliehen. Ich erkundete also weiter gründlich das Treppenhaus Podest um Podest und Korridor um Korridor und probierte sämtliche Türen. Ein oder zwei kleinere Zimmer nahe der Halle waren offen, aber es befand sich darin nur altes Mobiliar, mottenzerfressen und vom Staub der Jahrhunderte bedeckt. Schließlich entdeckte ich aber am oberen Ende der Treppe eine Tür, die erst verschlossen schien, dann aber doch etwas nachgab. Ich drückte stärker, und da zeigte sich, dass sie gar nicht verschlossen war; der Widerstand rührte daher, dass die Angeln sich gesenkt hatten und die schwere Tür auf dem Boden lehnte. Hier bot sich mir eine Möglichkeit, die so rasch gewiss nicht wiederkehren würde. Ich nahm also meine ganze Kraft zusammen und schaffte es nach mancherlei Mühe, die Tür so weit zurückzuschieben, dass ich hineinkonnte. Jetzt befand ich mich in dem Flügel des Schlosses, der sich rechts der mir bekannten Räumlichkeiten hinzog, nur ein Stockwerk tiefer. Ich schaute durch mehrere Fenster und erkannte so, dass diese Zimmerreihe zum Südteil des Schlosses gehört; die Fenster im Raum am Ende des Ganges blickten sowohl nach Westen als auch nach Süden. Zu beiden Seiten gähnt ein tiefer Abgrund. Das Schloss wurde auf einem mächtigen Felsen direkt am Rand errichtet, so dass es von drei Seiten her uneinnehmbar ist. An derart hoher Stelle, wohin weder Schleuder noch Bogen noch Feldschlange reichen, konnte man sich große Fenster erlauben. Dieses Zimmer musste nicht gegen feindliche Attacken geschützt werden; das verraten gleich die Helligkeit, die darin herrscht, und die Behaglichkeit der Einrichtung. Gegen Westen zieht sich ein weites Tal; dahinter erhebt sich, Gipfel an Gipfel, ein Wall gezackter Berge. Die steilen Wände sind bewachsen mit Eschen und Dornbüschen, deren Wurzeln sich in den Spalten, Rissen und Ritzen des Gesteins festklammern. Dieser Trakt des Schlosses wurde ehedem offenbar von den Damen bewohnt, denn die Möbel machten einen komfortableren Eindruck als alle, die ich hier bisher sah. Die Fenster hatten keine Vorhänge. Das gelbe Mondlicht flutete durch die rautenförmigen Scheiben. In ihm erkannte man sogar Farben, und es verlieh der Szenerie einen milderen Ausdruck, auch dem reichlich vorhandenen Staub, der über allem lag und bis zu einem gewissen Grad die Spuren der Zeit und der Motten verbarg. Meine Laterne vermochte wohl nicht viel in dem strahlenden Mondschein, und doch war ich froh, sie bei mir zu haben, denn eine Atmosphäre grausiger Einsamkeit hing über dem Ort, die mir kalt ans Herz rührte und meine Nerven erzittern ließ. Aber ich war lieber hier allein als in den Räumen oben, die mir der Graf durch seine gelegentliche Anwesenheit vergällte. Ich versuchte, meine Nerven ein wenig zu disziplinieren, was mir schließlich auch gelang, und eine sanfte Ruhe kam über mich. Hier sitze ich nun an einem kleinen Eichentisch, an dem einst vielleicht ein holdes Fräulein gedankenverloren und unter ständigem Erröten einen Liebesbrief zu Papier brachte, voller Gefühl und voller Grammatikfehler, und schreibe stenographisch in mein Tagebuch, was sich seit der letzten Eintragung alles ereignet hat. Damit setze ich trotzig ein Zeichen, dass wir uns im 19. Jahrhundert befinden. Und doch, wenn mich meine Sinne nicht trügen, hatten und haben die vergangenen Jahrhunderte ihre ureigene Wirkmächtigkeit, der pure ›Modernität‹ nicht den Garaus machen kann.
Später: 16. Mai, morgens früh. – Gott bewahre mir meinen Verstand! All mein Begehren ist auf diesen Wunsch geschrumpft. Der Glaube, an diesem Orte könne ich sicher sein oder mich auch nur sicher fühlen – vorbei und vorüber. Für das Weiterleben hier gibt es für mich nur eines zu hoffen: eben dass ich nicht wahnsinnig werde – das heißt, wenn ich es nicht schon bin. Sollte mein Verstand aber noch intakt sein, werde ich bestimmt bei dem Gedanken verrückt, dass von allen Greueln, die in diesem hassenswerten Schlosse lauern, der Graf noch nicht einmal das furchtbarste ist. Im Gegenteil, er als einziger wird mir vielleicht Schutz bieten, und sei es nur so lange, wie ich seinen Zwecken diene. Großer Gott! Gnädiger Gott! Lass mich Ruhe bewahren, sonst ist unfehlbar der Wahnsinn mein Los. Jetzt verstehe ich vieles besser, das sich mir früher nicht erschließen wollte. Zuvor begriff ich nie, was Shakespeare meinte, wenn er seinen Hamlet sagen lässt: »Schreibtafel her! Ich muss mir’s niederschreiben« etc. Aber jetzt, da mein Hirn aus den Fugen gerät oder ich wenigstens befürchten muss, dass der erlebte Schock es irgendwann völlig matt setzt, suche ich selbst nach einer Schreibgelegenheit: nach meinem Tagebuch. Ich will mir zur strikten Regel machen, den Gang der Ereignisse getreulich zu protokollieren; das könnte mich ablenken und meine Pein lindern.
Die mysteriöse Warnung des Grafen hatte mich seinerzeit erschreckt. Jetzt bereitet sie mir noch mehr Entsetzen, denn künftig hat er mich furchtbarerweise noch mehr in der Gewalt. Ich werde wohl kaum wieder wagen, seine Worte in Zweifel zu ziehen!
Als ich meine Eintragungen verrichtet und Buch wie Stift zufrieden in die Tasche gesteckt hatte, wurde ich plötzlich müde. Zwar erinnerte ich mich an die Warnung des Grafen, aber ich machte mir ein Vergnügen daraus, sie zu ignorieren. Ich war nun einmal schläfrig, und so überkam mich auch der Starrsinn, der dem Schlaf gewöhnlich vorausgeht. Das weiche Mondlicht wirkte besänftigend, und die weite Landschaft draußen gab mir ein wohliges Gefühl von Freiheit ein. Nein, heute nacht wollte ich nicht in meine düsteren Gemächer oben zurück, durch die das Grauen geisterte; hier wollte ich liegen, wo einst die edlen Frauen saßen und sangen oder sich sonst einem angenehmen Zeitvertreib hingaben, während sie sich sehnsuchtsvoll nach ihren Männern verzehrten, die fern in gnadenlosen Kriegen kämpften. Ich rückte eine große Couch aus der Ecke in die Mitte des Raumes und plazierte sie so, dass ich die herrliche Aussicht nach Westen und Süden genießen konnte. Die dicke Staubschicht auf dem Möbel bemerkte ich nicht, und hätte ich sie wahrgenommen, wäre sie mir auch egal gewesen. Ohne also derartige Umstände zu bedenken, legte ich mich zum Schlafen hin.
Ich muss dann tatsächlich eingeschlummert sein. Zumindest würde ich mir dies wünschen. Leider aber wirkte, was sich anschließend ereignete, erschreckend real, so real jedenfalls, dass ich jetzt im hellen Morgensonnenschein ganz und gar nicht glauben kann, dass ich alles nur geträumt habe.
Ich hatte plötzlich Gesellschaft. Insgesamt sah das vom Mondschein erleuchtete Zimmer noch aus wie eben; am Boden erkannte ich in der uralten Staubschicht meine Fußspuren. Alles unverändert also, nur saßen jetzt mir gegenüber in besagtem Mondschein drei junge Frauen, nach Kleidung und Gebaren edle Damen. Als ich sie erblickte, glaubte ich erst doch zu träumen, denn obwohl das Mondlicht hinter ihnen einfiel, warfen sie keinen Schatten auf dem Boden. Sie kamen näher, betrachteten mich eine Weile und flüsterten miteinander. Zwei von ihnen hatten dunkle Haare und hohe Adlernasen wie der Graf, dazu große dunkle, durchdringende Augen, die im blassgelben Mondlicht fast rot wirkten. Die dritte war hübsch, so hübsch, wie man es sich nur denken kann, mit dichten goldenen Haaren und saphirhellen Augen. Ihr Gesicht kam mir flüchtig bekannt vor, aber ich erinnerte mich nicht, wo und wann ich sie schon einmal gesehen hatte; vielleicht in einem früheren Angsttraum. Alle drei hatten blendend weiße Zähne, die wie Perlen zwischen dem Rubinrot ihrer Lippen schimmerten. Von den dreien ging etwas aus, das mir Unbehagen verursachte; irgendwie verlangte ich nach ihnen und empfand zugleich Todesfurcht. Ich spürte in meinem Herzen ein sündiges, brennendes Begehren danach, dass mich ihre roten Lippen küssten. Ich notiere das nicht gern, denn vielleicht liest eines Tages Mina diese Zeilen und fühlt sich verletzt. Aber es ist die Wahrheit. Die Frauen flüsterten weiter miteinander, dann lachten sie: ein silbernes, melodisches Lachen, aber eben metallisch, so hart, wie es die Weichheit menschlicher Lippen schwerlich hervorbringen kann. Mich erinnerte es an die unerträglich süßen Töne, die entstehen, wenn eine kundige Hand mit feuchtem Finger über den Rand von Wassergläsern reibt. Das hübsche Mädchen schüttelte kokett den Kopf, aber die beiden anderen drängten sie, und die zweite sagte: »Geh schon. Du zuerst und dann wir. Dir gebührt der Vortritt.« Die dritte fügte hinzu: »Er ist jung und stark; das gibt Küsse genug für uns alle.«
Regungslos lag ich da in wonniger, qualvoll gespannter Erwartung. Durch die Augenlider blinzelnd, nahm ich wahr, was geschah. Die Hübsche trat näher und beugte sich über mich; schon spürte ich ihren Atem. Er war süß, honigsüß und jagte mir die gleichen Schauer durch die Nerven wie ihre Stimme; doch in der Süße steckte etwas Bitteres, eine widerwärtige Bitterkeit: So riecht und so schmeckt – Blut.
Ich wagte nicht, die Augen ganz aufzuschlagen; so öffnete ich nur einen schmalen Schlitz, konnte aber durch die Wimpern spähend alles deutlich erkennen. Das Mädchen kniete nieder, beugte sich erneut über mich und verharrte eine Weile in verzückter Betrachtung. Da war eine Lüsternheit, die bewusst langsam und bedacht vorging; eben dadurch wirkte sie erregend und abstoßend gleichermaßen. Als sie den Nacken bog, leckte sie sich die Lippen – man kann es nicht anders sagen – wie ein Tier; im Licht des Mondes sah ich die Feuchtigkeit auf ihren scharlachroten Lippen und ihrer roten Zunge glänzen, mit der sie sich ständig über ihre spitzen weißen Zähne fuhr. Tiefer und tiefer neigte sich ihr Kopf; ihre Lippen schwebten dicht an meinem Mund und meinem Kinn vorbei und verharrten über meiner Kehle, wo ihr Ziel zu sein schien. Doch wieder hielt sie einen Augenblick inne und leckte sich Zähne und Lippen – der Laut ging mir durch und durch. Ich spürte ihren heißen Atem auf meinem Hals. Die Haut an meiner Kehle begann zu prickeln, wie es geschieht, wenn eine Hand, die uns kitzeln will, sachte heranrückt, näher und noch näher. Endlich fühlte ich auf meiner hochempfindlichen Haut an meiner Kehle die sanfte Berührung ihrer Lippen, die mich erschauern ließ, dann aber gleich auch den harten Stich zweier scharfer Zähne, die freilich noch nicht zustießen, sondern die Fläche unter sich nur eindellten und in dieser Position verharrten. Ich schloss die Augen in schwülem Sinnestaumel und wartete, wartete klopfenden Herzens.
Im selben Moment jedoch durchfuhr mich eine andere Wahrnehmung wie ein Blitz. Und ich wusste: der Graf war zurück. Ein Sturm des Zornes schien mit ihm ins Zimmer zu fegen. Ich öffnete unwillkürlich meine Augen, und da sah ich ihn. Seine starke Hand packte den schmalen Hals der Schönen im Nacken und riss sie mit Riesenkraft zurück. Auch sie geriet außer sich. Wut entstellte ihre Augen, Tobsucht ließ ihre Zähne knirschen und leidenschaftliche Empörung ihre Wangen erglühen. Und erst der Graf! Nie hätte meine Phantasie gereicht, mir solchen Grimm, solche Raserei auszumalen, nicht einmal bei den Dämonen der Unterwelt. Seine Augen sandten förmlich Flammen. Sie leuchteten in grellem Rot, als loderte hinter ihnen das Feuer der Hölle. Die Züge des totenbleichen Gesichts waren starr und hart wie Walzdrähte; die dicken Brauen, welche über der Nase zusammenstießen, waren jetzt wie Blöcke weißglühenden Metalls. Mit einem ungestümen Schwung seines Armes schleuderte er die Frau von sich und bewegte sich dann auf die anderen zu, als wollte er sie durch Schläge zurücktreiben. Es war die gleiche herrische Geste, die gegenüber den Wölfen Anwendung gefunden hatte. Mit einer Stimme, die, obwohl sie leise sprach, ja fast flüsterte, durch die Luft zu schneiden und an den Wänden widerzuhallen schien, wies der Graf die Damen zurecht: »Wie könnt ihr es wagen, ihn anzurühren? Wie könnt ihr es wagen, auch nur die Augen auf ihn zu richten, wo ich es euch doch ausdrücklich verboten habe, euch allen dreien? Zurück, sage ich euch! Dieser Mann gehört mir! Seht ja zu, dass ich euch nicht wieder bei ihm antreffe, oder ihr bekommt es mit mir zu tun.«
Das schöne Mädchen drehte sich um und erwiderte: »Du hast eben nie geliebt, und du wirst auch nie lieben!« Dabei lachte sie kokett und frivol, und die beiden anderen fielen ein. Das Gelächter, das nun den Raum erfüllte, klang aber so freudenleer, hart und seelenlos, dass mir fast die Sinne schwanden. So musste es sich anhören, wenn Teufel scherzten. Der Graf betrachtete eine Weile aufmerksam mein Gesicht. Dann wandte er sich wieder den Frauen zu und flüsterte sacht:
»O doch, ich kann lieben; ihr wisst es doch selbst noch von früher, oder etwa nicht? Wohlan, ich verspreche euch: wenn ich mit ihm fertig bin, dürft ihr ihn küssen, wie es euch behagt. Jetzt aber geht! Geht! Ich muss ihn wecken; es gibt noch eine Menge zu erledigen.«
»Und wir bekommen heute gar nichts? Oder ist das da für uns?«, fragte eine der drei und deutete zu einem Sack hin, den er auf den Boden geworfen hatte und der sich bewegte, als steckte etwas Lebendiges darinnen. Der Graf nickte. Eine der Frauen stürzte vor und öffnete den Sack. Wenn mich meine Ohren nicht täuschten, vernahm ich ein leises Stöhnen und Wimmern, wie von einem halb verröchelten Kind. Die Frauen drängten sich um die Gabe, während ich vor Schrecken erstarrte. Als ich endlich doch genauer hinsah, verschwanden sie und mit ihnen das fürchterliche Bündel. Wohlverstanden, sie verließen den Raum nicht auf gewöhnliche Weise. Nahe bei ihnen befand sich keine Tür, nur in einer weiter entfernten Wand, und um zu der zu gelangen, hätten sie an mir vorbeigemusst, und das wäre mir nicht entgangen. Sie schienen einfach in den Strahlen des Mondes zu zerfließen und durch das Fenster zu entweichen, denn ich erkannte für einen Moment noch draußen die verschwommenen, schattenhaften Umrisse ihrer Gestalten, ehe sie sich ganz auflösten. Dann überwältigte mich das Grauen, und ich sank bewusstlos zu Boden.