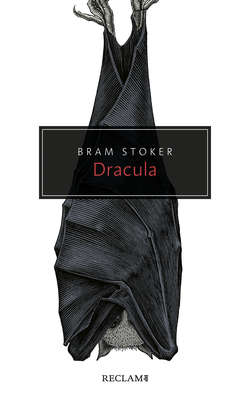Читать книгу Dracula - Bram Stoker - Страница 19
Mina Murrays Tagebuch
Оглавление26. Juli. – Ich bin unruhig; da verschafft es mir doch Erleichterung, hier zu äußern, was mich bewegt. Das ist so, als flüsterte ich mir selbst etwas ins Ohr und hörte mir gleichzeitig zu. Auch sehen in stenographischen Zeichen die Dinge anders aus als in Kurrentschrift. Ich mache mir Sorgen um Lucy. Und um Jonathan. Wochenlang gab es ja kein Lebenszeichen, da erreichte mich heute endlich Post von ihm, freilich nicht direkt, sondern über Mr. Hawkins. Den hatte ich schriftlich gebeten, mir gleich mitzuteilen, wenn Jonathan sich melde. Und tatsächlich, gestern traf in seiner Kanzlei ein Brief aus Transsilvanien ein, und Mr. Hawkins, freundlich und zuvorkommend, wie er ist, schickte ihn mir prompt. Leider besteht das Schreiben – datiert »Schloss Dracula, 19. Juni« – nur aus einer Zeile, die besagt, dass er sich nun auf den Heimweg mache. Seltsam, derlei entspricht so gar nicht Jonathans Gepflogenheiten; sehr merkwürdig, das Ganze, ja beängstigend. – Mit Lucy stimmt auch etwas nicht. Sie ist ja im ganzen wohlauf und guter Dinge – und doch hat sie einen Rückfall erlitten: seit kurzem schlafwandelt sie wieder. Ihre Mutter hat es mir gesagt. Sie und ich haben daher ausgemacht, dass ich jede Nacht die Tür unseres Zimmers abschließe und den Schlüssel an mich nehme. Mrs. Westenra weiß nur zu genau, was man von Schlafwandlern so erzählt: sie spazieren über Dachfirste und an Klippenrändern, und wenn sie plötzlich erwachen, stürzen sie mit einem grässlichen, weithin widerhallenden Schrei in die Tiefe. Die Ärmste! Sie ist natürlich furchtbar besorgt um ihre Tochter, zumal ihr Ehemann – Lucys Vater – einst die gleiche Angewohnheit hatte. Mitten in der Nacht, so verriet mir Mrs. Westenra, verließ ihr Gatte sein Bett, zog sich an und ging fort; glücklicherweise gelang es manchmal, ihn aufzuhalten. Lucy hat ja im Herbst Hochzeit, und sie überlegt schon, welches Kleid sie dann trägt und wie sie später ihr Heim einrichtet. Ich verstehe das und nehme lebhaften Anteil daran; schließlich trage ich mich auch mit Heiratsplänen. Doch werden Jonathan und ich unser gemeinsames Leben eher bescheiden beginnen, denn wir können schon froh sein, wenn wir so halbwegs über die Runden gelangen. Mr. Holmwood – oder, korrekter gesagt, Sir Arthur Holmwood, der einzige Sohn des Lord Godalming – will uns besuchen, und zwar so bald wie irgend möglich; im Moment muss er sich um seinen Vater kümmern, dem es gesundheitlich gar nicht gutgeht. Keine Frage, meine liebe Lucy zählt die Sekunden, bis sie ihren Arthur endlich in die Arme schließen kann. Sie möchte ihn hier hochführen zu diesem Friedhof, mit ihm auf dieser Bank dicht am Abhang sitzen und ihm die Schönheit Whitbys zeigen. Ich glaube fast, die Warterei ist die Hauptursache für Lucys Beschwerden. Wenn Arthur kommt, werden sie bestimmt vergehen.
27. Juli. – Immer noch keine neue Post von Jonathan. So langsam wird mir dies unheimlich, ohne dass ich sagen könnte warum. Aber eins steht fest: Ich wünsche sehnlichst, dass er schreibt, und wäre es nur eine einzige Zeile. Lucy schlafwandelt mehr denn je. Keine Nacht vergeht, in der sie nicht durchs Zimmer läuft und ich davon wach werde. Zum Glück haben wir so warmes Wetter, dass sie sich nicht erkälten kann; aber die Sorge um sie und das ständige Hochschrecken aus dem Schlaf zehren allmählich an mir; ich werde nervös und finde selbst keine Ruhe. Gott sei Dank ist Lucys Gesundheit sonst stabil. Mr. Holmwood musste plötzlich auf Schloss Ring, den Stammsitz seiner Familie; der Zustand des Vaters hat sich verschlimmert. Lucy bekümmert dies natürlich, denn jetzt dauert es noch länger, bis sie Arthur wiedersieht; doch bisher hat der Gram ihr Äußeres nicht beeinträchtigt. Sie hat ein wenig zugenommen, und ihre Wangen schimmern in einem hübschen Rosa. Insgesamt schaut sie nicht mehr so blutarm aus wie einst. Ich bete darum, dass dies alles so bleibt.
3. August. – Wieder eine Woche vorbei und immer noch keine Nachricht von Jonathan. Auch Mr. Hawkins hat keine Post bekommen, wie er mir mitteilte. Jonathan wird doch nicht krank sein? Aber dann könnte er mir ja wenigstens das schreiben. Ich schaue mir immer wieder seinen letzten Brief an; indes habe ich nach wie vor die Empfindung, dass mit dem etwas nicht stimmt. Zwar ist es seine Handschrift, kein Zweifel, aber so schreibt er einfach nicht. – Lucys Schlafwandelei hat in der letzten Woche etwas nachgelassen; doch beobachte ich an ihr neuerdings, wenn sie des Nachts herumspaziert, eine gespannte Konzentration, die ich nicht begreife. Selbst in ihrem somnambulen Dämmer scheint sie mich genau zu beobachten. Oft geht sie zur Tür, findet diese verschlossen, gibt dann aber nicht auf, sondern sucht im ganzen Zimmer nach dem Schlüssel.
6. August. – Wieder drei Tage vorbei und keine Nachricht. Diese Spannung wird allmählich zur grässlichen Pein. Wenn ich nur wüsste, wohin ich schreiben soll oder wo ich ihn finde, wäre mir leichter. Aber seit seinem letzten Brief hat niemand mehr ein Wort von Jonathan gehört oder gelesen. Ich kann nichts tun, außer Gott zu bitten, dass er mir Geduld schenkt. Lucy ist erregbarer denn je, aber sonst stabil. Letzte Nacht gab es bedrohlichen Wind, und die Fischer meinen, wir bekämen schweren Sturm. Ich muss die Natur genau beobachten und die Wetterzeichen zu deuten lernen. Heute ist ein grauer Tag. Während ich dies schreibe, steht die Sonne hoch über Kettleness, allerdings hinter dicken Wolken verborgen. Alles ist grau, bis auf das grüne Gras, welches leuchtet wie ein Smaragd. Erdgraue Felsen, graue Wolken, von der Sonne in ihrem Rücken rötlich getönt, hängen über dem grauen Meer, in das die Sandbänke wie graue Finger hineinragen. Die Brandung wälzt sich über Untiefen und Sandbänke hinweg zum Strand, in ihrem Gebrüll nur gedämpft durch Nebelschwaden, die von der See her landeinwärts treiben. Auch der Horizont verliert sich in grauem Dunst. Gewaltigkeit, wohin man schaut: die Wolken hochgetürmt wie Felsgiganten und über dem Meer ein Grumpeln, welches klingt wie die Prophezeiung eines nahen Unheils. Am Strand hier und da dunkle Gestalten, halb verhüllt vom Nebel, wandernden Bäumen gleich. Die Fischerboote hasten heimwärts, rucken auf der Dünung hoch und nieder, ehe sie, eingetaucht bis zu den Speigatten, in den Hafen zurückkehren. Ach, da kommt ja der alte Mr. Swales. Er steuert genau auf mich zu, und an der Art, wie er den Hut hebt, erkenne ich gleich, dass er mit mir reden will …
So, jetzt weiß ich: in dem armen alten Mann ist eine Veränderung vorgegangen, eine Veränderung, die mich tief berührt hat. Doch der Reihe nach. Mr. Swales setzte sich also neben mich, dann begann er in sehr sanftem, freundlichem Ton: »Wollt Ihnen noch was sagen, Miss.«
Ich merkte, dass ihm das Ganze nicht leichtfiel, und so nahm ich seine arme, alte, runzlige Hand und ermunterte ihn, nur freiheraus zu sprechen. Und während er stets seine Hand in der meinen ließ, erklärte er: »Also, meine Beste, ich hab da vorige Woche ’n paar fiese Dinger abgeschnoddert über die Toten et cetera pp. Hat Sie bestimmt hundsgemein schockiert. War aber alles bloß’n Witz, ehrlich. Immer dran denken, ja, Miss? Vor allem später, wenn ich mal nicht mehr bin. Wir alten Leutchen, wir hams ja nu mal’n bisschen anner Birne. Außerdem stehn wir ja immer mit ein Fuß schon inner Grube; da befassen wir uns gar nich gern mit, ich mein, mit’m Tod und so, weil wir uns nich gern fürchten tun. Und da hab ich halt mein Herz um paar Gramm erleichtern wolln, indem ich Spökes gemacht hab. Bloß hilft ja alles nix, Freund Hein, der kommt – nee, nich zu Ihnen, Miss, noch lange nich, Gott bewahre. Zu mir! Ich persönlich hab keine Angst vorm Tod, ich will nur nich sterben, bevor’s unbedingt sein muss. Aber jetzt muss ich wohl. Der da ohm hat mich ja ganz schön alt werden lassen, und dass man die Hundert vollmachen darf, da gibt’s kein’ Anspruch drauf. Ich bin dicht anner Grenze; der Knochenheinz hat sich bestimmt schon seine Sense geschnappt und macht nu fleißig Wetzemann und Söhne. Sehnse, ’n bisschen muss ich die Sache halt immer noch bejuxen, eingefahrne Gewohnheit, legt man eben nich so schnell ab. Was soll’s, wird alles in die große Waage geworfen. Nicht lange mehr, und der Todesengel bläst seine Trompete auch für mich! Ach mein Liebchen, nu lass doch die Schleusen zu« – er hatte bemerkt, dass ich weinte –; »glaub mir, selbst wenn er heute nacht noch käm, würd ich mich nicht sträuben. Leben bedeutet schließlich auch nur warten, dass etwas anders wird, und in der Beziehung ist der Tod das einzige, worauf wir uns unbedingt verlassen können. Soll er komm, Herzchen, meinetwegen auch rasch. Kann sein, er greift schon jetzt nach mir, während wir noch gucken, ob er kommt, und rätseln, wann er kommt. Vielleicht steckt er in dem Wind da draußen überm Meer; das ist so recht ein Wind, der Schiffe zerstört und versenkt, der Leben vernichtet, der Leid und Trauer und Verzweiflung bringt. Gehmse acht! Gehmse acht!«, schrie er plötzlich. »Da ist was in diesem Wind, da haucht was von drüben her, das klingt nach Tod und sieht aus nach Tod und riecht nach Tod. Es liegt in der Luft, und es kommt her, ich spür’s.« Er nahm den Hut ab und hielt die Arme in frommer Geste empor. Seine Lippen bewegten sich, als spräche er ein Gebet. Er schwieg ein paar Minuten, dann erhob er sich, schüttelte mir die Hand, segnete mich, sagte mir Lebewohl und humpelte davon. Die Szene hat mich zutiefst berührt – und zutiefst erschüttert.
Ich war froh, als schließlich der Küstenwart des Weges kam. Wie immer trug er sein Fernrohr unterm Arm. Er hat sich zur Gewohnheit gemacht, ein paar Worte mit mir zu wechseln, wenn wir uns begegnen. Er tat dies auch heute, doch unterbrach er sich immer wieder und schaute durchs Glas, denn er hatte weit draußen ein fremdes Schiff gesichtet.
»Ich kann nicht genau bestimmen, was es für eines ist«, erklärte er. »Vom Aussehen her würde ich sagen: ein russisches. Aber dass die Brüder so schlecht navigieren, wäre mir neu. Das Ding zappelt ja rum wie nicht gescheit. Ganz als hätten die guten Leute gar keinen Kurs. Übrigens, sehen die gar nicht, dass da Sturm kommt? Doch, ich denke schon, den haben sie bemerkt. Aber offenbar können sie sich nicht entscheiden, wohin sie nun sollen: nordwärts in die offene See oder in unseren Hafen? Jetzt guck dir das an! Was ist denn das für ein Steuern? Also, wenn da überhaupt einer am Rad dreht, dann scheint es den Kahn nicht sehr zu kümmern. Der ändert ja bei jedem Windstoß die Richtung. Tja also, mit dem Gefährt werden wir wohl noch so einiges erleben bis morgen um diese Zeit.«