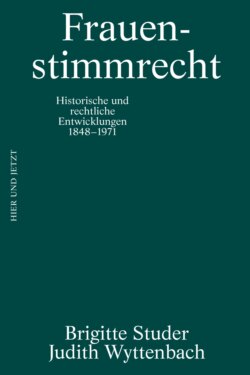Читать книгу Frauenstimmrecht - Brigitte Studer - Страница 30
Eine Bundesratsbotschaft mit Ambivalenzen
ОглавлениеNeun Tage vor der Abstimmung über den Zivilschutz, am 22. Februar 1957, erschien die Botschaft des Bundesrats an die Bundesversammlung über die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts in eidgenössischen Angelegenheiten.86 Erstmals bezog die Schweizer Regierung zugunsten des Frauenstimmrechts Position. Was jahrelanges Lobbying der Frauenverbände nicht zustande gebracht hatte (zwischen 1934 und 1959 hatte der SVF nicht weniger als 43 Eingaben an verschiedene Bundesbehörden gemacht, also durchschnittlich fast zwei pro Jahr87), war durch tagespolitische Erfordernisse zusammen mit der Macht eines männlichen Expertenworts, dank dessen sich die Behörde legitimieren konnte, plötzlich möglich geworden.
In der Tat stützte sich die bundesrätliche Botschaft auf die zurückhaltende Argumentation des angesehenen Staatsrechtlers Werner Kägi (1909–2005).88 In seinem Gutachten, das er im Auftrag des SVF verfasst hatte, plädierte er für die Einführung des Frauenstimmrechts, allerdings nur auf der Basis einer partiellen Verfassungsrevision, eine einfache Neuinterpretation lehnte er ab. Der Bundesrat, der das Erscheinen des Gutachtens abgewartet hatte, um seine Botschaft zu verabschieden, folgte dem von Kägi vorgeschlagenen Verfahren, beharrte also auf einer Volksabstimmung und schloss jeden alternativen Weg aus, was die Chancen des Frauenstimmrechts eher unsicher machte. In zweifacher Hinsicht verringerte die Botschaft sie noch weiter. Erstens gab der Bundesrat den Argumenten der Gegnerschaft darin derart viel Raum und präsentierte sie in einer solch unkritischen Form, dass sie als durchaus legitim erschienen.89 Zweitens schlug er die Abänderung von nicht weniger als 16 Artikeln der Bundesverfassung vor, was die Vorlage als derart gewichtig erscheinen liess, dass sie nur abschreckend wirken konnte. Der Ständerat, der als Erster beriet, reduzierte die Änderungsvorschläge auf ein handliches Mass, akzeptierte die Vorlage aber gleichwohl nur mit 19 gegen 14 Stimmen. Der Nationalrat, der sie im März 1958 behandelte, nahm sie mit 95 gegen 37 Stimmen an.