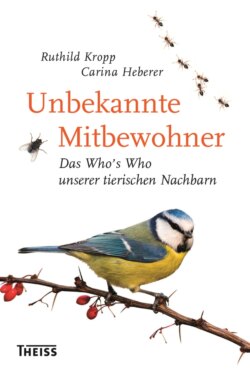Читать книгу Unbekannte Mitbewohner - Carina Heberer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnhängliche Passagierin
– die Kopflaus
Wohl dem, dem sie sinnbildlich nur über die Leber und nicht über das Haupthaar gelaufen ist. Die Laus, namentlich die Kopflaus, zählt zu den als äußerst unangenehm empfundenen Besiedlern des Menschen. Ihre Kleinheit – das Weibchen wird mit bis zu 3 Millimetern in etwa so lang wie ein Sesamkorn – zeigt sich schon in besagter Redewendung, die ausdrückt, dass auch Kleinigkeiten Ärger hervorrufen können. Die Leber galt früher als Sitz der Gefühle des Menschen. Vermutlich manifestierte sich die kleine Laus im Sprachgebrauch als Leber-Passantin, weil beide mit dem gleichen Buchstaben beginnen, sprich eine Laus auf der Leber einfach hübscher klingt als beispielsweise ein Floh.
Haarige Liaison
Läuseei
Im wahren Leben ist die Kopflaus jedoch fernab der inneren Organe im Kopfhaar des Menschen anzutreffen. Vor allem im Bereich des Haaransatzes, an den Schläfen, hinter den Ohren und am Nacken finden sie wohlig warme Verhältnisse um die 28 °C vor. Hier legen die Weibchen ihre Eier ab. Während des etwa drei Wochen dauernden Läuselebens, können es um die hundert Stück sein. Zur Fortpflanzung benötigt eine Läusedame nicht unbedingt ein Stelldichein mit einer männlichen Laus, da sie zur sogenannten Jungfernzeugung befähigt ist. Dabei entstehen aus unbefruchteten Eiern Nachkommen, die mit der Mutter genetisch identisch sind.
Jedes Läuseei gleicht einem winzigen Tönnchen mit Deckel, der mit kleinen Poren bestückt ist, um die Sauerstoffversorgung der heranwachsenden Läuselarve sicherzustellen. Das Weibchen befestigt jedes Ei sorgfältig an der Basis eines einzelnen Haares nahe der Kopfhaut. Hierfür fabriziert es aus klebrigem Vaginalsekret eine Manschette, die am Ei anliegt und gleichzeitig das Haar umschließt. Ein auf diese Weise befestigtes Ei wird als Nisse bezeichnet. Der lausgemachte Klebstoff ist nicht wasserlöslich, weshalb eine betroffene Person die Nissen nicht durch bloßes Haarewaschen loswerden kann.
Lebenslauf einer Laus
Im Schutze der Hülle reift innerhalb einer Woche die Läuselarve heran, erkennbar von außen an der grau schimmernden Färbung im Gegensatz zur weißen Farbe einer leeren Eihülle. Kurz vor dem Schlupf saugt die Larve durch den mit Poren versehenen Deckel Außenluft an, die die Eihülle aufbläht und schließlich den Deckel absprengt. Bei diesem Vorgang wird der nur ein Millimeter messende Winzling, die sogenannte Nymphe, hinauskatapultiert. Dies ist der einzige Vorgang im Leben einer Laus, der einem Sprung zumindest nahekommt. Denn entgegen der fälschlichen Annahme, Läuse könnten mit einem gezielten Hopser flohgleich von einem Menschenkopf auf den nächsten wechseln, sind sie zeitlebens nur zum Krabbeln befähigt.
Krabbler mit Greifern
Mit den kräftigen Greifhaken an den Beinchen erinnern sie entfernt an klitzekleine Krebschen. Doch sind sie zoologisch nicht bei den Krebstieren einzuordnen, sondern zählen zu den Insekten und damit zu den Sechsbeinern. Der Abstand zwischen den Beinchen entspricht dem Durchmesser eines durchschnittlichen Menschenhaares, sodass sich eine Kopflaus hervorragend daran festklammern kann. Zur Fortbewegung wird ein Beinchen abgespreizt, bis es ein benachbartes Haar zu fassen bekommt, während die übrigen Beinchen fest am aktuell besetzten Standort verankert bleiben. Einen Sturz aus dem haarigen Paradies gilt es in jedem Fall zu vermeiden, denn fernab von menschlicher Mähne und Wuschelkopf droht spätestens nach zwei Tagen der sichere Hungertod.
An Rücken- und Bauchseite ist der Körper der Laus stark abgeplattet, zudem trägt er keine Flügel. Diese Eigenschaften kommen dem Leben im Haardschungel sehr entgegen und sind für Plagegeister, die sich auf Mensch und Tier häuslich einrichten, typisch.
Das Insektenprinzip eines harten Außenpanzers, der nicht mitwachsen kann, zwingt auch jugendliche Läuse immer wieder zur Häutung. Auf dem etwa zehntägigen Weg zum ausgewachsenen Tier streift die Nymphe insgesamt dreimal ihre Haut ab.
Eine echte Langzeitbeziehung
Die Laus scheint schon seit Urzeiten ein treuer Begleiter des Menschen zu sein.
In den Haaren der Alten Ägypter war die Kopflaus nachweislich zu Hause, wie Funde von Nissen im Haar menschlicher Mumien zeigen. In Israel wurden bei archäologischen Grabungen Haarkämme aus dem Jahre 100 v. Chr. zutage gefördert, die augenscheinlich der Entfernung von Läusen und Nissen dienten. Die jahrtausendealte Gegenmaßnahme hat sich offensichtlich bewährt: Auch heutzutage rückt man Laus und Nisse mit speziellen Kämmen, deren Zinken kleinstmögliche Abstände haben, zu Leibe.
Ab in den Kamm!
Zumeist sind es Eltern von Kindergarten- oder Schulkindern, die sich mit einer Besiedlung durch die lästigen Insekten auseinandersetzen müssen. Denn gerade Kinder, die sich gerne und oft mit Spielkameraden umgeben und im Wortsinne die Köpfe zusammenstecken, bieten der Laus ideale Ausbreitungsmöglichkeiten. Auch über Mützen, Kappen sowie gemeinschaftlich genutzte Kämme und Bürsten kann das Unheil seinen Lauf nehmen, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch geringer als beim direkten Kopfkontakt. „Kauf dir eine Laus, so ist die Schule aus“ hieß es bis in die 1970er-Jahre in einem Schülerspruch – dies gilt bis heute, denn mit unbehandeltem Kopflausbefall darf ein Kind nicht in Schule oder Kita gehen.
Viel Aufmerksamkeit, aber auch jede Menge Spott erntete im Jahre 2014 die Warnung einer russischen Behörde vor dem Schießen gemeinsamer Selfies per Smartphone, da die dafür notwendige Annäherung mit einer erhöhten Läuse-Ansteckungsgefahr einhergehe. Doch ganz gleich auf welchem Wege sich Läuse Zutritt zu unserem Haupthaar verschafft haben: Dank spezieller Shampoos, deren enthaltene Öle die Atemöffnungen von Läusen verschließen, lässt sich das Kribbeln am Kopf heute schnell in den Griff kriegen.
Nimmersatte Nutznießer
Das Zusammenleben zwischen Mensch und Laus ist kein friedvolles: Denn wie es sich für einen richtigen Schmarotzer gehört, lebt die Laus nicht nur auf, sondern auch vom Menschen, genauer gesagt von seinem Blut. Hierfür zapft sie ihren Wirt über seine Kopfhaut etwa alle zwei bis drei Stunden, mindestens jedoch einmal am Tag an. Wenn ein Mensch bereits über juckende Stellen auf der Kopfhaut klagt, ist am Schopf zumeist schon eine ganze Menge los. Grund für den Juckreiz ist ein Speichelsekret, das beim Stich in die Wunde gelangt und ähnlich wie bei Stechmücken dazu dient, die Gerinnung des Blutes zu verhindern.
An dem verhältnismäßig kleinen Kopf der Laus sucht man mit bloßem Auge oder einer Lupe jedoch vergeblich nach einem beeindruckenden Blutsaugapparat. Lediglich ein runder Mundkegel, der einer Schnauze ähnelt, zwei recht kurze, mit Sinneshaaren besetzte Antennen sowie zwei winzige Augen sind auszumachen. Die Mundwerkzeuge, bestehend aus drei Stechborsten, liegen im Inneren des Kopfes in einer kleinen Tasche verborgen und werden nur beim Stechvorgang ausgefahren.
Je nach Körperfärbung kann man feststellen, ob eine Laus gerade gespeist hat: Direkt nach einer Mahlzeit schimmert das menschliche Blut rötlich durch die Körperhülle hindurch. Nach erfolgter Verdauung sind die braun bis schwarz gefärbten Abbauprodukte im Darm sichtbar. Eine hungrige Laus erscheint hingegen schmutzig gelblich.
Lausige Verwandtschaft
Die Kleiderlaus entwickelte sich vor circa 170.000 Jahren aus der Kopflaus, nachdem unsere Urahnen begonnen hatten, Kleidung zu tragen. Sie lebt zwischen Haut und Kleidung und klammert sich mit ihren Beinchen an Körperhaaren oder Kleidungsfasern fest, wobei sie raue Stoffe glatten vorzieht. Ihr Lebensraum und ihre Vermehrungsfreudigkeit – bis zu 300 Nachkommen pro Weibchen – machen sie zu einem idealen Krankheitsüberträger beispielsweise des Fleckfiebers. Traurige Berühmtheit erlangte der Russlandfeldzug Napoleons, bei dem von ursprünglich 600.000 Soldaten lediglich 3000 überlebten. Ein Großteil war Infektionen erlegen, die von Läusen übertragen worden waren. Der Zweite Weltkrieg war dank Entlausungs-Maßnahmen der erste bewaffnete Konflikt, in dem weniger Menschen an Fleckfieber starben als an den Kampfhandlungen.
Bei Temperaturanstieg und -abfall, wie er bei Fiebernden und Sterbenden eintritt, verlassen Kleiderläuse ihren angestammten Lebensraum. So wird von der Beerdigung des Erzbischofs Thomas von Canterbury im Jahre 1170 berichtet, dass die Läuse in unglaublichen Massen und weithin sichtbar die zahlreichen Kleidungsschichten des aufgebahrten Toten verließen.
Die Filz- oder Schamlaus besiedelt die Schambehaarung des Menschen, kommt aber auch in Achselbehaarung, Augenbrauen und Wimpern vor. Die Filzlaus saugt immer an der gleichen Körperstelle. Mit ihrem Speichel verändert sie das Hämoglobin des Menschen so, dass an der Einstichstelle bläuliche Flecken entstehen. Die Schamlaus wird beim Geschlechtsverkehr übertragen und wurde daher in früheren Zeiten auch als Kavaliersbiene bezeichnet.
Sprachschmarotzer
Die Laus ist nicht nur fest in unseren Haaren, sondern auch in unserer Sprache verankert. In Wien bezeichnet man einen Scheitel recht treffend als Lausallee.
Lausige Zeiten im Wortsinne waren bis in das 20. Jahrhundert hinein in unseren Breiten keine Ausnahmeerscheinung – dies spiegelt sich in Bezeichnungen wie „Lausbub“ oder „Lausekerl“ wider. Während sich der ursprüngliche Begriff „Lauser“ auf einen durch Läuse besiedelten Menschen bezog, bezeichnet der Zusatz „Laus“ seit dem 18. Jahrhundert das Schlechte und verharmlosend das Freche. Setzt man jemandem eine Laus in den Pelz, so bereitet man ihm oder ihr Unannehmlichkeiten. Im 16. Jahrhundert jedoch hatten die Menschen derart viele (Kleider-)Läuse, dass diese Redewendung ursprünglich bedeutete, etwas völlig Überflüssiges zu tun, ähnlich den Eulen, die man nach Athen trägt.
Sind wir verblüfft, so laust uns der Affe. Wahrscheinlich bezieht sich diese Redensart auf Vorkommnisse, bei denen Affen von der Schulter eines Schaustellers auf die eines überraschten Zuschauers sprangen und begannen, diesen zu lausen. Bei diesem Vorgang geht es den Affen, wie man heute weiß, gar nicht in erster Linie um die Suche nach Läusen, sondern um das Entfernen von Hautschuppen und den positiven Effekt des gegenseitigen Körperkontakts auf das Zusammenleben. Das wechselseitige Absuchen nach Läusen und anderen Plagegeistern war in früheren Zeiten auch unter Menschen weit verbreitet, wie zahlreiche bildliche Darstellungen verdeutlichen.
„Nicht die Laus“ war ein oft gehörter Ausspruch deutscher Studenten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese Bemerkung war gleichbedeutend mit „Gar nichts“ und beschreibt treffend die Winzigkeit dieses menschlichen Mitbewohners. Aus die Laus.
C. H.