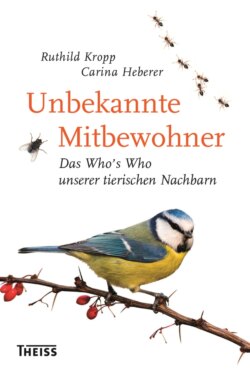Читать книгу Unbekannte Mitbewohner - Carina Heberer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGefährlicher Gast –
die Zecke
Wir fürchten sie. Wir meiden sie, wo immer es geht. Erzählungen über sie registrieren wir mit Ekel und Panik. Und das hat auch seinen guten Grund, denn sie betrachtet uns nur als Nahrungsquelle und kann zudem Krankheiten übertragen. Doch gönnt man der Zecke einen genaueren Blick, dann kann man zu der Erkenntnis gelangen, dass sie jedem Manager als Vorbild dienen könnte, denn sie ist effektiv, flexibel, raffiniert und zielorientiert.
Leder- und Schildzecken
Die Zecke ist kein Insekt, sondern ein Spinnentier und gehört zur Unterklasse der Milben. Das erwachsene Tier krabbelt auf acht Beinen durchs Leben, die Larven sind noch sechsbeinig unterwegs, dazwischen liegt das Nymphenstadium (acht Beine). Die etwa 850 Zeckenarten weltweit gliedern sich in zwei Gruppen: Lederzecken und Schildzecken. Uns ärgern hauptsächlich die Schildzecken, zu denen der Gemeine Holzbock zählt. Ihnen begegnet man leider häufig, wenn man in Wald und Wiesen unterwegs ist. Da sie ein Schild aus Chitin auf dem Rücken tragen, überleben die Tiere selbst harte Stöße und massives Quetschen, ohne Schaden zu nehmen. Chitin ist ein sehr widerstandsfähiges Kohlenhydrat (griechisch chiton bedeutet Panzer), das unter anderem die Körperhülle von Insekten, Spinnen, Krebstieren bildet. Bei den Schildzecken kann man die Mundwerkzeuge gut von oben erkennen, denn sie ragen keck und angriffslustig hervor. Um sie zum Einsatz zu bringen, müssen sie jedoch erst einmal einen Wirt finden, und das tun sie mithilfe ausgeklügelter Sinnesleistungen.
Lederzecken sind weich, da sie keinen Chitinpanzer tragen. Wenn man sie von oben betrachtet, erinnern sie eher an ein kleines Beutelchen. Ihre Mundwerkzeuge sieht man erst, wenn man sie auf den Rücken dreht. An Orten, wo Tauben genistet haben oder nisten, kann man am ehesten Taubenzecken begegnen. Soweit bekannt ist, übertragen sie keine Krankheiten, aber es kann zu allergischen Reaktionen kommen. Lederzecken können monatelange Trockenheit überleben, da sie zum einen nur wenig Wasser über ihre Außenhülle verlieren und zum anderen den Wasserverlust über die Atmung reduzieren: Sie besitzen wie alle Zecken Atemöffnungen in der Nähe des hinteren Beinpaars, die sie dann einfach nur sehr selten öffnen.
Empfindsam Wartende
Zecken sind wahre Künstler, wenn es darum geht, aus der Entfernung potenzielle Nahrungsquellen zu entdecken – also entweder uns oder andere Tiere. Sie reagieren sehr sensibel auf mechanische, thermische und chemische Reize, also auf die Erschütterungen eines vorbeilaufenden Hundes, die Wärme eines äsenden Hasen oder das Kohlendioxid, das wir ausatmen. All dies erspüren sie mit den Enden ihrer Vorderbeine. Dort sitzt das Hallersche Organ, ein ungemein komplexes Sinnesorgan. Wenn die Zecke auf einer Pflanze lauert, breitet sie ihre Vorderbeine weit auseinander und bewegt sie suchend hin und her, um ihre zukünftige Futterquelle abzupassen. Hat sie etwas entdeckt, dann krabbelt sie in die entsprechende Richtung mit der Absicht, sich an das vorbeikommende Tier zu klammern.
Schildzecken können, was ihren Wirt betrifft, entweder sehr treu oder sehr untreu sein. Manche Arten suchen ihre Nahrung nur an einer einzigen Tierart, etwa an Igeln, andere sind weniger wählerisch: Hauptsache Nahrung. Das kann gefährlich werden, da sie Krankheiten früherer Wirte übertragen können.
Eine Zecke lauert auf vorbeikommende Nahrung.
Auf den Bäumen nur Affen
Immer noch hält sich der Glaube, dass sich Zecken von den Bäumen auf ihre Opfer fallen lassen. Das stimmt nicht. Das Hallersche Organ kann auf eine große Entfernung nicht funktionieren. Zudem müssten die Zecken in der Lage sein zu berechnen, wie und wann sie sich fallen lassen müssten, um unter Berücksichtigung des Windeinflusses zielgenau auf einem sich vorwärtsbewegenden Objekt zu landen. Und das blind! Zecken sind zwar raffinierte Tiere, doch das können sie wohl nicht.
Wie hoch Zecken lauern, ist vom Entwicklungsstadium abhängig: Die Larven krabbeln auf niedrige Pflanzen von bis zu 10 Zentimeter Höhe, die Nymphen zwischen 10 und 50 Zentimeter, die Adulten bis zu 1 Meter Höhe und mehr. Je nach Höhe werden verschiedene Tiere befallen.
Wählerische Sucherin
Spinnentiere tragen an ihrem Kopf zwei spezielle Extremitäten: die Pedipalpen. Sie können unterschiedlich gestaltet sein und je nach Bauweise und Bedürfnissen des Tieres verschiedene Funktionen haben: Fang- oder Laufbeine, Tast- oder Greiforgane, Scheren oder Gefäße zum Transport und Übertragen von Sperma. Bei den Zecken dienen sie als Tastorgane, ihnen ist es zu verdanken, dass wir so manche Zecke von unserem Körper absammeln können, bevor sie zusticht. Denn einmal auf ihrem Wirt angekommen, startet sie eine zum Teil sehr langwierige, aber zielorientierte Suche nach der perfekten Stelle, an der sie saugen möchte. Dünn soll die Haut sein, und wenn es dort noch feucht ist, dann passt es ihr perfekt. Bei der Suche nach der idealen Einstichstelle helfen ihr Sinnesborsten, die sich an eben diesen Pedipalpen und auch den Vorderbeinen befinden.
Aufschneiden und zustechen
Chelizeren – das klingt schon ungut und das sind sie auch. Diese Werkzeuge tragen an ihren Spitzen scharfe Vorrichtungen, mit denen die Zecke die Haut des Wirtes erst einmal anritzt. Sie tut dies so minimal, dass wir davon gar nichts bemerken.
Nun wird das sogenannte Hypostom eingesetzt, das eigentliche Instrument zum Stechen und Saugen. Das Hypostom sieht wie ein plumper Zapfen aus, besteht aus Chitin, ist außen mit Widerhaken besetzt und hat auf seiner Oberseite eine rinnenartige Vertiefung, die sich über seine gesamte Länge zieht. Chitin ist ein harter Stoff, weshalb das Hypostom leicht in das Gewebe eindringen kann.
Die Vertiefung auf dem Hypostom nennt man Speichelrinne, über sie lässt die Zecke Speichel in unsere Wunde fließen. Jedoch keinen normalen Speichel, sondern einen effektiven Cocktail aus gerinnungs- und entzündungshemmenden sowie betäubenden Stoffen – clevere Tiere betäuben eben die Stichstelle, um nicht bemerkt zu werden. Zudem löst der Speichel Gewebe auf, das das Tier dann einsaugen kann – leider können in dem Speichel Krankheitserreger enthalten sein.
Zecken entfernen
Ziehen? Drehen? Öl drauf? Alkohol drauf? Die Tipps zur Zeckenentfernung sind mannigfaltig. Und manches ist grundverkehrt. Richtig ist ziehen, dazu nutzt man je nach Vorliebe Zeckenzange, Zeckenkarte oder Zeckenlasso. Man sollte ein solches Instrument immer bei sich tragen, wenn man in der Natur unterwegs ist, denn je rascher eine angedockte Zecke entfernt wird, desto besser. Wichtig ist dabei: ruhig bleiben, langsam und kontrolliert vorgehen. Die Zecke sollte nahe an der Haut herausgezogen werden, damit sie nicht gequetscht wird. Denn sonst gibt sie aus Stress vielleicht Körperflüssigkeiten ab, die Krankheitserreger enthalten. Ist die Zecke entfernt, sollte sie mithilfe eines sehr harten Gegenstandes zerquetscht oder mit 40 %igem Alkohol getötet werden. Sonstige Tötungsversuche, wie das Zerquetschen unterm Schuh oder mit dem Fingernagel, aber auch das Hinunterspülen in der Toilette überlebt sie.
Bombenfeste Verankerungen
Die Widerhaken des Hypostoms verankern die Zecke fest in der Haut. Doch es sind nicht die Widerhaken alleine: Zecken produzieren eine Art Klebstoff, der Zeckenzement genannt wird, mit dem sie sich an die Haut anpappt. Aus diesem Grund trägt der Gemeine Holzbock den schönen wissenschaftlichen Namen Ixodes ricinus, denn Ixos heißt griechisch Leim. (Der zweite Teil des Namens bezieht sich auf das Aussehen der vollgesogenen weiblichen Zecke, sie gleicht einem Rizinus-Samen.)
Der große Schluck
Hauptsächlich sind es erwachsene Zeckenweibchen, die blutsaugend unterwegs sind, und wahrlich, sie nehmen einen ordentlichen und langen Schluck. Bis zu sieben Tage können sie an ihrem Wirt hängen und saugen und dabei kann sich ihre Körpermasse um das 100- bis 200-fache erhöhen. Erwachsene Männchen hingegen saugen nur sporadisch, um Energie zwischen ihren Paarungen zu tanken. In den meisten Phasen ist die Nahrung wichtig für Wachstum und Häutung. In der letzten Phase nimmt das Weibchen so viel Nahrung auf, um die mehr als tausend Eier (bei einigen Arten mehr als 10.000) zu produzieren. Nach der Eiablage stirbt es.
Ein Zeckenweibchen nach dem Saugen
Nur wenige überleben
Die immense Eiproduktion ist nötig, da die meisten Zecken im Laufe ihres Entwicklungszyklus auf der Strecke bleiben. Beim Gemeinen Holzbock sollen aus 1000 Eiern nur etwa 100 Larven schlüpfen, von diesen überleben circa zehn Nymphen und von diesen wiederum eine erwachsene Zecke – ein Glück, denn sonst wären wir vor den kleinen Blutsaugern nicht mehr sicher. Larven sind für uns meist kein Problem, da sie nur sehr dünne Hautflächen durchdringen können und überwiegend keine oder nur geringe Mengen an Erregern in sich tragen. Die Nymphen hingegen können schon Krankheiten übertragen, da die Larven vielleicht bereits an einem infizierten Tier gesaugt haben.
Die Klimaerwärmung macht es möglich, dass Zecken mildere Winter in einer hohen Anzahl überleben und inzwischen auch in größeren Höhen und nördlicheren Breiten auftreten. Zudem haben Zecken häufiger außerhalb der bekannten „Zeckensaison“ Konjunktur.
Hungerkünstler
Zwischen den einzelnen Stadien und Saugakten kann viel Zeit verstreichen, wenn ein geeigneter Wirt fehlt. Zecken sind wahre Hungerkünstler, die ihren Stoffwechsel auf ein absolutes Minimum reduzieren können, um sogar mehrere Jahre ohne Nahrung auszukommen.
Ohne Nahrung heißt hier auch ohne Flüssigkeit. Was tun, um nicht zu verdursten? Hierfür haben Zecken eine absolut raffinierte Lösung gefunden: Sie produzieren ein Speichelsekret, das Wasser anzieht – so können sie Wasserdampf aus der Luft aufnehmen. Allerdings klappt das nur bei einer relativen Luftfeuchtigkeit ab 80 Prozent.
DU ZECKE!
Als Schimpfwort Rechtsradikaler gegenüber linken Autonomen, besonders Punks, bewegt sich die Zecke in braunen Mündern. Früher grölten sie „linke Zecke“, jetzt reicht „Zecke“ – Tiernamen und Vergleiche aus der Schädlingsbekämpfung waren schon im Vokabular des Nationalsozialismus beliebt. Dass die Neonazis nicht auf die Komplexität und Raffinesse der Zecke anspielen, ist klar.
Eine interessante Wendung nahm dieses vermeintliche Schimpfwort, als eine Gruppe von Musikern sich kurzerhand zu Zeckenrappern erklärte. Diese linkspolitische Rap-Richtung, der etwa die Band Neonschwarz oder die Rapperin Sookee angehören, wendet sich gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie in vielen Rap-Texten.
R. K.