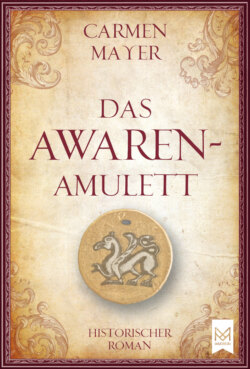Читать книгу Das Awaren-Amulett - Carmen Mayer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеTrotz des gerade einsetzenden Schneetreibens konnte Johannes den Ennser Stadtturm schon von Weitem sehen. Er ragte zwischen den Türmen des Schlosses zur rechten und dem Kirchenbau zur linken Seite der Holzbrücke über die Mauern der Stadt, und befand sich mitten auf dem weitläufigen Marktplatz. Er erinnerte sich daran, wie Bruder Anselm ihm einmal davon erzählt hatte, dass dieser Turm von den protestantischen Ennser Bürgern als Wach- und Glockenturm gewünscht, und unter Kaiser Maximilian II. vor über 50 Jahren gebaut worden war.
Staunend betrachtete der Junge das Kupferdach und die Kugel mit der geflügelten Figur auf der Spitze, die langsam unter einer weißen Schneedecke verschwanden. Er konnte sich vorstellen, wie reich diese Stadt einst gewesen sein musste, und wünschte sich, das sei bis heute so. Wie er auch hoffte, dass der evangelische Geist dieser Stadt erhalten geblieben sein möge.
Johannes überquerte die Brücke und erreichte das Stadttor gerade noch rechtzeitig, bevor die Stadtwachen Fremden nach Einbruch der Dunkelheit den Zutritt verwehrten.
Er bezog in einem kleinen Gasthaus in der Nähe der Stadtmauer Quartier, was er bereits nach wenigen Stunden bereute. Nach einem einfachen Mahl hatte er sich in die ihm zugewiesene Kammer über dem Ziegenstall zurückgezogen, und zum ersten Mal in seinem Leben erfahren, welche Qualen ein verlaustes und von Flöhen besiedeltes Nachtlager bereiten konnte.
Als er nach einem Badehaus fragte, erntete er Hohnlachen. Badehäuser, so erfuhr er, gab es in Enns nicht. Dafür hätten die Katholischen gesorgt, die, um die Moral ihrer Schäflein besorgt, alle Einrichtungen dieser Art geschlossen hatten.
„Die Katholischen?“, fragte Johannes ungläubig. „Ich habe gehört, diese Stadt sei eher protestantisch?“
Der Wirt, an den diese Frage gerichtet war, lachte erneut laut auf.
„Da hast du was Falsches gehört. Enns war eher protestantisch“, gab er zurück. „Die Zeiten ändern sich. Aber wenn dir der Sinn nach Reinlichkeit steht, versuch es doch mal mit der Enns!“
Johannes schüttelte angewidert den Kopf. Er hatte gesehen, wie viel Unrat auf den Wogen des Flusses schwamm, den er an seinen Ursprüngen als klares, sauberes Gewässer kannte. Außerdem war das Wasser der Enns so kalt, dass der Fluss an vielen Stellen zugefroren war.
Also ließ er sich einen Schapf warmes Wasser auf seine Kammer bringen und reinigte seinen geplagten Körper, so gut es ging. Betrübt dachte er an die Vorräte an Salben und Tinkturen, die Bruder Anselm aus seiner Hütte mitgenommen hatte, und die er jetzt so gut hätte brauchen können.
Außerdem musste er feststellen, dass die blutrünstigen Biester sich auch in seinen Kleidern eingenistet hatten. Es schien beinahe unmöglich, sie wieder loszuwerden.
„Das liegt an den geistlichen Unwürdenträgern, die den Menschen eine gründliche Körperreinigung verbieten“, fluchte er, nachdem er Wams und Hose gründlich ausgeschüttelt und wieder übergezogen hatte. Wehmütig dachte er an das wohltuende Bad im Zuber seiner Mutter zurück, die sehr auf Sauberkeit bestand. Wie recht sie damit gehabt hatte, wurde ihm nach dieser Nacht erst so richtig bewusst.
Anderntags suchte er einen Händler auf, bei dem er sich neu einzukleiden gedachte. Die Ennser Waschweiber, zu denen ihn der Wirt geschickt hatte, beschieden ihn mit der Auskunft, erst am übernächsten Tag wieder Lauge anzusetzen und zu waschen. Das dauerte dem Jungen zu lange.
„Kannst du bezahlen?“, war die erste Frage des Mannes, der ihn bereits beim Betreten des düsteren Ladens argwöhnisch von oben bis unten gemustert hatte.
Johannes nickte nur und suchte sich ein Hemd, eine Hose, Strümpfe und eine Felljacke aus dem Angebot des mürrischen Händlers aus. Er feilschte erfolgreich um den Preis, den der Alte für seine Ware haben wollte, und verließ mit seinen zum Bündel zusammengeschnürten verlausten Kleidern unter dem Arm dessen Haus.
Bei einem Apotheker erstand er eine Salbe, die den Juckreiz auf seiner Haut beruhigen und die Entzündungen heilen sollte. Er trug sie gleich vor Ort auf, weil ihm bewusst war, wie übel sein Zustand werden konnte, wenn er die Stellen aufkratzte. Der Apotheker beobachtete ihn dabei kopfschüttelnd. Was für ein Aufhebens dieser Kerl machte wegen der paar Flohbisse!
Zu seinem Quartier kehrte Johannes nicht mehr zurück. Er befürchtete, die dort lebenden Quälgeister kröchen in seine neuen Kleider und brächten ihm erneut Kummer. Also suchte er ein anderes Gasthaus, in dem er nächtigen wollte. Er fand auch eines in der Nähe des Stadtturms, und bezog seine Kammer, nachdem er sie gründlich nach Spuren seiner kleinen Erzfeinde abgesucht hatte.
„Flöhe, Läuse und Wanzen findest du bei uns nicht“, hatte ihm die Wirtin gesagt, als er danach fragte. „Wir räuchern jede Woche alle Kammern aus.“
Für diesen Dienst verlangte sie auch einen deutlich höheren Preis als der Wirt in Johannes’ letztem Quartier. Der Junge überschlug seine Barschaft und beschloss, diese Nacht noch in Enns zu bleiben. Am nächsten Tag wollte er nach Linz weiterziehen, zunächst seine Tante aufsuchen und nach Arbeit zu suchen.
Als er am anderen Morgen die Hauptstraße entlang Richtung Westtor lief, durch das er die Stadt verlassen wollte, läuteten die Glocken vom Stadtturm. Eine schreiende Horde Menschen kam hinter ihm her und zwang ihn an eine Mauer gedrückt abzuwarten, bis der Weg wieder frei sein würde.
„Der Schwarze Tod!“, kreischte eine der Frauen, die in dem Pulk mitlief. „Rettet euch! Betet zum Herrn um Vergebung! Tut Buße! Der Schwarze Tod geht um!“
Weitere Stimmen fielen in ihr Geschrei ein.
Dem Haufen aufgeregter Bürger folgte eine klapprige Karre, die zwei stämmige Mannsbilder zogen. Ein Dritter schob sie von hinten an.
Es war der Henker mit seinen beiden Knechten, die sich mit ihrer Fracht einen Weg aus der Stadt bahnten.
Auf der Pritsche erkannte Johannes mehrere Leichen. Eine Hand ragte unter einem zerschlissenen Tuch hervor und hätte ihn beinahe gestreift. Die Finger dieser Hand waren schwarz und stanken faulig. Als Johannes einen weiteren Blick auf die Toten erhaschen konnte, wurde ihm schwindelig: Alle hatten schwarz verfärbte Beulen und teilweise in Fäulnis übergehende Gliedmaßen. Ein ekelerregender Gestank begleitete die Toten.
„Verschwindet!“, rief einer der Männer, die den Karren zogen. „Seid ihr verrückt geworden? Das sind Pesttote! Geht weg, steckt euch nicht an!“
„An Toten anstecken?“, keifte eines der Weiber, das vor dem knarzenden Gespann hergelaufen war. „Wie soll das denn gehen?“
Irres Gelächter begleitete ihre weiteren Worte, die im allgemeinen Lärm untergingen. Schon tauchten Stadtknechte auf, die sie in die angrenzenden Gassen zurückdrängten.
Die Pest war in Enns ausgebrochen! Johannes erkannte, dass es für ihn nur eine Möglichkeit gab: Er musste diese Stadt so schnell es ging verlassen.
Da scholl aus einer der Gassen ein Ruf an sein Ohr, der drohte, das Blut in seinen Adern gefrieren zu lassen. Eine Frauenstimme kreischte: „Verbrennt die Hexe zusammen mit ihren Opfern! Die Haußlerin hat die alle auf dem Gewissen, die böse Hex’! Fangt sie und verbrennt sie!“
Andere fielen in ihr Geschrei ein. Die Leute kamen ungeachtet der weiterhin um Ordnung bemühten Stadtknechte aus den Gassen zurück. Sofort bildete sich eine neue Menschentraube, und die Wachleute hatten Mühe, sie im Zaum zu halten. Johannes stieß und schob sich, so schnell er konnte, zum westlichen Stadttor. Durch den Tumult, der nach dem Aufschrei in den Gassen von Enns entstanden war, achtete niemand auf den Jungen, der sich an den Torwächtern vorbeidrückte. Ihm schoss die Hoffnung durch den Kopf, irgendwo eine Badestube zu finden, in der er sich von dem Unheil befreien konnte, das seit dem ersten Abend in Enns an ihm zu haften schien. Was für ein irrer Gedanke angesichts dessen, was er in den letzten Minuten erlebt hatte, zumal er doch wusste, dass es weit und breit keine Badestuben gab. Nur: Wie das alles loswerden, was ihn und die Bürger dieser Stadt mit Krankheit und Gestank überschwemmt hatte, wenn nicht mit viel Wasser?
Feuer.
Guter Herrgott.
Nicht mit Feuer!
Ein kleiner Teil der Meute war zusammen mit der Leichenkarre ebenfalls zum Stadttor geeilt. Dort verharrten sie schweigend, während die drei Männer mit ihrer grausigen Fracht weiterzogen.
Der weitaus größere Teil der Ennser hatte sich um die keifende Bürgerin geschart, die lauthals den Feuertod für die angebliche Hexe forderte. Immer lauter wurde das Geschrei des Pöbels, immer größer wurde ihr Zulauf. Die Stadtknechte hatten viel Mühe, die Leute davon abzuhalten, das Haus der Hebamme zu stürmen und sie herauszuzerren.
Johannes hatte die Stadt hinter sich gelassen. Er blieb atemlos am Rand der Straße stehen, die aus Enns Richtung Linz führte. Ursprünglich hatte er über die ein wenig marode gewordene Brücke zum linken Donauufer wechseln und die von Händlern gut befahrene Haudererstraße über Mauthausen nach Linz nehmen wollen. Aber nachdem er die Stadt auf dem schnellsten Weg hatte verlassen wollen, befand er sich auf dem unbefestigten Weg nach Asten. Fassungslos sah er zu, wie der Henker und seine Knechte die mit den fünf entstellten Leichen beladene Karre zu einem aufgerichteten Scheiterhaufen in seiner Nähe brachten. Die Männer kippten die Toten auf den Holzstoß, den sie mit eilig angezündeten Reisigbüscheln in Brand steckten. Beißender Qualm breitete sich aus. Johannes und die Männer begannen zu husten.
„Geh weg von hier! Los, verschwinde!“, herrschte der Henker den Jungen an, der mit weit aufgerissenen Augen dastand und sich nicht vom Fleck rührte. „Los, hau ab, bevor sie dich erwischen und zurück in die Stadt bringen! Es ist die Pest!“
Johannes rang nach Luft.
„Ihr dürft das nicht“, flüsterte er entsetzt. „Man darf die Toten nicht einfach so verbrennen! Ihr versündigt euch an ihnen. Es sind doch keine …“
Trümmer einer Mühle.
Verkohlte Leichen.
Ein verkrustetes Amulett.
„Hörst du nicht?“, fuhr der Henker ihn an. „Es ist die Pest! Sei froh, dass du noch aus der Stadt gekommen bist, weil die Stadtwache mit dem verfluchten Mob beschäftigt war. Niemand darf mehr hinein oder heraus. Also verschwinde!“
„Ich hab nur kurz Rast gemacht in eurer Stadt und muss weiter nach Linz“, flüsterte Johannes. „Ich hab mich bestimmt nicht angesteckt.“
Der Henker kam bis auf ein paar Schritte auf ihn zu und maß ihn mit Blicken von Kopf bis Fuß.
„Woher willst du das wissen?“
„Ich bin kerngesund, das weiß ich bestimmt. Lasst mich weiterziehen“, bettelte Johannes verzweifelt.
„Ich müsste dich mit zurücknehmen, Junge“, sagte der Henker beinahe väterlich.
„Mit zurück? Ich habe hier nichts mehr zu schaffen. Ich will nach Linz! Enns war nur …“
„Die Pest kommt mit Soldaten wie denen da“, unterbrach ihn der Henker und zeigte auf den brennenden Holzhaufen.
„Ich hab keine Soldaten gesehen.“
„Du musst keine Soldaten gesehen haben, um dich anzustecken! Warst du im Hurenhaus?“
Johannes schüttelte entgeistert den Kopf. Tausend Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Er begann, die Zusammenhänge zu begreifen: Die Soldaten hatten unbemerkt die Krankheit in die Stadt und zu den Huren geschleppt. Waren weitergezogen und hatten die Pest dagelassen.
„Unter den Huren und ihren Freiern gab es die ersten Kranken“, bestätigte der Henker, was Johannes sich gerade zusammengereimt hatte, und musterte ihn argwöhnisch.
„Ich war da nicht!“, beteuerte Johannes jetzt verzweifelt. Er wollte auf keinen Fall zurück in die verseuchte Stadt.
Der Henker wiegte nachdenklich den Kopf.
„Verschwinde von hier. Hau ab, hörst du?“, wiederholte er schließlich. „Aber der Teufel soll dich holen, wenn du mich angelogen hast und den Tod mit nach Linz schleppst!“
Johannes war noch immer unfähig, sich zu rühren. Er hatte eine Hand über die Stelle seines Wamses gelegt, unter der er das Andenken an seine Mutter Anna wusste. An sie und zwei andere Frauen, deren Schicksal ihm in diesem Augenblick näher gekommen war als jemals zuvor.
Das Geschrei des Pöbels aus der Stadt war noch immer deutlich zu hören. Nur diejenigen, die den Leichenwagen begleitet hatten, standen nach wie vor stumm vor dem Tor und schauten mit vor Entsetzen gezeichneten Gesichtern zu ihnen herüber.
„Lass dich nicht vom Gekeife der Weiber anstecken, die gleich an der Haußlerin ihr Mütchen kühlen werden.“ Der Henker warf einen verächtlichen Blick über die Schulter zurück zur Stadt. „Hatte schon viel mit angeblichen Hexen zu tun. Keine von ihnen hat auch nur ein Fünkchen der Macht, die man ihnen unterstellt.“ Er zuckte die Schultern. „Woher auch? An den Teufel glaube ich schon lange nicht mehr. Nur an die Dummheit der Leute.“
„Aber trotzdem kümmerst du dich um die Hexen“, brummte Johannes missgelaunt, den der Henker gerade noch zum Teufel gewünscht hatte, an den er angeblich nicht glaubte.
„Kümmern? Wenn du meinst. Wir sind eine alte Freimann-Familie“, knurrte der Henker zurück. „Da wirst du hineingeboren und kommst nie heraus. Wir sind geächtet, geschmäht. Glaubst du, uns gefällt das? In so einer Familie und mit diesem Beruf lernst du sehr schnell, deine eigenen Schlüsse zu ziehen – und dann zu tun, was man von dir erwartet. Ob du und ich das für richtig halten oder nicht, ist eine andere Sache. Darüber entscheiden nicht wir, sondern die Richter. Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege!“
Der Henker wandte sich von ihm ab und kümmerte sich um den brennenden Scheiterhaufen. Johannes schaute ihm regungslos zu. Erst als einer der Knechte des Freimanns ihm einen Stoß gab, dass er beinahe in den matschigen, inzwischen rußgeschwärzten Schnee gefallen wäre, kam wieder Leben in ihn. Wie von Sinnen lief er los, rannte die Straße hinunter, die Stadt weit hinter sich lassend, von deren Turm immer noch der warnende Ruf der Glocke Unheil verkündete. Dabei hatte er ständig das Bild einer der Leichen vor Augen, die nicht nur von Pestbeulen übersät war, sondern auch von unzähligen Flohbissen. Jetzt ekelte er sich nicht mehr nur vor den Blutsaugern, er begann auch, sich vor ihnen zu fürchten. Eine von Anselms Vermutungen tauchte in seinem Kopf auf.
‚Die saugen das kranke Blut aus den Körpern, und bei jedem Biss verbreiten sie ein wenig davon im Blut anderer weiter und verderben es‘, hatte er einmal gesagt. ‚Das ist genau so, als wenn einer mit dreckigen Händen eine Wunde versorgt, und das Blut des Patienten vergiftet. Deshalb wäscht sich jeder anständige Heilkundige die Hände, bevor er sich um eine Verletzung kümmert. Aber weil es schwierig ist, einem Floh beizubringen, sich nach jeder Blutmahlzeit das Fresswerkzeug zu waschen, verbreiten sie das kranke Blut weiter und stecken andere damit an.‘
Johannes hätte gerne gewusst, was Bruder Anselm dazu gesagt haben würde, dass er in diesem Augenblick seine Ansicht teilte. Außerdem beschäftigte ihn der Gedanke, weshalb der Henker die Leichen verbrannt, und nicht ordentlich begraben hatte, wie es sich für Christenmenschen gehörte. Wusste er auch um das alles und schützte damit die Leute in der Stadt? Oder beseitigte er auf diese Weise und von den Stadtoberen so angeordnet die unliebsamen Soldaten und Huren, die an dieser Krankheit gestorben waren?
Stunden später erreichte der Junge über das südliche Donauufer eines der Tore von Linz. Er fragte die Stadtwachen nach dem Herrn Astronomen Johannes Kepler, da er sich nicht an den Namen seiner Tante erinnern konnte. Vielleicht wusste der Meister, wo sie zu finden war, wenn er Bruder Anselm so gut kannte, wie dieser ihm erzählt hatte.
Einer der beiden Männer zeigte ihm den Weg zur Rathausgasse, in der Kepler seine Studierstube hatte.
„Es ist schon spät, da wird dir keiner mehr aufmachen“, meinte er. „Falls du ein Quartier brauchst …“
Aber Johannes war schon losgelaufen. Vielleicht schaffte er es ja, den großen Meister noch an diesem Abend zu sehen.
Vergebens.
Die Fensterläden waren verschlossen, und niemand kam an die Tür, um ihm zu öffnen. Johannes musste wohl oder übel erneut Quartier in einem kleinen Wirtshaus nehmen, und den nächsten Tag abwarten. Wenigstens plagten ihn hier nur ein paar Wanzen, die er zwischen den Fingern zerdrückte.
Seine Ersparnisse waren bis auf wenige Kreuzer zusammengeschmolzen. Er brauchte dringend Arbeit.