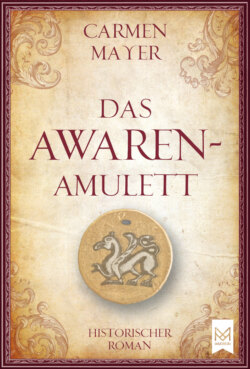Читать книгу Das Awaren-Amulett - Carmen Mayer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеTage verstrichen, das Weihnachtsfest kam und ging, das neue Jahr hatte längst begonnen. Johannes ging dem Meister so willig zur Hand, dass dieser sich äußerst zufrieden mit ihm zeigte und die eine oder andere zusätzliche Münze in seine Hand drückte, wenn der Junge sich besonders geschickt gezeigt hatte. Geschickt war er vor allem im Verhandeln mit den Kunden, was ihnen beiden zugutekam.
Johannes fühlte sich wohl bei Meister Wilhelm und seiner Familie, vergaß dabei aber nicht, weshalb er nach Linz gekommen war. Da er aus dem Haus Johannes Keplers nichts hörte, und man ihn auch nicht zu ihm vorließ, wenn er nachfragte, richtete er seine Botengänge für den Schreiner so ein, dass er eines Tages Frau Susanne, Keplers Gemahlin, auf dem Markt über den Weg lief. Er stellte sich ihr vor und bat sie, bei ihrem Mann ein Wort für ihn einzulegen.
„Er ist doch mein Namenspate, hat Bruder Anselm mir gesagt.“
„Mein Gemahl soll dein Pate sein?“, fragte sie erstaunt. „Davon weiß ich nichts.“
„Ich bitte nur darum, mit ihm reden zu dürfen“, lenkte er ein. Frau Susannes Zögern ließ seine Hoffnung sinken. „Vielleicht kennt er meine Verwandte, die hier in Linz wohnen soll und die ich gern aufsuchen möchte. Sie stammt aus Bruck, soweit ich mich erinnere. Außerdem suche ich meine Schwester, die mit den Bairischen gezogen ist und inzwischen möglicherweise hier in Linz lebt. Könnt Ihr nicht ein Wort bei Eurem Gemahl für mich einlegen? Vielleicht kann er mir weiterhelfen.“
Susanne hörte sich sein verworrenes Gerede stirnrunzelnd an. Sie machte ihm keine Hoffnung darauf, dass Kepler ihn empfangen würde, was auch immer sein Begehr sein mochte. Er plane bereits eine weitere Reise, um Geld für seine Drucke aufzubringen. Seine letzte Reise sei wenig erfolgreich gewesen, das verdrieße ihn. Als sie Johannes’ enttäuschtes Gesicht sah, meinte sie: „Na gut, ich werde zumindest versuchen, ein gutes Wort für dich einzulegen.“
Nach zwei Tagen bangen Wartens kam die Nachricht, dass Kepler den Jungen in seinem Studierzimmer zu sprechen bereit wäre. Der eilte, kaum dass er seinem Meister Bescheid gesagt hatte, zum Haus in der Rathausgasse, von wo aus man ihn jedoch wieder in die Hofgasse verwies. Dort musste er lange Zeit warten, da der Meister im Augenblick mit wichtigen Berechnungen beschäftigt sei, wie jene resolute Küchenmagd ausrichtete, mit der er schon einmal gesprochen hatte.
Frau Susanne fand den Jungen, wie er mit gesenktem Kopf im Hausgang stand. Sie schickte ihn in die Küche, wo er einen Teller Gemüsesuppe bekam. Die Küchenmagd beobachtete ihn dabei mit Argusaugen, als würde er nicht nur die Suppe, sondern auch noch Schüssel und Löffel vertilgen wollen.
Dann endlich ließ ihn Kepler in sein Arbeitszimmer rufen, das er im oberen Geschoß eingerichtet hatte, und in dem er hin und wieder arbeitete, wenn er seine Ruhe haben wollte.
Johannes trat vorsichtig ein und schaute sich ehrfürchtig um. Er fühlte sich völlig erschlagen von den Gerätschaften, papierenen Zeugnissen unendlich vieler mathematischer Berechnungen, von den Büchern, Folianten und was es noch alles zu sehen gab. Einiges erkannte er wieder. Die Instrumente auf dem Tisch und in den Regalen erinnerten ihn an die Geräte, die Bruder Anselm gehört und deren Handhabung er bei ihm gelernt hatte. Aber diese hier übertrafen die einfach gearbeiteten Gerätschaften des Mönchs bei Weitem. Waren sie doch nicht aus Holz gearbeitet, sondern bestanden aus golden glänzendem Metall: aus Messing.
Johannes drehte verlegen seine Kappe in den Händen und konnte den Blick nicht von den Kostbarkeiten wenden. Den Besitzer all dieser Schätze nahm der Junge deshalb zunächst gar nicht so richtig wahr.
„Du bist also mein Patensohn“, begann Kepler nach einiger Zeit mit ruhiger Stimme und musterte den Jungen mit hochgezogenen Augenbrauen. Johannes fuhr erschrocken aus seinen Betrachtungen auf.
Hinter einem Pult stand ein Mann mittleren Alters. Er hatte braune, leicht gewellte, bereits etwas angegraute Haare, eine lange Nase, einen modischen Kinnbart und wache, dunkle Augen, die den Jungen kurzsichtig musterten. Sein Gesicht war blass und zeigte Spuren von Sorge und angestrengter geistiger Arbeit. Seine Statur war eher schmal, seine Kleidung ein wenig abgewetzt. In der einen Hand hielt Kepler eine Feder, in der anderen ein Blatt Papier, das er jetzt zur Seite legte.
„Ihr seid mein Namenspate. So wurde mir jedenfalls von Bruder Anselm gesagt“, berichtigte Johannes, was Kepler eher misstrauisch gesagt hatte, und drehte weiter seine Kappe in den Händen.
„Bruder Anselm.“ Johannes Kepler legte gedankenverloren die Feder neben das Papier. „Er kam vor einiger Zeit hier vorbei und erzählte mir von dem fleißigen Schüler, den er in seiner Einsiedelei unterrichtete.“ Kepler streckte einen Zeigefinger nach dem Jungen aus. „Das bist also du!“
Dass er von seinem Einsiedler als fleißiger Schüler bezeichnet worden war, machte Johannes noch verlegener, erfüllte ihn jedoch gleichzeitig mit Stolz. So stand er jedenfalls nicht als ‚Streuner‘ vor dem Meister, wie jener ihn bei seinem ersten Versuch genannt hatte, mit ihm zu sprechen.
„Ich kann nur einen Gehilfen brauchen, der sich auf die Grundlagen meiner Arbeit versteht“, fügte Kepler an, der glaubte, das Ansinnen seines Besuchers erkannt zu haben. Johannes wagte nicht, nach der Tante zu fragen, was sein eigentlicher Grund gewesen war, herzukommen.
Fassungslos starrte er Kepler an.
„So, und jetzt setz dich da hin und erzähl mir: Woher kennst du meinen alten Freund Anselm?“
Johannes ließ sich vorsichtig auf einem Schemel nieder, der dem Schreibpult des Meisters gegenüber stand.
Wo sollte er anfangen?
Tausend Gedanken schossen ihm durch den Kopf. Als hätte Kepler sie erraten, sagte er: „Ich möchte genau wissen, mit wem ich es zu tun habe. Also erzähl!“
„Ich suche eigentlich nach meiner Tant’“, gestand Johannes leise.
„Nach deiner Tant’?“ Kepler schaute den Jungen überrascht an. „Was soll ich denn mit ihr zu schaffen haben?“
„Sie ist die Schwester von Bruder Anselm“, begann Johannes und rutschte unbehaglich auf seinem Schemel herum.
„Von Bruder Anselm?“, fragte Kepler mit hochgezogenen Augenbrauen. „Ich dachte, es ist deine Verwandte!“
*
„Du solltest über den Winter zu deinen Leuten zurückkehren, und deinem Vater beim Wiederaufbau der Mühle helfen“, sagte Bruder Anselm eines Abends im Frühherbst zu Johannes. „Er kann eine starke Hand gut brauchen, und du könntest deine neuen Kenntnisse gleich in die Tat umsetzen. Über den Seilzug beispielsweise, den ich dir gezeigt habe.“
„Ich hatte nicht hierherkommen wollen“, warf Johannes ein, dem der Gedanke gar nicht gefiel. „Aber inzwischen weiß ich, dass ich noch mehr zu lernen habe, als meine Eltern sich jemals denken konnten.“
Sie waren gerade dabei, Holz für die Feuerstelle in einer Ecke der Hütte aufzustapeln. Das übrige Brennholz hatten sie bereits wie eine zweite Wand rings um die Hütte aufgeschichtet. Eine ideale Isolation gegen die winterliche Kälte, die mit zunehmender Wärme im Frühjahr verschwunden war, wenn man sie ohnehin nicht mehr brauchte.
„Wenn Ihr mir erlaubt, würde ich gerne über den Winter noch hier bleiben, um meine Studien fortzuführen.“
Der Mönch legte schmunzelnd einige Scheite Holz auf und entfachte Feuer. Er freute sich einesteils über den Eifer seines Schülers, andererseits wusste er auch, dass die Familie im Tälchen ihn notwendig brauchte.
„Sobald der Schnee geschmolzen ist, erwarte ich dich wieder hier. So lange wirst du dich bei deiner Familie nützlich machen. Es wird jetzt ohnehin früher dunkel, und da bleibt nicht viel Zeit zum Lesen und Schreiben.“
Er hatte sich nichts sehnlicher gewünscht als diesen Augenblick, wenn Johannes gierig nach neuem Wissen um mehr Informationen und Unterricht betteln würde. Jetzt tat es ihm fast leid, dass er seinem Wunsche nicht sofort entsprechen, sondern sich mit Johannes zusammen bis zum Frühjahr gedulden musste.
Dabei entging ihm nicht, wie sein Schüler zu den seltsamen Instrumenten schielte, die er in einem wollenen Tuch zwischen seinen Arzneifläschchen aufbewahrte. Sie schienen den Jungen schon lange brennend zu interessieren. Anselm hatte nicht vorgehabt, ihm ausschließlich praktisches Wissen zu vermitteln, er wollte immer schon einen begabten jungen Menschen etwas lehren können, das er selber hütete wie ein dunkles Geheimnis. Bislang hatte er immer gehofft, eines Tages den offenen Ackerboden zu finden, in den er die Saat seiner Kenntnisse würde legen können.
Hier war er nun.
Johannes.
Anselm hatte jene Instrumente, die der Junge so sehnsüchtig betrachtete, nicht angefasst, seitdem er hier war. Er hatte gewollt, dass jener von sich aus Interesse bekunden würde – denn wenn nicht, wäre vermutlich alle Mühe vergebens gewesen.
Während er Wasser in einem kleinen Kessel über die offene Feuerstelle hängte, in das er ein Stück Fleisch (Johannes hatte ein Kaninchen in einer geschickt ausgelegten Schlinge gefangen, was Bruder Anselm gebührend kritisierte, bevor er es fachkundig ausnahm und zerlegte) und einige Kräuter und Gemüsebröckchen legte, machte er ein nachdenkliches Gesicht.
„Warum haben mich die Eltern in Wahrheit zu Euch geschickt, Bruder Anselm?“
Der Mönch winkte unwillig ab.
„Nun, das weißt du doch: Nachdem unser allergütigster Herr und Kaiser die protestantischen Schulen zum großen Teil geschlossen und kein Interesse daran hat, Kindern dieses Glaubens eine gute Schulbildung zu ermöglichen, fanden deine Eltern, eine Ausbildung bei mir sei angebracht.“
„Aber Ihr seid doch ein Katholik! Warum unterrichtet Ihr einen protestantischen Schüler?“, stellte Johannes entrüstet die Frage, die ihn schon lange beschäftigte, und ballte dabei unbewusst die Hand zur Faust.
Bruder Anselm sah ihn kurz an und ging dann zum einzigen Fenster hinüber, vor dem er nachdenklich stehen blieb und durch das milchig beschlagene Glas in die Dunkelheit hinausschaute.
„Das ist eine berechtigte Frage, mein Sohn, die nicht ganz einfach zu beantworten ist.“
Bruder Anselm umschloss mit seiner Hand die Faust des Jungen, der neben ihn getreten war, und starrte noch eine Zeit lang in die Dunkelheit vor dem Fenster. Dann ließ er die Faust wieder los und setzte sich an den Tisch, auf dem er ein flackerndes Talglicht entzündete.
Er griff hinter sich nach dem Krug mit Wein, den er zusammen mit zwei Bechern auf die Tischplatte stellte. Sorgfältig füllte er sie und reichte Johannes einen davon hinüber.
„Dein Vater wurde als Protestant in Graz geboren, wo er auch aufwuchs und zur Schule ging“, begann er schließlich. „Als er ein junger Mann war, lernte er seine Barbara kennen, und die beiden heirateten kurz darauf.“
„Barbara? Aber meine Mutter heißt Anna!“
„Warte. Dein Vater zog mit ihr nach Bruck, wo er eine gute Anstellung bei einem Kaufmann gefunden hatte. Leider starb seine Frau wenige Tage nach ihrer ersten Niederkunft. Dein Vater holte die Schwester seiner verstorbenen Frau als Amme zu sich, da sie kurz zuvor ebenfalls entbunden hatte. Während einer Fahrt nach Hieflau lernte dein Vater die Anna kennen, und heiratete sie noch im selben Jahr. Sein Kind wusste er bei seiner Schwägerin in guten Händen. Kurz darauf starb sein neuer Schwiegervater, und dein Vater übernahm zusammen mit seiner Frau die Rechte für die Mühle, die der Alte den beiden hinterlassen hatte. Aber keiner der ortsansässigen Bauern wollte mit dem Fremden zu tun haben – zum Teil schon deshalb nicht, weil sich einige der Männer die Anna zur Frau oder als gut situierte Schwiegertochter ausgedacht hatten, und sich von dem Dahergekommenen um eine Heirat und gute Partie betrogen fühlten. Ganz abgesehen davon, dass dein Großvater einmal eine gut gehende Badeanstalt betrieben hatte, die ihm ein schönes Zubrot einbrachte.“
„Badeanstalt?“
„Oh ja! Die Mühlhäusler hatten früher ein Badehaus, von dem gesagt wird, es stamme noch aus der Römerzeit. Das glaube ich allerdings weniger, weil die Römer ihre Badehäuser von heißen Quellen speisen ließen, die es hier nirgends gibt. Aber das Gerücht, es stamme aus uralten Zeiten, hält sich wie alle Gerüchte äußerst hartnäckig.“ Er trank einen Schluck Wein und fuhr dann fort: „Aus welcher Zeit es auch stammen möge: Der Alte hatte es eines Tages wieder instand gesetzt. Nachdem es bereits ein Mühlrad gab, brauchte dein Großvater das Wasser nur noch über eine geschickt angebrachte Vorrichtung in die Badestube umzuleiten. Das hat er auch gemacht.“
„Mein Großvater war ein Bader?“, fragte Johannes überrascht. Das mit den heißen Quellen würde er sich später erklären lassen. Er konnte sich nur eiskaltes Wasser vorstellen, das aus dem Boden quoll. Aber heißes?
„Ja, und ein sehr guter noch dazu. Die Leute kamen gerne zu ihm, weil er sauber und ordentlich war und vor allen Dingen die schlechten Weiber von seinem Badehaus fernhielt, die bloß Unruhe hineingebracht hätten.“
„Davon wusste ich nichts.“ Johannes überlegte, wie das mit den schlechten Weibern gemeint war. Woher sollten die gekommen sein? „Außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass so ein Badehaus von vielen Leuten aus dem Tälchen besucht wurde.“
Bruder Anselm lachte. „Lass dir mehr darüber von deiner Mutter erzählen, mein Junge! Die Leute sind zwar heutzutage der Meinung, sie bekämen die Sucht oder gar noch Schlimmeres, wenn sie von Kopf bis Fuß ins Wasser geraten. Aber es gab welche, die es besser wussten und ein Badehaus wie das deines Großvaters schätzten.“ Er machte eine kurze Pause, in der er Johannes nachdenklich ansah. „Viele kamen von Admont, viele auch aus dem Dorf unten an der Enns.“
„Von Admont?“, fragte Johannes ungläubig. „Aber das Stift …“
„Aus Admont, ganz richtig. Und aus Hieflau. Es war das einzige Badehaus weit und breit und wurde von denen hoch geschätzt, die eine solche Einrichtung gern aufsuchten. Damals gehörte übrigens auch der Klerus aus Admont dazu. Denen war es egal, ob der Bader protestantisch oder römisch war.“
Johannes dachte daran, wie sehr seine Mutter Anna darauf bedacht war, dass die ganze Familie sich von Kopf bis Fuß mit Wasser und ihrer selbst hergestellten Seife sauber hielt. Im Sommer geschah das am Bach, im Winter in einem großen Zuber neben dem Herd. Was zugegebenermaßen zumindest bei Johannes jedes Mal ein unbeschreiblich gutes Gefühl auf der Haut hinterließ. Niemand in der Familie wurde jemals von den allgemein verbreiteten Läusen und anderem Getier geplagt. Geschweige denn, dass sie so gestunken hätten wie manch einer von den Nachbarn oder den Leuten, denen Johannes während seiner Aufenthalte im Dorf oder in Admont und Hieflau begegnet war.
Vom Großvater also hatte sie das.
„Nun, dein Vater musste sich wohl oder übel eine andere Arbeit suchen, als die Aufträge für die Mühle ausblieben, weil Korn und Mehl anderweitig beschafft wurden“, fuhr Bruder Anselm fort. „Schließlich fand er Arbeit bei den Holzknechten. Die fragten nicht nach seinen Geschichten und seiner Religion, die brauchten Männer, die zupacken können.“
„Ich kenne das Badehaus überhaupt nicht“, überlegte Johannes, dem der soeben gehörte Teil der Geschichte hinlänglich bekannt war. „Hat mein Vater es abgerissen?“
Bruder Anselm kratzte sich am Kopf. Dann begann er, sich umständlich die Fingernägel zu säubern, wozu er ein angespitztes Stückchen Holz benutzte.
„Eines Tages, zur Zeit deines Großvaters, als ein paar landesfürstliche Truppen plündernd über Eisenerz hereinbrachen, zogen sie auf ihrem Weg an der Enns entlang. Sie durchstreiften die Nebentäler und verwüsteten das Badehaus der Mühlhäusler. Sie taten dies wohl aus Wut darüber, dass sie gegen die Bewohner des Gesäuses und der angrenzenden Täler nichts hatten ausrichten können, von denen sich einige in die umliegenden Berge geflüchtet hatten. Sie hatten nichts zurückgelassen, was für die Schurken von Wert gewesen wäre. Außerdem hielten die erzkatholischen Lumpen nichts von solchen Einrichtungen wie der deines Großvaters, in denen ihrer Ansicht nach die Sünde hauste.“ Anselm lachte erneut leise vor sich hin. „Ausgerechnet diese Leute wagten es, andere sündig zu nennen.“ Eine Zeitlang schwieg er nachdenklich, und Johannes befürchtete schon, er würde nicht weitersprechen. „Es war ein Leichtes für sie, vor den Augen deiner Großmutter alles kurz und klein zu schlagen, was ihrer Zerstörungswut unter die Hände kam, während dein Großvater Mehl auslieferte.“ Er stand auf und ging zum Suppenkessel, um darin bedächtig umzurühren.
„Der Großmutter und Anna ist dabei nichts geschehen?“, fragte Johannes leise.
„Nein, ihnen ist nichts geschehen.“
„Und warum hat mein Vater es später nicht wieder aufgebaut?“
„Nun ja, wie gesagt, deinen Vater mieden die Bauern. Außerdem bekam er von denen in Admont keine Erlaubnis mehr dazu. Die haben inzwischen auch etwas gegen solche Einrichtungen. Besonders wenn sie Protestantischen gehören.“ Anselm zog nachdenklich eine Grimasse. Johannes wusste inzwischen, dass der Mönch keinesfalls mit allem einverstanden war, was der Klerus vorgab, und oftmals seine eigenen Wege ging. Er vermutete darin auch den Grund dafür, weshalb der Alte als Einsiedler lebte.
„Die Grundmauern und Steine hat dein Vater dazu verwendet, einen Stall zu errichten, der heute noch dort steht.“ Johannes nickte nachdenklich und schnupperte. Es roch appetitlich, und er bekam Hunger.
„Was ist eigentlich aus dem Kind in Bruck geworden, von dem Ihr erzählt habt? Das ist doch über den Vater mein Geschwister“, bemühte er sich, wieder auf sein eigentliches Anliegen zurückzukommen. Er hatte den Verdacht, dass Bruder Anselm versuchte, ihm in diesem Punkt auszuweichen.
„Ja, das Kind.“ Bruder Anselm setzte sich wieder an den Tisch und schaute nachdenklich auf seine gefalteten Hände. „Es blieb zunächst bei jener Schwägerin deines Vaters in Bruck. Aber dann kamen die Kapuziner in die Stadt, die unser damaliger Fürst von Gottes Gnaden ansiedeln ließ. Mit ihnen begannen unruhige Zeiten. Jahre zuvor hatte man den Brucker Bürgern noch zugestanden, ihren Glauben nach eigenem Gutdünken auszuüben, aber eines Tages überlegte es sich der Landesfürst anders und ließ die protestantischen Bürger unter Druck setzen. Außerdem gingen die Geschäfte der Brucker Kaufleute immer schlechter, die vom Salzhandel lebten. Es entstand Unfrieden, der auch vor der angeheirateten Familie deines Vaters nicht Halt machte. Deshalb übergab die Schwägerin das Kleine dessen Onkel mit der Bitte, es zu seinem Vater zu bringen. Sie selbst zog mit ihrem Mann und ihren eigenen Kindern nach Linz.“
Johannes starrte den Mönch mit aufgerissenem Mund an.
„Wenn sie nach Linz zog – weshalb hat sie das Kind dann nicht selber seinem Vater gebracht? Das lag doch am Weg! Ich habe außerdem nie davon gehört, dass jemand meinem Vater ein Kind gebracht hätte.“
„Langsam, langsam! Ganz abgesehen davon, dass euer Tälchen ein Stück vom direkten Weg entfernt liegt: Es war inzwischen äußerst gefährlich geworden, in Bruck ein Protestant zu sein. Der Onkel des Kindes war zusammen mit einigen angesehenen und guten Männern in Graz an der Stiftsschule angestellt. Eines Tages verbot der Erzherzog deren Arbeit an der Schule, ließ die protestantischen Lehrer und Professoren aus der Stadt vertreiben und ihre schriftlichen Werke öffentlich verbrennen. Der Onkel hatte mit ansehen müssen, wie unersetzbare Schätze der Wissenschaft unter dem Gejohle eines Haufens ungeschlachter Dummköpfe in Schutt und Asche zerfielen.
Eines Abends eröffnete ihm sein Freund, ein gewisser Johannes Kepler, er müsse die Stadt verlassen, wolle er nicht Gefahr laufen, gewaltsam seiner bisherigen Arbeitsstelle verwiesen zu werden, oder noch Schlimmeres. Er vertraute ihm an, dass er wohl mit den falschen Leuten über seine Auffassung zur Abendmahlsfrage gesprochen habe. Kepler ist Calvinist.“
Johannes erfuhr weiter, dass Johannes Kepler sehr viel über die Gestirne herausgefunden hatte, die der Junge aus dem Tälchen bislang lediglich als glitzernde Lichtpunkte am Himmel betrachtet hatte, deren Standpunkt sich im Jahreslauf veränderte. Wobei er sich allerdings niemals Gedanken darüber machte, worauf ihre Helligkeit beruhte und was sie bedeuten mochten. Es waren eben Lichtpunkte, Sterne, nichts sonst.
„Weißt du, was Johannes Kepler einmal zu seiner Mutter gesagt hat, als er noch klein war?“, fragte Bruder Anselm, als Johannes ihm seine Gedanken dazu mitteilte. „Es sieht aus wie ein schwarzer Mantel mit lauter kleinen Löchern drin, hinter dem ein Licht brennt.“
Johannes musste lachen. Genau so hatte er es auch einmal gesehen.
Bruder Anselm hatte ein Büchlein, das sein wertvollster Besitz war, und das er Johannes eines Tages gab. Es hieß De Iesu Christi servatoris nostri vero anno natalitio, in dem Johannes Kepler die Frage nach dem astronomisch richtigen Geburtsjahr Christi aufwarf und zu ergründen versucht hatte.
„Das hat Johannes Kepler geschrieben. Wenn dein Latein gut genug ist, wirst du verstehen, wovon er spricht.“
Er erreichte damit, dass Johannes jede freie Zeit damit verbrachte, sein Latein zu vervollständigen, damit er das Büchlein lesen konnte.
„Kepler befürchtete eines Tages, zwischen die religionsstreitigen Fronten zu geraten“, fuhr Bruder Anselm fort. „Nach einem langen Gespräch mit dem Meister beschloss der Onkel jenes Kindes, von dem ich dir erzählt habe, einen sehr eigenwilligen Weg zu gehen: Er konvertierte zusammen mit einigen anderen Menschen, die keine Lust hatten, sich wegen religiöser Fragen vertreiben zu lassen, zum Katholizismus. So hatte er, wie er dachte, die Möglichkeit, unter dem Deckmantel dieser Religion an seinen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterarbeiten zu können. Die Kapuziner, deren Orden er als Laienbruder beigetreten war, zeigten sich anfänglich sehr misstrauisch und ließen ihn zunächst nur dort wirken, wo er ihrer Meinung nach keinen größeren Schaden anrichten konnte: beim Bau des neuen Kapuzinerklosters.“
Johannes hatte bisher schweigend zugehört. Jetzt sah er dem Mönch gerade ins Gesicht und sagte mit belegter Stimme: „Ich nehme an, dass Ihr dieser Onkel seid?“
„So ist es, mein Junge.“
„Verräter!“, zischte Johannes und verschränkte abwehrend die Arme vor der Brust.
„Es steht dir frei, es so zu sehen“, antwortete Bruder Anselm verständnisvoll. „Vielleicht siehst du das eines Tages anders.“
„Das kann ich mir nicht vorstellen“, antwortete ihm der Junge trotzig.
Bruder Anselm ging nicht weiter darauf ein.
„Ich bin damals zu den Kapuzinern gegangen, weil ich sie als das kleinere Übel betrachtete.“ Er schüttelte gequält den Kopf. „Die Jesuiten und ihre Machenschaften waren mir nur zu gut bekannt. Sie hatten schon seit Jahren versucht, unsere Arbeit an der Schule zu stören, und immer wieder alles getan, um die wenigen Katholiken in der Stadt gegen die Protestanten aufzubringen. Das gelang ihnen gelegentlich auch, wenngleich ihr Vorgehen dabei mehr als schändlich war für einen christlichen Orden.“
„Davon habe ich gehört“, murmelte Johannes nachdenklich.
„Sie haben die schlecht gehenden Geschäfte der Handelsleute geschickt ausgenutzt“, fuhr Bruder Anselm fort. „Ihren verleumderischen Hetzreden zufolge konnten daran nur die ketzerischen Protestanten schuld sein, die der Teufel geschickt habe, um den Anhängern des wahren, des katholischen Glaubens das Leben schwer zu machen. Eine Prüfung unseres Allerhöchsten HErrn wollten sie darin sehen, die ein aufrechter, frommer Katholik jedoch zweifelsfrei zu bestehen wusste. Manche haben daran geglaubt, weil sie einfach daran glauben wollten. Manche, weil sie froh waren, endlich einen Sündenbock für ihre missliche Lage gefunden zu haben, den sie zur Verantwortung ziehen konnten. Du kennst das doch aus eigener Erfahrung: Die Leute haben keine Arbeit, werden viel zu hoch mit Abgaben belegt, sind verarmt und krank. Dazuhin sind sie nicht gebildet genug, die Ursache für ihre Misere zu begreifen, die oftmals in ihnen selber steckt – meistens aber auch in der Obrigkeit, in den Landesherren, an die sie nicht herankommen und die sie ja auch nicht ungestraft angreifen können. Wenn dann einer kommt, der diesen Leuten laut genug sagt, diese oder jene seien schuld an ihrem Elend, und ihnen noch zusichert, es geschehe ihnen selber nichts, wenn sie die anderen an den Pranger liefern, laufen sie ihm sofort nach und schreien noch lauter und sind noch grausamer in ihrem Wahn als der, der sie dazu angestiftet hat.“
Er schwieg einen Augenblick und schüttelte Gedanken ab, die ihn offenbar quälten. Dann nahm er einen großen Schluck aus seinem Becher, den er beinahe unablässig in den Händen gedreht hatte.
„Wenn man genauer hinsieht“, fuhr er schließlich fort, „kann man erkennen, wessen Geistes Kind diese Menschen sind. Nicht selten die versoffensten, heruntergekommensten Elemente, die Gottes Erdboden jemals betreten haben. Ohne jegliche Bildung und den Kopf voller Bohnenstroh und Unrat. Es ist kein Wunder, dass diese geistig verkümmerten Kreaturen anfällig sind für Aberglaube und Hetze. Es lenkt sie von ihren eigenen Unzulänglichkeiten und Kümmernissen ab. Außerdem bietet es ihnen die Möglichkeit, sich ungestraft an wehrlosen Unschuldigen auszulassen und abzureagieren. Dazu kommt dann noch die Unzufriedenheit, weil sie keine Arbeit finden, Hunger haben und allen erdenklichen Ungerechtigkeiten ausgesetzt sind, die ihnen das Leben bietet. All das sind Dinge, die die Menschen schließlich in die weit offenen Arme all derer treiben, die ihnen ein besseres Leben oder eine Erlösung von ihren Plagen versprechen. Dass es Lügen sind, will keiner sehen. Zu aufregend sind die Möglichkeiten, die sich diesen Armen im Geiste bieten.“
Er hatte sich so aufgeregt, dass er erst einmal tief durchatmen musste. Lange starrte er in das flackernde Licht der Unschlittkerze auf dem Tisch. Die Erinnerung an Erlebtes war plötzlich wieder wach geworden und machte ihn heute so betroffen wie damals, bevor er die Menschen schließlich floh und sich in die Einsiedelei zurückzog.
„Es wird erzählt“, fuhr Anselm schließlich müde fort, „dass auf Betreiben der Jesuiten viele rechtschaffene Bürger von ihren Nachbarn verleumdet und daraufhin verhaftet und ins Loch geworfen wurden. Wenn man den Berichten der wenigen wieder Entlassenen glauben darf, ging man nicht gerade zimperlich mit ihnen um. Du wirst verstehen, dass ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben will, die sich auch noch Christen nennen.“
„Und die Kapuziner?“
„Zuerst ließen sie sich recht gut an, aber bald merkte ich, dass sie den Jesuiten in nichts nachstanden, was die Verfolgung und Vertreibung der Protestanten betraf.“
„Und was wurde aus dem Kind?“, hakte Johannes ungeduldig nach, der merkte, dass sein Lehrer zögerte, über das zu reden, was der eigentliche Grund für das Gespräch gewesen war. Der stand auf und schaute nach der Suppe, während Johannes Schüsseln und Brot vorbereitete und sich dann wieder setzte. Der Mönch schöpfte für sie beide etwas von der Suppe in die Schüsseln, brach das Brot darüber und sprach seinen Segen. Dann begann er, schweigend zu essen.
„Ach ja, das Kind“, sagte er, als er fertig gegessen, und die Reste in seiner Schüssel mit Brot ausgestrichen hatte. Er trank noch einen Schluck aus seinem Becher und stellte ihn auf die Tischplatte zurück. Dann sprach er ein kurzes Dankgebet, rülpste ein paar Mal und faltete die Hände über der Brust.
„Eines Abends steckte mir jemand die Nachricht zu, dass meine Schwester an einem gewissen Ort auf mich warten würde, sie benötige meinen Beistand in einer dringenden Sache. Ich fuhr unter einem guten Vorwand nach Bruck, und suchte die bezeichnete Stelle auf. Als ich dort ankam, lag nur ein Bündel mit dem Kind in einem verlassenen Hausflur, und ich konnte gerade noch sehen, wie sich ein Schatten, ganz an die Wand gedrückt, davonstahl. Ich fand einen Zettel bei dem Bündel und erfuhr, dass es sich bei dem Kind um meinen Neffen handele und was zunächst zu tun sei. Ich verstand, dass meine Schwester berechtigte Bedenken hatte, mit dem Balg eines Protestanten die weite Reise anzutreten, und annahm, es sei in der Obhut eines Katholischen sicherer.“
„Was war so übel daran, mit dem Kind eines Protestanten zu reisen?“, wollte Johannes wissen.
„Es waren zu viele unterwegs, die es den Protestanten schwer machten“, versuchte der Einsiedler eine Erklärung. „Das muss dir erst einmal reichen. Es gelang mir jedenfalls, den Kleinen zu seinem Vater ins Tälchen zu bringen, und seine zweite Frau nahm ihn sofort an Kindes statt an. Sie war inzwischen selber guter Hoffnung. Die beiden lebten in recht beschwerlichen Verhältnissen, wie ich dir erzählt habe, aber ich konnte feststellen, dass sie einander sehr zugetan waren und eine außergewöhnlich gute Ehe führten. Der Junge wurde am darauf folgenden Sonntag in der protestantischen Dorfkirche im Tälchen getauft, da dies in Bruck nicht möglich gewesen war.
Zum Andenken an meinen Freund in Graz und mit dem Wunsch, das Kind käme ganz nach ihm, nannten wir es – Johannes.“
Er sah auf. Johannes saß wie vom Donner gerührt mit offenem Mund vor ihm und war nicht in der Lage, etwas zu sagen. Bruder Anselm erhob sich und holte seinen Krug mit Wein vom Bord, dessen restlichen Inhalt er zur Hälfte in seinen, zur anderen Hälfte in Johannes’ Becher füllte.
„Sagt das noch einmal!“, flüsterte Johannes. In seinem Gesicht lag der Ausdruck eines gequälten Tieres.
„Du warst von Anfang an willkommen bei der Anna“, sagte Bruder Anselm beschwichtigend und hob seinen Becher. „Trink einen Schluck.“
„Das weiß ich“, gab Johannes zu, „das weiß ich doch!“ Er sank weinend auf seinem Hocker zusammen. „Aber ich verstehe nicht, warum mir das niemand gesagt hat!“
„Weil es nicht notwendig war“, entgegnete Bruder Anselm ruhig.
„Nicht notwendig? Habe ich nicht ein Recht darauf …“
„Recht?“ Bruder Anselms Stimme wurde laut. „Worauf hast du ein Recht? Du weißt jetzt, wer deine Mutter war und wie alles gekommen ist. Du bist der leibliche Sohn des Mannes, den du bislang Vater genannt hast, und es gibt keinen Grund, dich über irgendetwas daran aufzuregen, hast du mich verstanden? Jetzt beruhige dich wieder!“
„Ich weiß nicht, wer meine Mutter war!“ Johannes schniefte und wischte den Rotz am Ärmel seines Hemdes ab. „Sie haben die Anna gemieden, weil sie meinen Vater geheiratet hat, der für sie ein dahergelaufener Lump war, nicht wahr?“
„Deine Mutter – ich meine, die Anna – war ein sehr hübsches Mädchen, und viele Männer hätten sie gerne zur Frau gehabt, ja. Aber sie hat sich eben in deinen Vater verliebt und ihn geheiratet.“
„Dann hat man ihm auch noch das Balg aus der ersten Ehe gebracht.“
„Nicht ‚man‘, Johannes. Ein Katholischer, und dazu noch einer in der Mönchskutte! Das gab genügend Zunder und entfachte ganze Flächenbrände übler Verleumdungen über die Herkunft des angeblichen Bastards, den deine Eltern aufzogen. Aber sie haben zusammengehalten und dich so liebevoll großgezogen, wie sie nur konnten.“
Er schwieg und steckte ein neues Talglicht an, weil das andere bereits heruntergebrannt war. Draußen hörte man den ersten Herbststurm um die Hütte pfeifen. Wie gut, dass sie rechtzeitig die Wände und das Dach der Hütte ausgebessert und inzwischen vorsorglich die Läden des einzigen Fensters geschlossen hatten.
„Ich hatte irgendwann die Möglichkeit, diese Einsiedelei hier zu übernehmen“, fuhr Bruder Anselm fort. „Offiziell war es als Buße für meine gelegentlichen Eigenständigkeiten gedacht. Für mich war es hingegen ein willkommener Anlass, die Gemeinschaft der Brüder und die wirklich schändlichen Zustände in der Stadt verlassen zu können. Niemand wusste um meine entfernte Verwandtschaft mit den Mühlhäuslern, als ich hierherkam. Man erinnerte sich nur daran, dass ich damals das Kind gebracht hatte, und tuschelte gelegentlich noch hinter vorgehaltener Hand über meine mögliche Vaterschaft.“
Eine Zeit lang saßen sie schweigend da, jeder in seine eigenen Gedanken versunken.
„Beantwortet mir noch eine Frage“, bat Johannes. „Woran ist meine Mutter gestorben?“
*
Kepler hatte dem Jungen aufmerksam zugehört, der seine Erzählung an dieser Stelle beendete. Hatte er erwartet, dass ihn der Meister wütend hinauswerfen würde, so hörte er jetzt überrascht etwas völlig anderes.
„So ist das also. Du suchst tatsächlich nach deiner Tante. Ich muss sagen, dass ich ernsthaft geglaubt hatte, du wolltest dich bei mir als Gehilfe verdingen. Deine Ehrlichkeit gefällt mir.“
Eine Frage brannte Johannes noch auf der Seele, die er unbedingt loswerden musste.
„Wisst Ihr, wo Bruder Anselm ist? Er hat die Einsiedelei verlassen und ist einfach weggegangen, ohne uns zu sagen, wohin.“
„Nein, ich weiß nicht, wo er sich aufhält“, antwortete Kepler, der sich inzwischen ein Bild davon machen konnte, wie viel der alte Mönch dem Jungen bedeutete. „Vielleicht ist er wieder einmal auf eine seiner vielen Reisen gegangen. Da hat er sich zumindest von mir nicht immer groß verabschiedet und gesagt, wo er sich aufhalten wird. Ich vermute, er wusste es anfangs meistens selber nicht so genau.“
„Dann wisst Ihr auch nichts über den Verbleib meiner Tante, nehme ich an.“
„Nein, ich weiß nicht, wer das sein soll. Aber sobald ich etwas von Bruder Anselm höre, frage ich ihn nach ihr.“
Er griff nach seiner Feder und schaute nachdenklich auf das Papier, das vor ihm auf dem Pult lag.
„Bezahlen werde ich dir nichts“, fuhr er dann fort. „Aber du kannst in einem der Botenzimmer nächtigen und hast freie Kost. Morgen beginnt dein Dienst.“
Johannes errötete. Mit dieser Wendung hatte er nicht gerechnet. Er würde sofort zum Schreiner laufen und ihm Nachricht geben, versicherte er noch, bevor er aus Keplers Arbeitszimmer stürmte. Er musste unbedingt mit Meister Wilhelm sprechen.