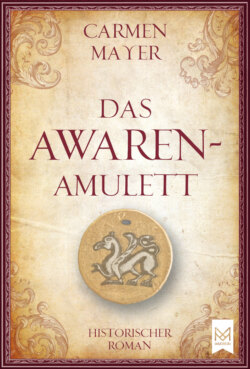Читать книгу Das Awaren-Amulett - Carmen Mayer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеKepler hatte nach dem Tod des ihm wohl gesonnenen habsburgischen Kaisers Rudolf II. in Linz eine Stelle als Provinzmathematiker angenommen, und wurde 1621 als Kaiserlicher Mathematiker bestätigt. Er war mit den Rudolfinischen Tafeln und den Harmonices mundi libri V, den Fünf Büchern über die Harmonik der Welt, fertig geworden und im Herbst nach Wien gereist, um Geld für den Druck seiner Werke zu sammeln. Erst vor Kurzem war der Meister nach Linz zurückgekehrt, um seine Arbeit als Landesmathematiker wieder aufzunehmen. Außerdem warteten seine Studiosi an der Landschaftsschule darauf, weiter von ihm unterrichtet zu werden. Ganz zu schweigen von den hochherrschaftlichen jungen Männern, denen er privaten Unterricht gab.
Johannes stand am nächsten Tag zitternd vor Aufregung erneut vor dem Haus in der Rathausgasse. Ein Holzknecht humpelte gerade heraus und hielt ihm die Tür auf.
„Der ist nicht gut zu sprechen heut’, der Herr“, knurrte er und zählte ein paar Münzen in seinen abgewetzten Beutel. „Hat wohl nichts gebracht, seine Bettelreise nach Wien, so grantig, wie der ist!“ Er warf dem Jungen einen mitleidigen Blick zu. „Aber was will ein Calvinistischer auch bei unserem erzkatholischen Kaiser erreichen! Das muss er doch vorher schon gewusst haben, dass daraus nichts wird.“ Er schüttelte verständnislos den Kopf. „Was auch immer dein Begehr ist: Heute wirst du kein Glück da drin haben. Ich rate dir, zu Keplers Wohnung in der Hofgasse zu gehen und bei seinem Weib vorzusprechen. Da hast du sicherlich mehr Glück!“
Johannes ließ sich den Weg zur Hofgasse zeigen und fand dort auch schnell das Wohnhaus der Keplers, nicht weit unterhalb des Linzer Schlosses.
Zögernd betrat er den düsteren Hausgang. Eine der Küchenmägde ließ ihn mit in die Hüfte gestemmten Fäusten und energischem Tonfall wissen, dass er einen schlechten Tag erwischt habe, was auch immer ihn in das Kepler’sche Haus getrieben haben mochte.
Sie hieß ihn schließlich im Hausflur warten.
Kepler, der zum Mittagsmahl nach Hause kam, ließ ihn denn auch schroff mit dem Hinweis darauf abweisen, er habe keine Zeit für dahergelaufene Streuner. Vermutlich hatte ihm das dumme Weib nicht gesagt, dass Johannes lediglich wissen wollte, wo seine Tante lebte. Kepler ließ ihm noch ausrichten, er möge sein Glück bei einem Schreinermeister wenige Gassen weiter versuchen, der gerade einen Tagelöhner für die Auslieferung seiner Särge suchte.
Schreinermeister Wilhelm kratzte sich am Kopf, als Johannes vor ihm stand.
„Soso, der Herr Kepler schickt dich.“ Er musterte den Jungen lange, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
„Ich wollte von ihm nur wissen, ob er den Verbleib meiner Tant’ kennt, die hier in Linz wohnen soll. Aber man hat ihm scheint’s meine Frage nicht ausgerichtet.“
„Wie heißt sie denn, deine Tant’?“, fragte der Schreiner schließlich und wandte sich seiner unterbrochenen Arbeit zu.
„Das weiß ich nicht“, gestand Johannes, dem im selben Augenblick klar wurde, wie unsinnig sein ursprünglich gefasster Plan war. „Kann ich hier bleiben und Euch bei der Arbeit helfen, bis ich die Frau gefunden habe?“
„Du willst sie selber suchen?“, fragte der Meister und schüttelte den Kopf. „Linz ist groß. Und wenn du sie mitsamt ihrem Namen nicht kennst?“
„Sie kommt aus Bruck.“
Der Meister schüttelte abermals den Kopf.
„Es sind viele Leut’ zu uns gekommen, weil sie geglaubt haben, hier sicher vor den Katholischen zu sein. Der bairische Statthalter selber wär’ schon recht, aber der Kaiser will, dass er strenger durchfährt mit den Leut’ als bisher. Es wird Ärger geben, weil immer mehr aus dem Landl zu uns kommen. Also es ist nicht so weit her, das mit der Sicherheit, mein’ ich. Nicht auf Dauer.“
Johannes erfuhr außerdem, dass sich dieser Adam Graf von Herberstorff mit ausdrücklicher Erlaubnis des bairischen Herzogs und gegen die Zustimmung der Linzer Stadtbevölkerung auf Schloss Linz breitgemacht hatte. Von dort aus verfolgte er seit einiger Zeit gnadenlos das ‚protestantische Gesindel‘, das störrisch an seinem Glauben festhielt und sich nicht katholisch machen lassen wollte. Herberstorff sei ursprünglich selber ein Evangelischer gewesen, dessen Sinn sich gewandelt habe, als er mit dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm in Kontakt kam, führte der Schreiner weiter aus. Der hatte damals gerade Pfalz-Neuburg rekatholisiert und war darum bemüht, auch möglichst viele Adelige und andere hochstehende Persönlichkeiten von seiner neuen Glaubensrichtung zu überzeugen. Denn auch dieser Pfalzgraf war evangelisch aufgewachsen, schien aber bei den Katholischen ein besseres Auskommen erwartet und gefunden zu haben, als bei seinen alten Glaubensbrüdern. Die Lutherischen waren nach seiner und inzwischen auch Herberstorffs Auffassung ohnehin dem Untergang geweiht.
Also warum sich nicht denen anschließen, die Macht und Ansehen und ein glückliches Einkommen sicherten? Und die ihm außerdem erlaubten, mit seinen Untertanen umzuspringen, wie ihm gerade beliebte?
Ungeheuerlich!
Meister Wilhelm musterte Johannes nachdenklich, der mit offenem Mund zugehört hatte. Dabei schien ihm wieder einzufallen, was der Ausgang seiner Überlegungen gewesen war.
„Es wird schwierig werden, deine Tante zu finden, wenn du nichts über sie weißt. Aber wenn du bei mir bleiben willst: Um diese Jahreszeit gibt es genug Arbeit. Die Leute sterben bei der Kälte wie die Fliegen, und ich könnte einen Helfer brauchen. Nur viel zahlen kann ich nicht. Woher kommst du?“
Johannes hatte keine Lust, dem Meister seine ganze Geschichte zu erzählen. Also sagte er nur: „Aus der Gegend von Enns.“
Meister Jakob schaute ihn aus zusammengekniffenen Augen an. Er hatte ihn missverstanden.
„Du redest nicht wie die Leute von dort. Also: Woher kommst du?“
„Genauer gesagt aus dem Geseis“, gab Johannes zögernd zu.
„Das heißt also, du bist über die Stadt Enns gekommen? Da läuten sie die Pestglocke. Hoffentlich kommt der Schwarze Tod nicht auch zu uns. Du warst doch nicht in Enns selber, oder?“, fragte er misstrauisch.
„Nein“, log Johannes und fügte wahrheitsgemäß noch an: „Man lässt keinen mehr hinein oder heraus.“
Der Alte musterte ihn argwöhnisch. Johannes hielt seinem Blick trotzig stand.
„Ich kann ja als Lehrbub hier anfangen …“, sprach er zögerlich weiter.
Meister Wilhelm lachte schallend.
„Hast du denn Geld, um für deine Lehrjahre bezahlen zu können?“
Johannes schüttelte überrascht den Kopf. Lehrgeld? Daran hatte er überhaupt nicht gedacht. Der Vater hatte davon gesprochen, bevor er den Jungen zu Bruder Anselm geschickt hatte. Aber der wollte kein Geld haben. Im Holzschlag wiederum hatte keiner nach Lehrgeld, sondern vielmehr nach Muskelkraft und Ausdauer gefragt.
„Verstehst du denn was von der Schreinerei?“, wollte Meister Wilhelm wissen, als er keine Antwort bekam.
Johannes erzählte ihm von seinen Arbeiten bei den Holzhauern und mit dem Vater zu Hause, und der Meister schien damit zufrieden zu sein. Er brauchte jemand, der seine Werkstücke in die Häuser brachte und dafür nicht viel Geld verlangte. Dazu musste er nur zuverlässig sein. Also wies er ihm für die Nacht einen Platz in der Werkstatt an, alles Weitere würde sich finden.
Johannes war alles recht, solange er nur die Möglichkeit hatte, in der Nähe Keplers bleiben und über ihn seine Tante finden zu können.
Und Elisabeth.
„Sind hier Soldaten stationiert, die aus dem Geseis zurückgekommen sind?“, fragte er.
„Aus dem Geseis? Was hätten die dort zu tun gehabt?“ Meister Wilhelm schüttelte den Kopf. „Hier sind viele Soldaten, hauptsächlich bairische. Aber wo die waren – also das weiß ich nicht.“
Es gab fürwahr viel zu tun in der Werkstatt des Schreiners. In einigen Wirtshäusern waren nach üblen Schlägereien zwischen kaiserfreundlichen und kaiserfeindlichen Lagern einige Möbelstücke zu Bruch gegangen, die ausgebessert oder neu geschreinert werden mussten. Außerdem hatte Andreas Ungnad, der protestantische Herr von Schloss Ennsegg, einige Möbelstücke bei Meister Jakob bestellt, die unfertig an der Wand standen.
„Der hat sich gegen unseren Kaiser gestellt“, brummte der Meister, als Johannes ihn auf die Möbel ansprach. „Daraufhin hat man seinen Besitz beschlagnahmt und dem bairischen Rat Ott Josef von Kirchberg übergeben. Der wiederum gewährt Herberstorff und seinen Mannen Unterkunft. Saubande, elendigliche!“
Die Bairischen. Schon wieder.
Johannes schüttelte sich beim Gedanken an sie. Er war froh, in Enns nichts von den Unruhen zwischen Katholischen und Protestanten mitbekommen zu haben. Offenbar war der Ausbruch der Pest für die Bürger ein größeres Übel als die Händel zwischen den beiden einander feindlich gesonnenen Lagern.
Einige Tage später wagte sich Johannes zum Schloss, da er das Lager der Soldaten nicht finden konnte, von dem die Köhler gesprochen hatten. Er wollte wissen, ob seine Schwester unter dem Gefolge der Männer war. Die Schlosswache hörte sich sein Anliegen an, schüttelte dann aber den Kopf.
„Hier sind keine Weiberleute, such sie woanders.“
„Und wo?“, beharrte Johannes auf einer Auskunft.
Die Wache lachte schallend.
„In einem der Hurenhäuser, nehme ich an.“
„Hurenhäuser?“
Sein Gegenüber zuckte die Schultern und spuckte ihm dann vor die Füße.
„Da haben die Weiber zumindest ein Auskommen. Mehr braucht es für die nicht.“
Johannes zog die Schultern hoch. Elisabeth!
Unverrichteter Dinge und voller Angst um seine Schwester fragte er in drei Hurenhäusern nach ihr. Aber niemand schien sie zu kennen oder wollte ihm eine Auskunft über sie geben. Schließlich hoffte er mehr als er glaubte, dass sie nicht gezwungen worden war, diesem Gewerbe nachzugehen.
Bei allen Botengängen und jeder Lieferung seines Dienstherren schaute er sich weiterhin genau um. Er konnte aber weder von den Linzer Bürgern noch in den Kneipen der Stadt etwas über die mitziehenden Frauen der Soldaten in Erfahrung bringen.
Marketenderinnen? Trossfrauen? Huren?
Für sie waren es allesamt liederliche Weiber, um die sich niemand weiter scherte.
An einem Samstagvormittag traf er sich in der Nähe des Kirchhofs mit einer Frau, die offenbar mit den Bairischen zusammen nach Linz gekommen war und der er einen Kindersarg überreichen sollte. Ihr Bub war an einer Lungenentzündung gestorben, hatte sie Meister Wilhelm erzählt. Jetzt stand sie mit verheultem Gesicht und dem in weiße Tücher gewickelten Leichnam ihres Kindes vor der Friedhofsmauer und wartete auf ihre Bestellung.
Vorsichtig legte sie das Bündel in den kleinen Sarg und strich zärtlich über die blassen Wangen ihres toten Sohnes. Sie gab Johannes die vereinbarten Münzen, nachdem er vorsichtig den Deckel geschlossen hatte, dann wischte sie sich mit einem Tuch über ihr verweintes Gesicht und machte sich auf den Weg zur Grabstelle für ihr Kind. Obwohl sie dem Aussehen nach eines der Weiber aus dem Umfeld eines Trupps Soldaten sein musste, das seiner Meinung nach kaum wissen konnte, von wem sie das Balg hatte, schien sie seinen Tod zutiefst zu betrauern. Es war eben doch ihr Kind.
Johannes hatte sich nicht getraut, die Frau in ihrem Jammer nach seiner Schwester zu fragen, und trottete missgelaunt zur Werkstatt des Schreiners zurück. Der schickte ihn jedoch gleich wieder los, die Frau zu suchen. Er wusste, wie wichtig dem Jungen war, etwas über seine Schwester in Erfahrung zu bringen, und ermutigte ihn mit eindringlichen Worten, nicht aufzugeben.
„Wenn du niemanden fragst, findest du sie nie“, sagte er.
Johannes’ anschließende Suche nach der Frau blieb jedoch erfolglos. Wahrscheinlich hatte sie die Stadt verlassen, nachdem ihr Kind irgendwo bei der Friedhofsmauer verscharrt worden war. Es gab nur eine Möglichkeit, etwas über seine Schwester oder den Wohnort seiner Tante zu erfahren: Er musste unbedingt herausfinden, wo sich Bruder Anselm aufhielt. Vielleicht konnte ihm Johannes Kepler weiterhelfen. Aber der war für ihn in unerreichbare Ferne gerückt. Johannes würde es im neuen Jahr noch einmal bei ihm versuchen.