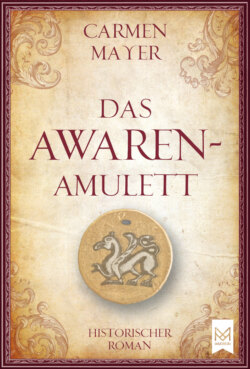Читать книгу Das Awaren-Amulett - Carmen Mayer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеJohannes rieb sich fröstelnd Arme und Beine und hoffte, dass sie auf diese Weise wieder warm würden. Aber die Kälte war tief in ihn hineingekrochen und saß so fest, dass seine Zähne klapperten. Er schüttelte die Gedanken an das Vergangene ab. Das war ein für alle Mal verloren. Er würde nichts davon zurückholen können.
Seine Erinnerungen stimmten ihn unendlich traurig. Doch noch weitere Gedanken quälten ihn.
Wenn er in der Mühle geblieben wäre …
Vielleicht hätte er das Unglück verhindern können.
Vielleicht wäre er jetzt tot wie die anderen.
Er war hier.
Er hatte sie im Stich gelassen.
Er war ein elender Feigling.
Noch einmal ging er zum Höhleneingang, versuchte, das feuchtkalte Weiß davor mit allen Sinnen zu durchdringen – vergebens. Nur das Tropfen von den Bäumen war zu hören, deren Kronen bis zum Eingang der Höhle heraufragten, sonst nichts.
Als er nach einem mühsamen Abstieg den schmalen, steinigen Weg erreicht hatte, der entweder nach rechts den Berg hinauf zur Hütte eines Einsiedlers oder nach links talwärts zur Mühle führte, zauderte er einen Augenblick, welche Richtung er einschlagen sollte. Nach unten zur Mühle oder nach oben zur Hütte?
Was auch immer sein Verstand ihm einzuflüstern versuchte: Etwas zwang ihn, sich nach links zu wenden und bergab zu laufen. Er glaubte, das Klappern des Mühlrades zu hören, und blieb mehr als einmal lauschend stehen, weil er Stimmen zu vernehmen meinte.
Es war jedoch weder jemand zu sehen noch deutlich zu hören.
Aber es war noch immer etwas zu riechen.
Es roch nach verkohltem, feucht gewordenem Holz.Nach kaltem Rauch. Nach …
Tränen stiegen ihm in die Augen, liefen die blassen Wangen hinunter. Seine Beine bewegten sich mechanisch. Er spürte weder die Steine unter den dünnen Sohlen noch kümmerte er sich darum, dass er mehrmals rutschte und fast gefallen wäre. Je näher er der Mühle kam, umso deutlicher drang ihm der unverkennbare Geruch in die Nase, der ihm sagte, was er vorfinden würde.
Da war die Weggabelung. Der Fußweg traf in spitzem Winkel auf einen Ochsenweg, und genau gegenüber begann das Anwesen der Nachbarn.
Johannes verharrte einen Augenblick lauschend, konnte aber nichts mehr hören. Kein Klappern. Keine Stimmen.
Der Nebelschleier hatte sich etwas gehoben und gab den Blick frei auf das Nachbargrundstück. Der Junge erstarrte. Das verkohlte Gebäude sah aus wie das vermodernde Gerippe eines verendeten Tieres. Der Zaun, der das Grundstück zum Weg hin begrenzt hatte, grinste ihn an wie eine lückenhafte Zahnreihe.
Johannes lief weiter wie in Trance, erreichte das schief in den Angeln hängende Tor zum Anwesen der Mühle und sah im selben Augenblick, dass es sie nicht mehr gab. Man hatte Feuer gelegt, das Mehl war explodiert, hatte die Mauern gesprengt, die Steine ringsum verstreut, das Holz bersten lassen.
Der laute Knall vom gestrigen Abend.
Das Klappern, das ihn den Weg herunter begleitet hatte, kam von lose hängenden Balken, die sich hin und wieder im Wind bewegten.
Er stand reglos da und nahm nur schemenhaft in sich auf, was der Nebel ihn sehen ließ. Aber es reichte, um ihn wie einen Blinden taumelnd den Weg zurücklaufen zu lassen, den er zuvor gekommen war.
Johannes erreichte die Hütte des Einsiedlers, ohne richtig zu wissen, wie. Anselm war nicht da, das konnte er sofort sehen, weil der Laden vor dem einzigen Fenster lag und kein Rauch aus dem kleinen Schornstein quoll. Da der Mönch öfter für einige Zeit verschwand, war das an und für sich nichts Außergewöhnliches.
Sein Instinkt ließ Johannes jedoch zunächst einen Bogen um die Hütte schlagen und den Felsenkeller suchen, in dem Bruder Anselms Vorräte sein mussten. Ja, er hatte auch Hunger. Aber mehr noch als das hatte er Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er panische Angst. Deshalb wagte er auch nicht, in der Hütte zu übernachten, wo sie ihn sehr schnell fänden, wenn sie nach ihm suchen sollten.
Er verkroch sich in Anselms Vorratskeller, ohne die bereithängende Laterne anzuzünden. Dort verharrte er lange Zeit beinahe regungslos, bis er sicher sein konnte, dass niemand ihm gefolgt war. Dann erst begann er, vorsichtig tastend nach etwas Essbarem zu suchen.
Was er fand, hätte für längere Zeit ausgereicht, aber er konnte keinen Bissen hinunterkriegen.
So lehnte er sich gegen die gepolsterte, mit Rupfensäcken verhängte Steinwand und heulte hemmungslos.
Nach einer endlos scheinenden Zeit drückte er vorsichtig die Luke auf, die sein Versteck nach oben abschloss, und warf einen prüfenden Blick hinaus. Es dämmerte bereits. Der Nebel hatte sich verzogen. Der Wind war stärker geworden und trieb kalten Regen fast waagerecht vor sich her.
Aufmerksam beobachtete er die Hütte des Einsiedlers und die Umgebung bis zum Waldrand, bevor er sich aus seinem Unterschlupf herauswagte. Der Boden war aufgeweicht, aber er konnte keinerlei Spuren entdecken, die darauf hingewiesen hätten, dass sich in der Nacht jemand hier herumgetrieben hatte. So schlich er sich zur Hüttentür, lauschte angestrengt und öffnete sie dann vorsichtig.
Das Innere sah verlassen aus. Die hölzernen Borde befanden sich noch an der Wand, Anselms Bücher jedoch fehlten. Die Feuerstelle war unversehrt aber kalt, Kessel und Pfannen hingen sauber gescheuert an der Wand. Tisch, Hocker und die Bettstatt des Einsiedlers waren leer, der Fußboden war gefegt. Es sah ganz so aus, als warte die Einsiedelei auf einen neuen Bewohner, nicht auf die sonst übliche Rückkehr des alten Mönchs nach einer längeren Reise.
Johannes lehnte sich erschöpft an die Wand und überlegte, weshalb Bruder Anselm sie bei seinem Weggehen dieses Mal so gründlich aufgeräumt, den Felsenkeller aber gelassen hatte, wie er war. Es schien ihm viel wichtiger gewesen zu sein, zerlesene Bücher und ein paar Tiegel mit Salben und Heiltinkturen mitzunehmen.
Nichts davon hatte er zurückgelassen. Nicht das kleinste Krümelchen zerstoßener Kräuter, kein Schmalz, keine Tinktur. Bruder Anselms größter Schatz war zusammen mit ihm und der Ledertasche verschwunden, die er nie aus der Hand gab.
Was mochte das bedeuten?
Johannes verließ die Hütte und warf noch einen Blick in das Gärtlein, auf das Bruder Anselm immer so stolz gewesen war. Es war sorgfältig umgegraben worden und zeigte dem Jungen, dass der Mönch keinesfalls in Eile aufgebrochen war, sondern seinen Auszug sorgfältig vorbereitet hatte. Im Gegensatz zu vergangenen Zeiten schien sein Weggehen dieses Mal für längere Zeit geplant gewesen zu sein. Oder tatsächlich für immer.
Aber wohin war er gegangen?
Warum hatte er nichts davon gesagt?
Johannes hatte ihn doch selber erst wenige Zeit zuvor verlassen, um in der Winterpause dem Vater zur Hand zu gehen. Da hätte der Mönch doch etwas verlauten lassen können.
Er verstand es nicht.
Im strömenden Regen machte sich Johannes schließlich erneut auf den Weg talwärts. Das Tosen des Gebirgsbaches und das Rauschen des Regens übertönten jedes weitere Geräusch. Johannes glaubte, dazwischen immer wieder die johlenden Stimmen und das heisere Lachen der Kerle zu hören, die in zerstörerischer Wut Gegenwart und Zukunft seiner Familie und der Nachbarn in Schutt und Asche gelegt hatten.
Schließlich nahm er seinen ganzen Mut zusammen und kletterte über die rutschig gewordenen Trümmer der ehemaligen Mühle, die bis auf den Weg verstreut lagen.
Das Mühlrad schien sich hilflos an einen Mauerstumpf zu krallen und ragte zur Hälfte in das tosende Wasser des Baches. Lange würde es nicht mehr halten und mitgerissen werden. Johannes erinnerte sich daran, wie stolz der Vater erst vor wenigen Wochen noch darauf gewesen war, die arg mitgenommenen Schaufeln wieder instand setzen und das Mahlwerk damit antreiben zu können.
Zwischen Steinbrocken und dampfendem Holz fand er ein paar Scherben von Mutters Geschirr und die verkohlten Reste der einfachen Möbel, die sich im Haus befunden hatten.
Ob die Mordbrenner wussten, was geschieht, wenn Mehl Feuer fängt?
Der Vater hatte einige Tage zuvor einen Teil des Mehls nach Hieflau zu den Bauern gebracht. So war nicht allzu viel davon in der Mühle geblieben, aber doch genug, um durch die Wucht der Explosion alles zu vernichten, was sich in unmittelbarer Nähe befand.
Aber wo war seine Familie?
Der Junge hoffte, dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. Seine Nase sagte ihm jedoch etwas anderes. Johannes legte seinen Arm vors Gesicht, um den schrecklich stinkenden Rauch nicht einatmen zu müssen, der an einigen Stellen immer noch aus den Trümmern kroch und sich über die Ruine gelegt hatte.
Was er die ganze Zeit über gewusst, aber nicht an sich herankommen hatte lassen, wurde zur grausamen Gewissheit. Denn plötzlich entdeckte der Junge eine verkohlte Hand, die zwischen ein paar zerborstenen Mauerresten herausragte. Entsetzt schrie er auf, räumte fieberhaft mit bloßen Händen Asche und Steine zur Seite.
Die Hand gehörte seiner Mutter. Anna. Ihre Leiche lag dort, wo sich gestern noch ihre Schlafstatt befunden hatte. Entsetzt sank er auf die Knie und vergrub das Gesicht in den von Ruß und Asche geschwärzten, aufgeschundenen Händen. Ein verzweifelter Schrei löste sich aus seiner Kehle.
„Mutter!“
Es gab weder eine Schaufel noch sonst etwas, womit er ein Grab für Anna ausheben konnte. Außerdem befürchtete er, ihre Überreste würden auseinanderfallen, sobald er sie berührte. Also begann er langsam, den Leichnam an Ort und Stelle wieder mit Steinen zu bedecken, und seine Mutter ihrem Frieden zu überlassen. Plötzlich aber stutzte er. Unter den verbrannten Resten ihres Gewandes entdeckte er etwas, das wie eine Münze aussah, die er niemals zuvor gesehen hatte. Sie war mit einer verkohlten Kruste und Asche überzogen. Auch die Männer, die Haus und Hof niedergebrannt und seine Mutter umgebracht hatten, schienen nichts von dem Kleinod bemerkt zu haben. Sie hätten es ihr sonst grob vom Hals gerissen.
Johannes schaute sich nachdenklich um.
Es gab doch nichts zu holen bei ihnen! Oder bei den Nachbarn! Nichts, wofür es sich lohnte, Menschen umzubringen, ihr Heim zu brandschatzen. Was waren das nur für Kreaturen, die so etwas taten?
Er schaute wieder auf die Überreste seiner Mutter hinunter, hätte sie so gerne ein letztes Mal umarmt. Jetzt war sie nur noch ein verbrannter Haufen Fleisch, der übel stank und nichts mehr mit der Frau zu tun hatte, die sie einmal gewesen war.
Zunächst wollte Johannes der Toten lassen, was ihr im Leben so wichtig gewesen war, dass sie es vor den Augen anderer verborgen gehalten hatte. Dann aber fiel ihm ein, dass er weder Geld noch sonstige Mittel besaß, mit denen er die nächste Zeit überleben konnte. Verkaufen würde er Mühle und Grund auch nicht können, da sich der Vater mit dem Wiederaufbau verschuldet hatte, und Grund und Boden ohnehin dem Stift gehörten. Die Münze würde er vielleicht verkaufen und mit dem Geld überleben können, wenn er Glück hatte. Allerdings wusste er auch, dass er dazu sehr viel Glück brauchte.
Johannes war auf einem verrußten Balken zusammengesunken und starrte vor sich hin. Er zürnte Bruder Anselm, der seine Hütte ohne Abschied verlassen und ihm somit die Möglichkeit genommen hatte, wenigstens vorübergehend Unterschlupf zu finden. Und Trost.
Ob Anselm etwas von den bevorstehenden Gräueltaten gewusst und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte?
Er war ein Verräter. Ein gottverdammter katholischer Verräter!
*
Bruder Anselm lebte seit vielen Jahren als Einsiedler weit oben im Tälchen, dort, wo der Bach nur ein kleines, unruhig hüpfendes Quellbächlein war. Er hatte vor Zeiten die Hütte eines anderen Mönchs bezogen, als dieser in einem der kalten Winter gestorben war.
Als Johannes eines Abends aus einem der Holzschläge nach Hause kam, in denen er gearbeitet hatte, teilten ihm seine Eltern mit, dass ihn der Mönch in die Lehre nehmen würde.
Johannes war sprachlos. Auf diese Nachricht war er vollkommen unvorbereitet gewesen.
„Ich soll bei Bruder Anselm in die Lehre gehen? Was soll mir denn der Alte beibringen?“, fragte er aufgebracht. „Das Beten vielleicht? Habt ihr vergessen, dass er einer von denen ist? Ein Katholischer?“
Johannes sah Hilfe suchend zum Vater hinüber.
„Bruder Anselm ist ein besonderer Freund unserer Familie, Johannes, und wir wollen, dass du alles lernst, was er dir beibringen kann. Es gibt keinen Lehrer mehr für uns Protestantische, seit sich der Herr Prädikant aus dem Staub gemacht hat. Du hast deshalb gerade mal zwei Jahre lang die Schulbank gedrückt. Bruder Anselm ist der Beste, den wir uns für dich vorstellen können.“
„Ich bin viel zu alt für die Schule!“, entrüstete sich Johannes und schaute von seiner Mutter zum Vater. „Ich nütze der Familie doch weitaus mehr, wenn ich mit Vater im Holzschlag arbeite.“
Aber der machte keine Anstalten, sich mit seinem Sohn weiter über dieses Thema auseinanderzusetzen, und die Mutter schien mit dem Plan einverstanden zu sein. So wagte er nur noch einen kleinen Einwand.
„Ich kann doch schon ganz gut rechnen“, begann er vorsichtig und zählte seine inzwischen sechzehn Lenze über die Finger ab.
„Und was noch?“, fragte der Vater barsch.
„Alles, was du mir beigebracht hast, Vater“, versuchte es der Junge vorsichtig weiter.
„Du gehst zu ihm“, antwortete der Vater bestimmt. „Ich dulde keinen Widerspruch.“
Der Gedanke, von einem Katholischen etwas lernen zu müssen, das so gar nicht in seine protestantische Welt passen wollte, schien Johannes ungeheuerlich. Mochte er den Einsiedler noch so wertschätzen und mögen – das hier war etwas völlig anderes.
„Wann soll ich denn gehen?“, fragte er vorsichtig einlenkend, als er sah, dass Widerspruch keinen Sinn hatte.
„Nach Pfingsten.“
„Nach Pfingsten? Im Mai? Vor dem Sommer? Ich dachte … Sollte ich nicht …“
Sein Vater fasste ihn fest an den Schultern. Sein Blick ließ den Jungen verstummen.
„Nach Pfingsten“, wiederholte er.
So packte Johannes Mitte Mai des Jahres 1622 sein Bündel und verließ das elterliche Haus.
Von Elisabeth verabschiedete er sich, als er sie beim Hühnerfüttern traf. Er zog sie neckend an den Zöpfen, dass sie ihn verärgert wegstieß.
„Ich bin froh, dass du endlich gehst“, rief sie und schlug mit der flachen Hand auf seine Brust. Dann drehte sie sich um und lief davon, um sich hinter dem Haus auszuheulen.
„Mach’ dir keine Sorgen, Johannes“, sagte die Mutter zum Abschied. „Vater wird zum Frühsommer seine Arbeit im Holzschlag aufgeben und hierbleiben. Die Bauern haben gesagt, dass sie wieder einen Müller haben wollen. Deshalb werden wir die Mühle herrichten und versuchen, den Betrieb deines Großvaters wieder aufzunehmen. Wir haben gestern die Erlaubnis des Pflegers aus Admont bekommen, der für das Tälchen zuständig ist.“
„Ist das wahr?“ Johannes schaute seine Mutter überrascht an. Dann kam ihm der scheinbar rettende Gedanke. „Braucht Vater denn keinen starken Burschen, der ihm dabei behilflich ist?“
„Doch, den braucht er. Du kannst im Spätherbst wieder herkommen und ihm zur Hand gehen – du bist ja nur eine Wegstunde von uns entfernt.“ Sie küsste ihn auf die Stirn.
Johannes ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Einerseits wusste er jetzt, warum seine Eltern sich für diesen Zeitpunkt entschieden hatten, um ihn in die Obhut des Mönchs zu geben: Über den Sommer gab es keine Arbeit für ihn, wenn er nicht gerade die Ziegen der Nachbarn hüten wollte. Im Holzschlag brauchte man ihn über die Sommerzeit auch nicht.
Andererseits haderte er mit seinem Schicksal. Ein Lutherischer, der bei einem katholischen Mönch in die Schule ging! Was wollte ihm der denn beibringen, das ihnen allen nützlich sein konnte? Beten vielleicht? Psalmen herunterleiern? Eine ungeheuerliche Vorstellung.
Aber er musste sich der Entscheidung seiner Eltern fügen, auch wenn er sie nicht verstand.
Johannes wusste, am meisten würde er Elisabeth vermissen – und mit Sicherheit auch ein wenig die Mutter.
Er war heilfroh, dass der Vater zu Hause war.
*
Das, was Bruder Anselm als sein Zuhause bezeichnete, bestand aus einer alten, vom Wetter silberblank gegerbten Holzhütte, die der Mönch sehr sorgfältig in Ordnung hielt. Johannes konnte die neu eingefügten Hölzer erkennen, die der Einsiedler im Laufe der Jahre gegen brüchig gewordene ausgetauscht hatte. Sie waren allesamt roh belassen, nur die Rinde war entfernt worden. In die Fugen hatte Bruder Anselm Moos und Erde gestopft, und dann sauber mit einem dunklen Brei unbestimmter Zusammensetzung zugeschmiert.
Es war also nicht so, dass der Alte sich nur mit geistigen Dingen beschäftigte. Er war offenbar auch handwerklich begabt und kannte sich mit weitaus mehr aus, als Johannes geglaubt hatte.
In der Hütte gab es einen einzigen Raum mit zwei Strohlagern, die neu aufgeschüttet und mit frischem Tuch bezogen worden waren. An der Wand gegenüber dem Eingang befanden sich Borde mit etlichen Büchern, die reichlich mitgenommen aussahen. Einige größere und kleinere Töpfe und Pfannen hingen sauber geputzt und aufgereiht an der Wand neben dem Herd, über dem eine grob geschmiedete Esse den Rauch ins Freie abführte. Daneben stand ein Tisch mit drei Hockern. Ein Holzverschlag diente als Schrank, in dem der Einsiedler seine paar Habseligkeiten aufbewahrte. Ein weiteres Bord war vollgestellt mit tönernen Trinkbechern und Krügen, Tellern, Schüsseln, verkorkten Flaschen und etlichen Tiegeln.
Bruder Anselm hieß seinen Schüler, sich zu setzen, nachdem er ihn freudig begrüßt hatte. Zuerst briet er für sich und den Jungen zwei dicke Streifen Speck und ein paar Eier in einer Pfanne, die er zusammen mit einem halben Laib Brot und einem Topf dampfender Gemüsesuppe auf den Tisch stellte. Dann sprach er einen Segen, und legte Johannes die Hälfte des Speckgerichtes auf ein Holzbrett. Ein erstaunlich üppiges Mahl für einen Einsiedler.
„Mein letzter Speckvorrat“, sagte Anselm schmunzelnd, als er Johannes’ erstaunten Blick sah. „Hat mir ein Bauer gegeben, dessen Frau ich behandelt habe. Hatte sich bei einem bösen Sturz die Schulter ausgerenkt und eine Rippe gebrochen. Nimm dir von der Suppe, so viel du magst.“
Sie tranken Wasser aus einem Krug, den die Mutter Bruder Anselm einmal mitgegeben hatte. Er brachte dem Jungen plötzlich in Erinnerung, dass er zum ersten Mal in seinem Leben für längere Zeit nicht unter dem Dach seiner Eltern nächtigen würde. Überrascht stellte er fest, dass ihn nur der Gedanke an Elisabeth und ihr Wohlergehen beunruhigte. Um die Eltern war ihm nicht bang.
In den kommenden Wochen lernte der Junge neben den praktischen Dingen, die der Mönch ihm zeigte und die vom Brotbacken in einem aus groben Feldsteinen sorgfältig errichteten kleinen Backhaus über das Zubereiten von einfachen Mahlzeiten reichten, auch flüssig und fehlerfrei zu lesen und zu schreiben. Dazu bediente sich der Einsiedler seiner zerlesenen Bücher und eines Stücks Schiefer, auf das Johannes mit ungelenker Hand Buchstabe für Buchstabe kritzelte, bis er schließlich mühelos kurze Passagen aus der Bibel lesen und abschreiben konnte.
Ganz anders als Jeremias Mitterer, der ehemalige Lehrer und Prädikant unten im Dorf, legte der Mönch viel Wert auf eine saubere Schreibweise, und ließ seinem Schüler nicht den kleinsten Fehler durch.
Nebenbei lernte Johannes noch Latein, da der Mönch selbstverständlich nicht die übersetzte Bibel der Lutheraner, sondern die einzige von der katholischen Kirche autorisierte Version in der lateinischen Fassung besaß.
Bruder Anselm freute sich insgeheim darüber, wie leicht seinem Schüler das Lernen fiel, womit sich seine lange gehegten Vermutungen in dieser Richtung vollkommen bestätigten.
*
Der Blick des Jungen fiel wieder auf den golden schimmernden Anhänger seiner Mutter. Ihrem Grab oder gar Leuten etwas zu überlassen, die heraufkommen und die Ruine nach Brauchbarem durchsuchen würden, erschien ihm noch unwürdiger, als das Schmuckstück mitzunehmen und später zu entscheiden, was damit geschehen sollte.
„Verzeih mir, Mutter“, flüsterte er in Tränen aufgelöst und nahm ihr die Münze vorsichtig ab. Sie musste an einem Stoffband befestigt gewesen sein, das sich in die Haut eingebrannt hatte, wie auch die Münze selber, die er nur mit Mühe von der verkohlten Haut lösen konnte. Vermutlich hatte die Mutter sie als Amulett benützt, um sich vor Unheil zu schützen, wie das manche Menschen hin und wieder machten, mutmaßte der Junge. Dann hatte sie ihr allerdings wenig genützt.
Johannes setzte sich mit dem seltsamen Schmuckstück in der Hand mitten in die Reste dessen, was einmal sein Heim gewesen war, und starrte wieder vor sich hin. Die Welt stürzte über ihm zusammen. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft, auf der Hut vor denen zu sein, die das alles angerichtet hatten und sich womöglich noch in der Nähe befanden. Im Gegenteil. Scham überfiel ihn, nicht mit seiner Familie unter den Trümmern begraben zu liegen.
Er nestelte die Münze an eine Schnur, die seiner Hose Halt gab, und verbarg beides unter seinem Hemd.
Nachdem Johannes Stein auf Stein über der Toten aufgeschichtet hatte, suchte er die Ruine nach den Leichen seines Vaters und seiner Schwester ab, fand aber nur einen toten Körper, den er als den des Vaters erkannte. Den hatten die Schurken an einem Balken im Stall aufgeknüpft, mit dem er abgestürzt war, als das Gebäude zusammenfiel. Reste des Strickes hatte er noch um den Hals, als Johannes ihn unter den Trümmern fand. Auch über seinem Leichnam konnte er mangels Schaufel und Hacke nur einen Hügel aus jenen Steinen errichten, die einstmals das Fundament zum Stall einer meckernden Ziege und einer Schar gackernder Hühner gewesen waren.
Hühner.
Elisabeths Lieblinge.
Johannes erstarrte.
Wo war die Leiche seiner Schwester?
Er suchte alles ab, räumte Steine zur Seite, grub mit bloßen Händen in der Asche, konnte sie jedoch nirgends finden.
Hatten die Mörder seiner Eltern das Mädchen mitgenommen?
Er ahnte, was dann mit ihr geschehen sein mochte, und kotzte sich bei den Bildern in seinem Kopf beinahe die Seele aus dem Leib.
Warum nur waren sie nicht alle geflohen, als noch Zeit dazu war? Warum hatten sie ihn einen dummen Jungen genannt, als er sie vor dem Haufen verkommener Kreaturen warnte, die er Tage zuvor bereits im Holz auszumachen geglaubt hatte?
So etwas gebe es nicht, beschied man ihn. Nie hatte man von umherziehenden Mordbrennern im Ennstal oder hier im Tälchen gehört. Räubergeschichten seien das, nichts sonst. Sie glaubten nicht, dass jemand das kleine Seitental der Enns und seine Bewohner für so interessant halten könnte, dass man es überfiel. Jeder wusste, dass es bei den wenigen Bewohnern nichts zu holen gab, also würden sich marodierende Banden nicht hierher verirren.
Man wusste auch von bairischen Soldaten, die auf der Suche nach ketzerischen Protestanten waren und die unter dem Schutz des Statthalters Adam Graf von Herberstorff hin und wieder plündernd durch das Land ob der Enns zogen. Aber hier im Ennstal wähnte man sich vor ihnen sicher. In diese unwegsame Gegend würden sie nicht kommen. Außerdem stünde das Stift Admont wie ein Schutzschild vor dem Gesäuse, hatte man ihm gesagt.
Hatte das nicht auch ihr ehemaliger Prädikant Jeremias Mitterer behauptet? Und war er dann nicht über Nacht abgehauen und hatte seine kleine Gemeinde im Stich gelassen?
Die erhoffte Sicherheit war ein tödlicher Irrtum gewesen.
Als Johannes aus Admont zurückgekommen war, wohin man ihn zum Bezahlen der fälligen Abgaben geschickt hatte, stand die Mühle seiner Eltern bereits in Flammen. Rauch und Nebel hatten vor dem Jungen verhüllt, was die Mordbrenner angerichtet hatten. Aus Nebel und Rauchschwaden hatte er die Meute brüllen und lachen gehört. Ihm war nur die Flucht in seine Höhle geblieben mit dem Wenigen, das er dabeihatte.
Zitternd vor Angst um seine Schwester durchsuchte er noch einmal alles so gründlich es eben ging, stieß jeden verkohlten Balken zur Seite, kroch unter eingestürzte Mauerreste. Aber er fand weder sie noch ihren Leichnam. Schließlich wagte der Junge es sogar, in der Asche des Nachbaranwesens zu stöbern, fand dort aber lediglich die teilweise bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen der ehemaligen Bewohner. Er hatte keine Kraft mehr, sie auch noch unter Steinen zu begraben, und überließ ihre sterblichen Überreste dem Schicksal.
In Johannes glomm ein Funke Hoffnung bei dem plötzlichen Gedanken auf, Jakob habe sich und das Mädchen in Sicherheit gebracht. Immerhin wusste er, wie gern der Freund seine Schwester gehabt hatte. Der hätte trotz seiner grobschlächtigen Art niemals zugelassen, dass ihr ein Leid geschah. Wobei ihn die Zweifel wie Fieber schüttelten, nachdem er die im Feuer teilweise auf Kleinkindgröße zusammengeschrumpelten Körper seiner Nachbarn gesehen hatte. Man hatte sie allem Anschein nach ins Haus getrieben, in dem sie schließlich verbrannten.
Unmöglich sie auszugraben, herauszufinden, ob es sich bei allen Leichen um seine Nachbarn handelte. Er hatte nicht die geringste Ahnung, wie viele auf dem Anwesen waren, als die meuchelnde Bande über sie herfiel, konnte nur ahnen, welches Schicksal sie erleiden mussten, hoffte, dass sie ein schnelles Ende gefunden hatten. Seine Schwester konnte durchaus unter den Toten sein. Vielleicht hatte sie Hilfe holen oder sich bei den Nachbarn verstecken wollen.
Es war sinnlos, weiter nach ihr zu suchen.
Johannes stolperte schließlich zum Bach hinunter, um ein wenig Wasser zu trinken und seine wunde Kehle zu beruhigen. Laut heulend sank er zwischen Steinen und Morast nieder, und fühlte nur noch Schmerz und Verzweiflung.
Warum taten Menschen so etwas?
Er konnte nicht ahnen, dass er im Laufe der Zeit immer wieder mit solchen Bildern konfrontiert sein würde. Europa stand mitten in den Wirren eines großen Krieges, von dessen Ausmaß sich in jenen Tagen niemand ein Bild zu machen imstande war.
Kurz vor Einbruch der Dämmerung hatte er sich wieder einigermaßen gefasst. Mit den Händen schöpfte Johannes noch einmal das eiskalte Wasser des Baches und trank davon. Dann reinigte er Gesicht und Hände und überlegte, was er weiter tun sollte. Dabei steckte er die klammen Finger in seine Jackentasche, und spürte durch den dünnen Stoff das Amulett, das einmal seiner Mutter gehört und das er an seiner Hosenschnur befestigt hatte. Er musste es erst gründlich von der schwarzen Kruste reinigen, mit der es überzogen war. Johannes wusste, dass er nicht nur verbrannten Stoff von dem Kleinod wusch. Tapfer schluckte er das Würgen in seinem Hals hinunter.
Er hatte nie so genau darauf geachtet, was Anna trug. Ein Goldstück wie das, welches er jetzt in der Hand hielt, wäre ihm aber sicherlich aufgefallen, hätte sie es offen getragen. Es war ihm ein Rätsel, woher eine so einfache Frau wie seine Mutter ein so wertvolles Stück haben sollte. Warum hatte sie es nicht verkauft und damit ihre spärlichen Einnahmen aufgebessert? Hatte sie die seltsame Münze tatsächlich als Schutz vor Unheil getragen?
Er fror vor Erschöpfung und Grauen, und da er außer ein paar Schlucken Wasser nichts zu sich genommen hatte, fühlte er sich nur noch matt und zerschlagen.
Johannes beschloss, aus der Nähe des ehemaligen Mühlhäusler-Anwesens zu verschwinden, und sich am nächsten Morgen Gedanken darüber zu machen, was weiter zu tun sei.
Der Hunger trieb ihn zunächst wieder bergwärts zur Hütte des Einsiedlers. Dabei waren alle seine Sinne aufs Höchste angespannt, da er nicht sicher sein konnte, dass die Bande das Tälchen tatsächlich wieder verlassen hatte. Während er am gestrigen Tag aus Richtung Admont gekommen war, mussten sie an der Enns entlang aus Richtung Hieflau heraufgezogen sein, sonst wäre er ihnen begegnet. Oder sie waren vor ihm flussabwärts gezogen und dann in das Tälchen eingedrungen. Oder sie kamen aus dem Süden über die Berge, wohin sie auch wieder verschwanden.
Die Spuren, die sie zurückgelassen hatten, ließen nicht erkennen, woher sie gekommen und wohin sie gezogen waren, nachdem sie ihr unheilvolles Werk vollendet hatten.
Die Hütte des Einsiedlers war immer noch unversehrt, stellte er erleichtert fest, als er sie keuchend erreichte. Also waren sie bestimmt nicht bergauf gezogen oder von dort gekommen, sonst hätten sie sich hier vermutlich noch einmal ausgetobt. Oder aber sie waren hier durchgekommen und hatten die Einsiedelei eines katholischen Mönchs nicht antasten wollen. Oder …
Der Junge erstarrte bei dem Gedanken daran, dass sie Bruder Anselm mitgenommen haben könnten, wenn nicht gar noch Schlimmeres, dass er nämlich mit ihnen kollaboriert hatte. Dagegen aber sprach, wie ordentlich er seine Behausung verlassen hatte.
Zu viele ungelöste Rätsel, zu viele wirre Gedanken kreisten durch seinen Kopf und ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.
Johannes wagte nicht, Holz zu sammeln und Feuer anzuzünden oder sich länger als unbedingt notwendig in der Hütte aufzuhalten. Eine Nacht blieb er, schlief endlich einen erschöpften Schlaf auf seiner alten Lagerstatt, aus der er immer wieder auffuhr, weil er ein beunruhigendes Geräusch zu hören glaubte.