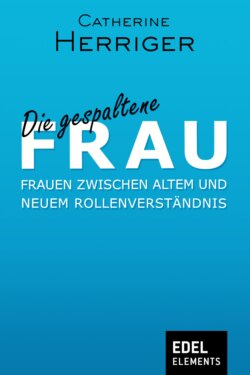Читать книгу Die gespaltene Frau - Catherine Herriger - Страница 4
Frauen –
und die patriarchalische Rollenteilung
Оглавление»Ich weiß, daß ich einem Kind nicht die nötige Zeit und Zuwendung geben könnte – deshalb bleibe ich kinderlos.« Ein Ausspruch, den gerade karriereorientierte Frauen immer wieder machen. Ein Ausspruch, der natürlich zu denken gibt. Basiert er nur auf Egoismus oder auf Verantwortlichkeit? Wie sieht es denn vergleichsweise beim Mann aus? Würde ein Mann, der ›sowieso‹ zielbewußt Karriere machen will, ähnlich denken? Die Erfahrung zeigt: Männer, die noch im tradierten Rollenverständnis ticken, fühlen sich auf ganz natürliche Art weniger bis gar nicht zuständig für die frühe Nestpflege. Sie sehen sich eher als finanzielle Versorger der Familie und nennen dieses Familiensystem Rollenteilung … Frau zu Hause, zuständig für die kleinen Kinder – Mann nicht zu Hause, zuständig für das materielle Auskommen der Familie.
Ein trügerisches System, wie inzwischen die zunehmende Verwahrlosung der Wohlstandsgesellschaft zeigt, die sich in ständig ansteigenden und erschreckenden Ziffern von Drogengeschädigten, jungen Rechtsextremisten und Terroristen, Sektenzugewandten, jugendlichen Kriminellen und weiteren sozialen Auffälligkeiten niederschlägt. Die Zeiten sind längst passé, in denen man selbstgefällig den Kopf über solche Mißstände schütteln konnte in der Meinung, die Wurzeln dieser gesellschaftlichen Übel lägen ausschließlich in der sozialen Misere und Unkenntnis irgendwelcher Randgruppen.
Der Versuch, diese sozialen Mißstände einer vermehrten ›Haus- und Familienflucht‹ der Ehefrau und Mutter zuzuschieben, ist unsinnig! Denn gerade Kinder aus dem gehobenen Mittelstand und der Oberschicht haben meist die Mutter zu Hause, da der materielle Lebensstandard mehr als zur Genüge vom Vater abgedeckt wird. Es könnte ja dem gesellschaftlichen Ansehen des Mannes abträglich sein, wenn die Meinung entstehen würde, seine Frau ›müßte‹ arbeiten … karitative und soziale Engagements natürlich ausgenommen.
Der Mann mit einem tradierten und nicht hinterfragten Rollenverständnis als Versorger der Familie wird kaum in Erwägung ziehen, daß seine physische Anwesenheit im Rahmen der Familie heutzutage einen genauso hohen Stellenwert haben könnte wie die seiner Frau. Er gewichtet seine Verantwortlichkeit mehr auf der materiell-finanziellen Seite und weniger auf der der emotionalen Verfügbarkeit.
Der Ausspruch »Kinder brauchen Väter« löst bei ihm höchstens ein überfordertes »Jaja« aus, verbunden mit der bissigen Frage, ob er sich in seinem geschäftlichen Streß nicht bereits genug abstrample für die Familie? Und bitte, wann und wie sollte er daneben noch zuständig sein für Kindererziehung plus Schulaufgaben und Chauffeurdienste zum Musikunterricht und zur Tennisstunde?! Völlig unmöglich! Dafür hätte seine Frau massenhaft Zeit – die sei nicht so eingespannt. Aber er bemühe sich, wenigstens an den Wochenenden für die Kinder zuständig zu sein.
Aus langer Tradition gespeist, wird sich der Verzicht auf Kinder mangels zeitlicher und emotionaler Verfügbarkeit für den Mann nicht oder nicht in dem Maß aufdrängen wie bei der Frau. Er hat bei seinem Vater und Großvater, bei den männlichen Verwandten und Freunden der Familie, deren Lebensweise eine Richtlinie für sein eigenes Leben ist, vor allem erlebt, wie Männer nur zeitweise, sparsam bemessen, ihren Familien zur Verfügung standen – und das hat sich ihm eingeprägt.
Seine Mutter hingegen und Frauen überhaupt waren aber ständig präsent … woher soll der heutige Mann schon genügend Erfahrungswerte haben, die eine solchermaßen verteilte familiäre Gewichtung relativieren oder gar in Frage stellen? Sagte doch Schiller schon:
»Der Mann muß hinaus
ins feindliche Leben,
muß wirken und streben
und pflanzen und schaffen …«
…
»Und drinnen waltet
die züchtige Hausfrau,
die Mutter der Kinder,
und herrschet weise
im häuslichen Kreise …«
Heutige Väter, die in diesem Rollenverständnis versteinert sind, sollten daran denken, daß sich die Zeiten seit Schiller um einiges verändert haben. Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert sind Familienstrukturen aufgebrochen und in einem fortwährenden sozialen Wandel begriffen. Daraus folgten Werteveränderungen, wie die aufgewertete sozio-politische Stellung der Frau, die allmählich schwindende Rolle der Familie als einziges soziales Sicherungsnetz und die damit verbundene Entmachtung des Vaters als Familienoberhaupt.
Die patriarchalisch strukturierte Familie, die davon abhängig war, daß der Mann und Vater für Recht und Ordnung sorgte und als einziger in der Lage war, für das Überleben der Familie zu sorgen, gehört in unserer mitteleuropäischen Kultur der Vergangenheit an.
Mit anderen Worten: die Schillersche Familienidylle hat längst ausgedient – das wissen wir und das wissen unsere Kinder. Ein sozialer Wandel hat stattgefunden – diese familiäre Rollenverteilung ist mehr als veraltet – sie ist verstaubt und stimmt längst nicht mehr. Die männlich-väterlichen Werte von einst sind nicht mehr die, welche heute benötigt werden.
Der heutige Vater, der sich noch immer an Schiller orientiert – und »ständig hinaus ins feindliche Leben (Arbeitsplatz) zieht« – wird zur unglaubwürdigen Figur in der eigenen Familie. Der durch seine Leistung alleinseligmachende und andere zu Dank verpflichtende pater familias stellt keinen ernstzunehmenden männlichen Wert mehr dar für Tochter und Sohn.
Papa ist ständig von der Familie abwesend. Warum? Seine Abwesenheit muß doch damit zu tun haben, daß er schlichtweg mehr Spaß hat an seinem Arbeitsplatz als in der Familie. Aus Existenzsicherungsgründen kann er wohl kaum ständig dort sein wollen und müssen, denn zum Überleben der Familie braucht es weder einen neuen Fernsehapparat noch ein größeres Auto, geschweige denn eine Kreuzfahrt … Vielleicht sind das ja Mamas Wünsche – aber Papa könnte auch mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, er brauche weniger Karriere, weniger Luxus, dafür mehr Zeit für seine Lieben zu Hause. Warum tut er es nicht?!
Fazit: Männliche Werte und männliche Selbstverwirklichung liegen nach wie vor außerhalb der Familie – Väter sind noshow – Mütter sollen demzufolge unverändert sowohl emotional wie zeitlich zuständig sein.
Abwesende Väter sind heute ein mangelndes Schutzschild für ihre Kinder. Ungefiltert prallen die von Werbung und Medien propagierten Supertypen auf das nach Richtlinien suchende Kind. Leistungsstärke und Coolness – beides ach so pseudo-männliche Werte, die jeden Pubertierenden in seinen altersbedingten Unzulänglichkeitsgefühlen in die Knie zwingen.
Was muß ein Sohn tun, denken, als Ziel anpeilen, um so zu werden, wie die ihm gezeigten Rambo- und Leistungstypen? Und welche weibliche Idealvorstellung muß eine Tochter erreichen, um so einen Rambo- und Leistungstypen zu erobern? Und wo, bitte, ist der Vater, der dem Sohn oder der Tochter eine subjektivere, zeitgemäße, menschlich faßbare männliche Identifikationsfigur bieten könnte? Der all diesen suggerierten Unsinn, wie ein Mann sein sollte (und sicher nicht ist!) relativiert?
»Kinder brauchen Väter« – heute mehr denn je. Emotional verfügbare, richtliniengebende, schützende Väter. Väter, die ihrer Familie mindestens genauso viel Raum zugestehen wie ihrem Leistungsbereich.
Frauen, die ihrerseits aus Generationen von zuständigen und mehr oder weniger positiv verfügbaren Müttern als Identifikationsfiguren stammen, wissen instinktiv um dieses Bedürfnis, um diese Suche nach Orientierung seitens des Kindes.
Wir dürfen also die Vermutung wagen, daß eine karriereorientierte Frau mit dem Verzicht auf Kinder einen verantwortungsbewußten Entscheid fällt. Ihr ist es anscheinend deutlich bewußt, was einem Kind Verfügbarkeit und damit Identifikationsmöglichkeit bedeuten. Sie hat es erfahren in der eigenen Herkunftsfamilie, aus der eigenen emotionalen Sättigung oder aus schmerzlichen Mankos.
Im überlieferten Mutterbild steht für die Frau nicht (oder noch nicht) die Leistung im Vordergrund, sondern die Zuständigkeit im häuslich-familiären Bereich. Ihre Verantwortung gewichtet sie somit stärker auf der emotional-verfügbaren Seite. Das heißt, sie überlegt weniger, was sie ihrem Kind materiell ›bieten‹ könnte oder müßte, sondern wie groß ihre emotionalen Ressourcen noch sein würden, falls sie sich für eine berufliche Karriere entschiede. Die Grundlagen für ihre Entscheidung sind demnach zeitgemäßer und realistischer als die des Mannes, der emotional-unreflektiert ›sowieso gerne‹ Kinder möchte.
Beim Kinderwunsch überlegt sich der Mann eher den materiellen Aspekt: Können wir uns ein Kind, zwei, drei, leisten? Eine sogenannte emanzipierte Frau weiß dagegen um das Dilemma des Hin- und Hergerissenseins zwischen familiärem und beruflichem Engagement und wie schnell ihr alles zu viel – und dem Kind zu wenig werden könnte. Vom gesellschaftlichen Aspekt her braucht sie keine harmonische Familienkulisse, um sich den beruflichen Alltag und Aufstieg zu erleichtern. Wiederum im Gegensatz zum Mann, der nach wie vor ein möglichst integres Familienleben mit Kindern als notwendige Ergänzung bzw. Referenz für ein erfolgreiches Karriere-Climbing aufweisen sollte.
Vergessen wir doch bitte nicht, daß auch und gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft – trotz Wertewandel – von der Ehefrau noch immer erwartet wird, daß sie ihrem erfolgreichen Karriere-Tiger den Rücken frei hält. Zudem sie und die gemeinsamen Kinder seinen Ruf als seriösen und sozial angepaßten Mann sichern. Gleichzeitig übernimmt sie diskret und selbstverständlich die nötigen Kleinarbeiten für ihn, damit er ungestört seine berufliche Laufbahn hinaufeilen kann.
Ab und zu wird ihr die Firmendirektion oder Belegschaft eine Anerkennung zukommen lassen für all die still geleisteten Dienste … was sie wiederum motiviert, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz und dem damit verbundenen Verzicht auf Partnerschaft und Selbstverwirklichung – im Namen der erfolgreichen Karriere und des lukrativen Verdienstes ihres Ehemannes.
Sie: »Ich sehe zu, daß ich alles von meinem Mann fern halte, er ist so eingespannt« (…auch die Kinder und ich sind manchmal zuviel).
Er: »Ich bin meiner Frau dankbar. Ohne sie wäre ich heute nicht dort, wo ich bin« (…ich, ich bin der Mittelpunkt).