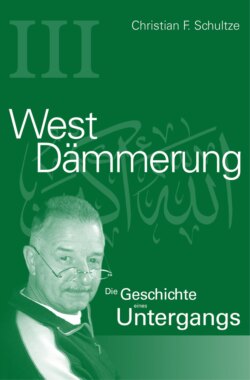Читать книгу Westdämmerung - Christian Friedrich Schultze - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
ОглавлениеÜberhaupt war die Zeit nach seinem Empfinden nach der „Wende“ mit unglaublicher Geschwindigkeit dahingerast.
Erst in seinem erzwungenen Ruhestand war ihm klar geworden, wie undeutlich er sich an die weltverändernden Ereignisse der neunziger erinnerte. Möglicherweise lag es an der Eigenwilligkeit seines Gedächtnisses, das ihm mit zunehmendem Alter eher Ereignisse seiner Kindheit präsentierte? Oder war es die Vielzahl der meist einschneidenden Begebenheiten jener Jahre, in der sowohl in der Bundesrepublik, wie auch „draußen“, eine politische Entscheidung die andere jagte und in der fast jeder Tag durch bedeutende Umbrüche vor allem im Osten Deutschlands gekennzeichnet war? Die Ereignisse in der übrigen Welt, besonders aber in Südeuropa und im Sowjetreich, hatte er dabei kaum wahrgenommen!
Jetzt, wo er hier oben auf der „Ostrauer Scheibe“ in dieser Rehabilitationsklinik stationiert war, überraschend gut gepflegt und versorgt wurde und viele, wenn auch nur kleinere Spaziergänge unternehmen konnte, hatte er die Zeit, sein Leben nach dem Mauerfall noch einmal Revue passieren zu lassen.
Wauer hatte in den neunziger Jahren mit dem Neuaufbau seiner Firma, der Pflege seiner todkranken Mutter, den Auseinandersetzungen in der Kreistagsfraktion und mit der teils überforderten, teils schon erste Anzeichen von Korruption zeigenden Landkreisverwaltung, eine solche Menge ganz alltäglichen Konfliktstoff um die Ohren gehabt, dass seine Tage vollständig ausgefüllt waren. Bei alldem hatte er das meiste verpasst, was damals außerhalb seines kleinen, sinnlich wahrnehmbaren Heimatkreises von vielleicht fünfzig Kilometern im Quadrat sonst noch passierte.
Wenn er heute genauer wissen wollte, was damals, kurz nach der denkwürdigen Mitteilung zur "sofortigen Reisefreiheit" der DDR-Bürger durch Günter Schabowski und während seines mühevollen Einstieges in die so genannte „Freie Marktwirtschaft“ alles vorgefallen war, musste Wauer schon die vielfältig vorhandene, einschlägige Literatur, neuere historische Lexika, das umstrittene, seiner Meinung nach aber irgendwie geniale, „Wikipedia“ oder eine der anderen zahlreichen Quellen des Internets benützen, um sich eine einigermaßen verlässliche Übersicht über die jüngste deutsche, europäische und Welt-Geschichte zu verschaffen.
Dass im Juli 1990 die nun vereinigte deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer, nach Bern 1954 und München 1974, in Rom erneut Weltmeister geworden war, hatte Wauer in jenem „Wahnsinnsjahr“ jedenfalls nur am Rande mitbekommen. Fußballweltmeister und Wiedervereinigung, ein fast unglaubliches Paket für den gemeinen Deutschen!
Während er früher zu solchen Sportereignissen regelmäßig vor dem Fernseher gehockt hatte, hatte er damals sogar das Endspiel gegen Argentinien verpasst, weil er eine wichtige Projekt-Ausschreibung termingerecht abliefern musste, und sein neu installiertes Computerprogramm einfach noch nicht richtig zu bedienen wusste. Jedenfalls hatte Deutschland durch Foulelfmeter in der 85. Minute, den Andreas Breme gegen den als "Elfmeterkiller" berüchtigten argentinischen Torwart Sergio Goycochea verwandelte, mit 1:0 gewonnen, und die Euphorie in der Nacht und tags darauf war in ganz Deutschland riesengroß gewesen. Wauer, der solche Begeisterungsüberschwänge etwas befremdlich fand, hatte sich schon immer gefragt, ob sich seit den römischen Gladiatorenspielen am menschlichen Verhalten wirklich irgendetwas verändert hatte.
Ja - die Informationsfreiheit! Das war etwas, was sich mit der Verbreitung des Internet und des schnellen Ausbaus der dazu erforderlichen Infrastruktur, der von der Bundesregierung vehement gefördert worden war, seit Beginn der neunziger Jahre bis in die Gegenwart rapide entwickelt hatte und das sich bei allen Problemen, die vor allem seit dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts damit auch zu Tage getreten waren, insgesamt als ein außerordentliches Faustpfand bürgerlicher Freiheiten bewährte. Heute, in den definitiv letzten Wochen seines Lebens, verglich es Wauer mit der Erfindung des Buchdrucks, der die Menschheit im 16. Jahrhundert von der allumfassenden Sklaverei der katholischen Kirche befreit und die Deutungshoheit der damals Herrschenden gebrochen hatte.
Wenn er aber an die Möglichkeiten dachte, die ihm in den vergangenen drei Jahrzehnten die rasant aufstrebende Technologie der Heimcomputer, und eben nicht nur ihm, sondern tatsächlich Milliarden von Erdenbewohnern, gebracht hatte, musste er sich eingestehen, dass niemals zuvor derartige Freiheitspotentiale denkbar und umsetzbar gewesen waren. Getrübt wurden solche Überlegungen allerdings durch die weltweiten Schlagzeilen, die später so genannte Whistleblower, wie Edward Snowden, Bradley Manning und Julian Assange, mit ihren Veröffentlichungen seit der Jahrtausendwende verursacht hatten. Das WWW hatte eben auch eine sehr dunkle Seite. Die Geheimdienste der ganzen Welt, allen voran die National Security Agency der USA, benutzten es in gigantischem Ausmaß zur Ausspionierung und Überwachung ganze Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Journalisten und Politikern aller Ebenen. Die privaten Großkonzerne, die diese Netze betrieben, waren dabei ihre willigen Helfershelfer.
Am 21. Juli des Vereinigungsjahres hatte die englische Gruppe „Pink Floyd“ am Potsdamer Platz, ganz nahe an der inzwischen schon lückenhaften Mauer, ein Open-Air-Konzert zu ihrem allegorischen Album „The Wall“ gegeben, für das Wauer mit Mühe zwei Karten besorgt hatte. Mittlerweile war mit Sibylles Hilfe eine kleine, wenn auch noch unvollständige Sammlung der modernen „Oratorien“-Alben seiner nunmehrigen Lieblingsrockband zusammengekommen. Er war überzeugt, dass auch Bach und Mozart ihre Freude an diesen Briten gehabt hätten. Wauer gefiel der leicht psychedelische Rock mit der teils philosophischen, teils sozialkritischen Lyrik der Musiker um David Gilmor und Roger Waters. „The Final Cut“, ein musikalisches Memorial für die Gefallenen des Falklandkrieges, sagte ihm allerdings mehr zu, als „The Wall“, wiewohl das letztere Doppelalbum gerade wieder aktuellen Drive gewonnen hatte.
Diese Truppe einmal live erleben zu können, war auch einer seiner damaligen Wünsche gewesen. Eine wichtige, unaufschiebbare Sitzung des Bauausschusses des Kreistages kam dazwischen, und er konnte nicht nach Berlin fahren. Den Rest des Konzertes mit dem symbolischen Einsturz der aufgetürmten Mauerkulisse hatte er nach der Sitzung noch nachts im Fernsehen angeschaut. Sibylle hingegen berichtete, dass sie mit ihrer Schwester zwar dort gewesen war, aber kaum etwas von den Darbietungen auf der Bühne mitbekommen habe, weil es wegen der Hunderttausenden, die sich zu diesem Konzert am Potsdamer Platz eingefunden hatten, unmöglich gewesen sei, näher an die Akteure heran zu kommen. Die Musik wäre allerdings weit über die reale Berliner Mauer hinweg geschallt.
Und was war in jenem Jahr eigentlich in der Sowjetunion alles passiert? Michael Gorbatschow, ihr damaliger Präsident und Parteivorsitzender der KPdSU, hatte bereits Anfang 1988 vor der UNO in einer programmatischen Rede verlautbart, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Nationen über allem stehen müsse. Die Folge davon war, dass sich als erste Nation Estland als nicht mehr zur Sowjetimperium gehörig erklärte. Dem folgten alsbald Lettland und Slowenien. Letzteres trat aus dem Jugoslawischen Bund aus und wurde von Deutschland umgehend anerkannt. Danach folgten Litauen, Armenien und Turkmenistan und dann verkündete Gorbatschow 1990, dass künftig in der SU ein Mehrparteiensystem und eine geregelte Marktwirtschaft eingeführt werde. Dem folgten die chaotischen und für die meisten Russen schmerzensreichen 90er Jahre.
Der südafrikanische Freiheitsheld Nelson Mandela, den Margaret Thatcher und Ronald Reagan noch 1989 auf ihren Terroristenlisten geführt hatten, wurde in Südafrika nach 23 Jahren Haft endlich auf freien Fuß gesetzt. Auf Wolfgang Schäuble wurde ein Attentat verübt, welches ihn für den Rest seines Lebens in den Rollstuhl zwang und Michael Gorbatschow bekam am 10. Dezember, dem 94. Todestag Alfred Nobels, den Friedensnobelpreis. Es war wirklich ein „Wahnsinnsjahr“ gewesen mit all den Ereignissen, die Wauer beim Nachdenken und Nachschlagen allmählich wieder ins Bewusstsein traten.
Zur Jahreswende 1990-1991 hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass es einen neuen größeren Krieg des Westens gegen den Irak geben würde, nachdem sich Saddam Hussein geweigert hatte, seine Truppen freiwillig aus Kuwait abzuziehen. Hingegen begann die UdSSR, ihre Armeen aus der DDR und aus Polen abzuziehen. Das Gerücht war umgegangen, dass die Russen ihre Atomwaffen vom Gebiet der DDR bereits abtransportiert hätten. Dies war ein bedeutender Friedensakt und Fingerzeig dafür, dass Gorbatschow wirklich eine Friedensordnung in Europa wollte, um sein wirtschaftlich zerrüttetes Land mit westlicher Hilfe wieder aufbauen zu können.
Wauer glaubte sowieso, dass der Mauerfall nur deshalb möglich gewesen war, weil Moskau in der internationalen Politikarena deutlich gemacht hatte, dass es einer Lösung der „deutschen Frage“ generell positiv gegenüber stand. Doch gleichzeitig beschleunigte sich der Zerfall der Sowjetunion. Im April erklärte Georgien seine Unabhängigkeit. Der Warschauer Pakt und der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe begannen mit ihrer Selbstauflösung. Und in Jugoslawien fingen die verheerenden Sezessionskriege an, in die sich dann die NATO völkerrechtswidrig einmischte.
Auf diese Weise waren die ersten beiden Jahre nach der Wiedervereinigung „verrast“, und da Wauers Firma „Sachsenprojekt“ zusammen mit der deutschen Bauindustrie gewaltig „boomte, hatte er damals trotz all dieser politischen Entwicklungen wohlgemut in die Zukunft geschaut.
Es folgte das Jahr 1993. Am 2. Februar gedachte man im Zittauer Kreistag, wie in ganz Europa, des 50. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad. Wenn auch sein Vater nicht in Stalingrad, sondern an der Nordfront gekämpft hatte, so war es für Wauer doch ein Tag gewesen, an dem er wieder einmal besonders intensiv über sein unseliges Verhältnis zu seinem Erzeuger nachgedacht hatte. Wie hätte Karl Wauer all die gewaltigen Umbrüche der letzten Jahre beurteilt? Hätte er sich darüber gefreut? Hätte er sie als eine Befreiung empfunden? In dem Sinne, wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker es in seiner berühmt-berüchtigten Rede vor dem Bundestag am 8. Mai 1985 zum 40. Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht zum Ausdruck gebracht hatte?
Weizsäcker schloss damals seine Ansprache mit den Worten: „Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren. Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken, gegen Alternative oder gegen Konservative, gegen Schwarz oder gegen Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel geben. Ehren wir die Freiheit. Arbeiten wir für den Frieden. Halten wir uns an das Recht. Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit. Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.“
Was war daraus in den seither vergangenen dreißig Jahren geworden? Hatte sich je wieder ein Deutscher oder ein anderer Europäer daran erinnert?
Wauer fiel dazu ein anderes, einschneidendes und bedeutendes Ereignis ein: Am 1. November des Jahres 1993 trat für die Mitgliedsländer der Europäischen Union der „Maastricht-Vertrag“ in Kraft. Darin war untern anderem die baldige Bildung einer Europäischen Währungsunion unter der Voraussetzung der so genannten Maastricht-Kriterien verankert. Das war ja nun ein ganz gewaltiger Schritt in Richtung Europaunion!
Zum Weihnachtsfest des Jahres 1993 nahm hingegen das Rhein-Main-Mosel-Hochwasser die volle Aufmerksamkeit und die Solidarität aller Deutschen in Beschlag.
Das darauf folgende Jahr verlief genauso hektisch, wie schon die vorhergehenden. Der Jugoslawienkrieg wurde mit dem Eingriff der NATO und ihren verheerenden Bombardements immer blutiger. Erste Skandale bei der Arbeit der Treuhandanstalten sickerten durch und der Wahlkampf zum 13. Deutschen Bundestag tobte in allen sechzehn Bundesländern. Die Kreistagsfraktion unterstützte den regionalen Kandidaten der SPD, Friedrich Lehmann, mit allen zur Verfügungen stehenden Kräften. Wauer erlebte hautnah, welche Sorge, ja geradezu Angst, den Zittauer befallen hatte, dass er es über die Sächsische Liste nicht schaffen würde, erneut in den Bundestag einzuziehen. Da die Sachsen, im Gegensatz zu den Zeiten vor dem Krieg, neuerdings ganz überwiegend „christlich“ wählten und anderseits die PDS-Kommunisten in den regionalen Umfragen noch ein ganzes Stück vor den Sozies rangierten, war diese Befürchtung wohlbegründet. Doch Lehmann schaffte es sogar recht komfortabel und die Erleichterung aller „Genossen“ des Wahlkreises, der Kreistagsfraktion und ganz besonders Wauers darüber war riesengroß gewesen, „ihren“ Mann in den Bundestag gehievt zu haben.
Die christlich-liberale Koalition hatte bei dieser Wahl ihre Mehrheit gerade noch behauptet. Die Union aus CDU und CSU erreichte mit 41,5 Prozent der Stimmen allerdings ihr bisher schlechtestes Ergebnis seit 1949. Die SPD verzeichnete damals 36,4 Prozent. Die PDS zog mit 4,4 Prozent in den Bundestag ein, weil sie im Ostteil Berlins vier Direktmandate errang. Auch die Bündnisgrünen waren wieder im obersten deutschen Parlament vertreten. Und Helmut Kohl, der im Frühjahr 1994 in den Umfragen noch weit abgeschlagen hinter dem SPD-Kandidaten Rudolf Scharping gelegen hatte, wurde zum fünften Mal hintereinander zum Kanzler aller Deutschen gewählt. Klaus Kinkel von der FDP wurde Vizekanzler. Rudolf Scharping und die SPD hatten verloren, wenn diesmal auch nur knapp.
Ein anderes, in den Medien jener Zeit keineswegs besonders hoch gehandeltes, Ereignis fand Wauer noch bedeutungsvoller als jenen denkwürdigen Wahlausgang: Anfang Dezember hatte ein Gipfeltreffen der Teilnehmer der ständigen „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit“ in Europa stattgefunden, auf der über den weiteren Ausbau der Sicherheitsarchitektur und die Entwicklung der Kooperationsbeziehungen der europäischen Staaten beraten wurde. Am Rande jenes KSZE-Gipfeltreffens in Budapest tauschten US-Präsident Bill Clinton, Russlands Präsident Boris Jelzin sowie die Präsidenten der Ukraine, Weißrusslands und Kasachstans die Ratifizierungsurkunden zum START-1-Abkommen (Strategic Arms Reduction Talks -Verhandlungen über die Reduzierung der strategischen Waffen) aus. Damit trat der Vertrag über eine Reduzierung der Atomwaffen mit einer Reichweite von mehr als 5.500 km in Kraft, welcher allerdings bereits 1991 unterzeichnet worden war.
Wauer freute sich, dass diese Verhandlungen endlich zu einem positiven Abschluss gekommen waren. Auch wenn sich damit immer noch genügend Atomwaffen in der Welt befanden, die für eine Vernichtung allen menschlichen Lebens auf der Erde mehrfach ausreichten, schien es Wauer, dass sich überall auf dem blauen Planeten ein echter Wille zur weiteren Abrüstung und Verringerung der nuklearen Gefahren durchsetzte. Zum ersten Mal konnte man hoffen, dass das Damoklesschwert der Selbstvernichtung des homo sapiens sicher verankert bleiben würde. Nur mit Grausen erinnerte er sich an die Alpträume, die ihn deswegen all die vergangenen Jahrzehnte verfolgt hatten.
Doch bereits diese Konferenz der Großmächte wurde von erheblichen Meinungsverschiedenheiten der Teilnehmer aus Ost und West überschattet. Russland lehnte eine Osterweiterung der NATO strikt ab und wollte sich vorerst nicht an der NATO-Initiative "Partnerschaft für den Frieden" beteiligen. Zum Schluss der Tagung wurde die KSZE in „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)“ umbenannt.
In Wauers Rückblick war die erste Hälfte der neunziger Jahre trotz allem eine hoffnungsvolle Zeit gewesen, wenn er es am heutigen Zustand Deutschlands, Europas, der Welt und an seinem eigenen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Niedergang maß.