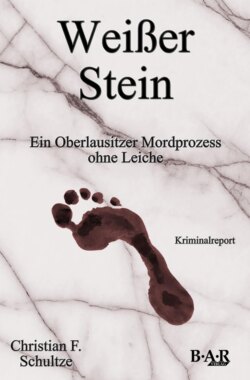Читать книгу Weißer Stein - Christian Friedrich Schultze - Страница 5
2. Hutchwiese
ОглавлениеWir kannten ihn schon lange, bevor er unter Anklage gestellt wurde.
Im April 1982 war Peter I. mit seiner frisch angetrauten Frau in das Haus unterhalb unseres Grundstückes „An der Hutungswiese“ eingezogen, zehn Jahre, bevor die Geschichte, die hier erzählt werden soll, ihren Anfang nahm. Alle in der Siedlung hatten sich über den ungewöhnlichen Vornamen der dunkeläugigen und zurückhaltenden Frau mit den schulterlangen, braunen Haaren, die mit ihm gekommen war, gewundert: Sonnhild.
Das Grundstück mit dem großen Umgebindehaus reichte bis zum unbeschrankten Bahnübergang, über welchen der schmale Zufahrtsweg, der am Hotel Jonashof von der Hauptstraße des Niederdorfes abzweigt, über die Kleinbahntrasse hinauf zum Seniorenheim führt. Das Paar hatte es von dem „nach dem Westen“ gegangenen Herbert T. gekauft. Dieser hatte es wiederum von einer guten Bekannten unserer Großmutter, Frau Ilse S., übernommen. Auf diese Weise waren unsere Familien Nachbarn geworden, wenn auch getrennt durch die Bahngleise der Schmalspurbahn.
Unser Anwesen, welches oberhalb des Bahnkörpers lag, hatten wir nach dem Tod unserer Mutter im Herbst 1985 übernommen; besser gesagt, übernehmen müssen. Denn wir lebten in jener Zeit im Osten des geteilten Berlin, der Hauptstadt der so genannten DDR, rund dreihundert Straßenkilometer oder sechs Stunden Zugfahrt entfernt von Jonsdorf im Zittauer Gebirge, dem kleinsten Mittelgebirge Deutschlands. Damals bedeutete das eine weit längere Reise als heute, selbst wenn man mit dem Auto fuhr, weil die Autobahn A 4, welche von Dresden über Görlitz nach Breslau führt, in jenen Jahren teilweise zerstört und ab Bautzen gänzlich gesperrt war.
Einst hatte dieses Flurstück Nr. 11 von Altjonsdorf, wie diese Ansiedlung im 19. Jahrhundert im Amtsdeutsch korrekt bezeichnet wurde, unser Urgroßvater Gustav Andreas Kober erworben. Das Wohnhaus war ein so genanntes „Umgebindehaus“, wie fast alle Häuser, die damals auf der Hutungswiese, wie in der gesamten Oberlausitz und im Böhmischen, errichtet wurden. Neujonsdorf liegt rund zwei Kilometer weiter das Tal des Grundbaches hinauf und bildet seit Beginn des 20. Jahrhunderts das Zentrum des Dorfes. Zimmermann und Bienenzüchter Kober hatte das geräumige Haus mit der großen "Abseite" sowie die weite, leicht abschüssige Streuobstwiese von seiner verwitweten Mutter Emilie Auguste, geborenen Helle, im Jahre 1889 für ganze sechshundertfünfundsiebzig Reichsmark gekauft. So steht es, in gestochen akkurater Sütterlin-Handschrift, im vom Königlich-Sächsischen Amtsgericht zu Zittau genehmigten Kaufbrief geschrieben.
Die Siedlungshäuser der Hutungswiese erstrecken sich entlang der beiden Fließe des „Kalten Borns“, welcher, wie viele Wasser des Zittauer Gebirges, am Rand der Lausitzer Überschiebung hervorquillt und sich unten im Tal in den Bach ergießt, welcher weit oben im Ort nahe der heutigen tschechischen Grenze entspringt. Sie liegen unregelmäßig über den weiten Hang bis hinunter zum Weiler Hänischmühe verstreut, wo dieses Gewässer zusammen mit dem des Grundbaches, der in früherer Zeit auch „Jonsdorfer Wasser“ genannt wurde, die Grundlage für die Leinwandbleichereien bildete, welche sich Anfang des 19. Jahrhunderts zusammen mit der Leinweberei in der ganzen Gegend rasant entwickelten.
Wenig später hatte man ganz oben, direkt am Waldrand, unmittelbar neben der Hauptquelle des Borns unter den Trögelsteinen, das Genesungshaus erbaut, welches wegen der damals besonders guten Luft des Ortes als TBC-Kurheim fungierte. Es war der erste Ziegelbau der Siedlung. Das große Objekt existiert heute noch, wurde nach der so genannten Wende renoviert und zu einem Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes erweitert und umgestaltet.
Martha Helene Hauptmann, geborene Kober, unsere Großmutter, ererbte das Hausgrundstück von ihrer verwitweten Mutter Anna Kober, der Frau des Zimmermanns. Wie in dem Grundbuch verzeichnet ist, wurde sie am 6. Mai 1946 als Eigentümerin eingetragen. Das war ziemlich genau ein Jahr, nachdem die gegen Nazideutschland siegreichen Russen ihren lungenkranken, pazifistischen Ehemann, Grundschullehrer und Nazihasser Paul Hauptmann verschleppt hatten. Die russischen Politoffiziere verwechselten dessen ungewöhnlichen Familiennamen mit einem militärischen Rang. Wenige Wochen danach soll er unweit von Liegnitz in Niederschlesien, nur sechzig Kilometer vom Geburtsort seines berühmten Namensvetters und Literaturnobelpreisträgers entfernt, in einem Internierungslager gestorben sein. Niemand konnte uns bis heute etwas über die näheren Umstände seines Todes und den Verbleib seiner Leiche mitteilen. Wie wir aber zuverlässig herausgefunden haben, war Paul Hauptmann mit Gerhart Hauptmann aus Obersalzbrunn bei Waldenburg, dem heutigen polnischen Wałbrzych, welcher das Leid der schlesischen Leineweber des 19. Jahrhunderts in seinem berühmten Drama „Die Weber“ der ganzen Welt nahegebracht hatte, weder verwandt noch verschwägert.
Mit dem Tod der Großmutter am 29. Januar 1960 ging das Grundstück in das Eigentum unserer Mutter Brigitta, geborenen Hauptmann, über. Im Jahre 1967 wurde es geteilt und die obere Hälfte mitsamt Wohnhaus an die Eheleute W. verkauft, mit denen es in der Folge jahrelangen Streit wegen vorgeblicher Verletzung von Nachbarschaftsrechten gab. Übrig blieb der lediglich mit einer Holzlaube und Kobers Bienenhaus bebaute untere Wiesenteil mit Obststräuchern, Kirsch- und Apfelbäumen, welcher südlich an die Bahnschienen grenzte. Noch zu Lebzeiten unserer Mutter wurde nun dieses Stück Land an mich überschrieben.
Wahrscheinlich waren es die starke Quelle, direkt am Waldrand der nördlichen Flanke des Berges, sowie die weiten Wiesen ins Tal hinab gewesen, die den Laienbruder Jonas Anfang des 16. Jahrhunderts bewogen haben mochten, der Herrschaft der Oybiner Cölestinermönche das Privileg abzuringen, seine Schafe dort weiden und ein Vorwerk errichten zu dürfen. In jener Zeit waren die Mönche des Klosters Oybin die Besitzer der Fluren des Zittauer Gebirges. Der später nach dem Schäfer benannte Berg grenzt die engen Täler zwischen Ameisenberg und Oybin von den nördlichen Ausläufern des Zittauer Gebirges, vom Zittauer Becken und vom Einschnitt des langgezogenen Bertsdorfer Tales ab. In Oberlausitzer Mundart handelt es sich bei diesem Hang seit jeher um die „Hutchwiese“.