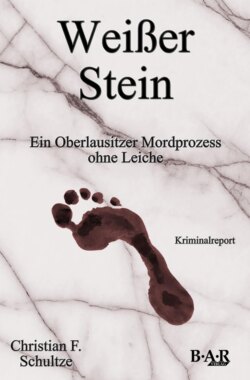Читать книгу Weißer Stein - Christian Friedrich Schultze - Страница 9
6. Sommergäste
ОглавлениеVor dem Zweiten Weltkrieg bildete der Fluss Queis, die heutige polnische Kwisa, die Grenze der seit 1815 in eine preußische und eine sächsische geteilten Oberlausitz zu Schlesien. Somit gehörten auch die nördlichen Züge des Isergebirges mit den Ortschaften zwischen der Oberlausitzer Neiße und diesem kleinen Grenzfluss zur Oberlausitz. Ebenso die Dörfer und Städtchen entlang dieses Flüsschens, welcher, wie die Neiße, in mehreren Quellbächen am Hohen Iserkamm entspringt.
Nicht nur in den Tälern und an den Hängen des Zittauer Gebirges, sondern auch an den Wasserläufen des Sudetengebirges, hatten sich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts einige Kurorte entwickelt, die von den Bewohnern der größeren westlich und nördlich gelegenen Städte Sachsen und Preußens gerne zur „Sommerfrische“ aufgesucht wurden. Sowohl die gute Luft als auch die bergige, wunderschön bewaldete Landschaft hatten es den Erholungssuchenden angetan. An den Ufern des Queis, in Bad Flinsberg und Bad Schwarzbach, hatte man sogar heilende Quellen gefunden. Und im Zittauer Gebirge, mit seinen bizzaren Felsformationen und markanten Bergen, wie Lausche, Hochwald, Oybin und Jonsberg, durften sich die Ortschaften Lückendorf, Oybin, Waltersdorf und Jonsdorf fortan als Luftkurorte bezeichnen. Besonders in den Sommermonaten machten die Liebhaber dieser abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft und der bizarren Formationen des maritimen Kalksandsteins hier in Scharen Urlaub. Deshalb wurden sie „Sommergäste“ genannt.
1945, nach dem Zusammenbruch der Nazidiktatur, änderte sich alles. Die Oberlausitzer Region östlich von Neiße und Oder, Schlesien und das Sudetenland, wurden polnisch. Das Riesengebirge, dort, wo in fast tausendvierhundert Metern Höhe zwischen Kesselkoppe und Reifträger die Elbe entspringt, wurde entlang seines Kammes geteilt und mit seinem südlichen Teil der Tschechoslowakei, mit dem nördlichen der Volksrepublik Polen zugeschlagen.
In den Jahren nach den Krieg war es für Deutsche schwierig, in diese ehemals deutschen Ostgebiete zu gelangen. Die nach Kriegsende überwiegend aus dem Osten Polens und der Slowakei angesiedelten Menschen waren äußerst misstrauisch allen Deutschen gegenüber und glaubten noch bis zur Wiedervereinigung und dem zwischen den vier Siegermächten USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien im Rahmen der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen abgeschlossenen Friedensvertrag an eine Rückkehr der Vertriebenen. Das Erholungs- und Kurwesen war in allen drei Ländern dieses neu entstandenen Dreiländerecks vollständig zusammengebrochen. Erst Anfang der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts begann sich im Zittauer Gebirge, organisiert vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Einheitsgewerkschaft der Deutschen Demokratischen Republik, erneut ein Ferienwesen zu entwickeln.
Viele Häusler des Kurortes Jonsdorf richteten daraufhin so genannte Fremdenzimmer ein. Auch auf der „Hutchwiese“ besaß fast jedes Haus ein oder zwei Ferienzimmer, nicht vergleichbar mit den heutigen Ferienwohnungen, aber, garantiert von der Vermittlung des DDR-FDGB, allzeit gut belegt.
Auch im Umgebindehaus Peter I.s gab es seit jeher zwei derartige Zimmerchen für Sommergäste. Aber der junge Mann dachte von Anfang an weiter. Bald nachdem die beiden alten Damen ausgezogen und in das Altersheim nach Olbersorf übergesiedelt waren, fing er an, diese Räume gründlich aus- und umzubauen. Außerdem errichtete er im Garten einen Bungalow mit einer regelrechten Ferienwohnung und schloss überall fließendes Wasser und separate Toiletten an. Das gehörte damals noch keineswegs zum allgemeinen Standard. Bei allen diesen Arbeiten ging ihm seine Ehefrau Sonnhild tatkräftig zur Hand und wir wunderten uns nicht selten darüber, dass sie dabei oftmals regelrechte Männerarbeit verrichtete.
Dass Peter ein exzellenter Handwerker für allerlei Gewerke war, hatten wir schnell herausgefunden. Denn auf unserem Grundstück und an der Laube gab es ebenfalls öfters Reparaturbedarf. Doch Peter reparierte auch Motorgefährte, wie unseren Trabi, Rasenmäher der Nachbarn, Motorräder, sogar die beliebten „Multikars“ und so weiter. Für derlei Dienste engagierten wir den gelernten Schlosser gerne. Denn er war geschickt, zuverlässig und erfindungsreich. Und vor allem war er einfallsreich, wenn es um die Besorgung schwierig zu beschaffenden Materials, diverser Ersatzteile und allgemeiner Mangelware ging. Wir wollten nicht unbedingt wissen, wo er es herbekam. Im Gegensatz zu manch anderem Handwerker druckste er auch nie um den Preis herum, sondern nannte diesen stets sofort und direkt, hielt sich auch zuverlässig daran und lieferte pünktlich. Freilich umrankte ihn das Gerücht, dass er den Begriff des Volkseigentums auf recht individuelle Art auslegte. Aber eigentlich störte es niemanden wirklich.
1985 fing Peter an, auf der Wiese hinter seinem Haus einen formidablen Swimmingpool zu bauen. Es war schwierig, die dafür erforderliche Grube im granitenen Boden ausreichend tief auszuheben. Er benötigte Wochen dazu. Natürlich floss auch durch seinen Garten eines der beiden Bächlein des Kalten Borns. Der überdachte Tump, welcher zum Grundstück gehörte, war annähernd mannstief. Von da konnte er den Zufluss für das geplante Planschbecken abzweigen. Das kräftige Rinnsal eignete sich allerbestens dazu, das dreieinhalb mal sechseinhalb Meter große, an seiner tiefsten Stelle knapp zwei Meter tiefe Becken innerhalb kurzer Zeit zu füllen. Dieses Wasser war volkseigen, gehörte also allen und niemanden. Gemeineigentum war es schon jahrhundertelang gewesen.
Die Nachbarn staunten und beneideten die Aktivitäten und den Erfolg des Zugezogenen. Am Wochenende der Einweihung des Pools weilte unsere Familie gerade in Jonsdorf und wir wurden eingeladen. Meine Frau hatte Beziehungen zu Radeberger Bier, welches damals eine Rarität darstellte. Peters Frau Sonnhild hatte Verbindungen zur hiesigen Fleischerei. So wurde gefeiert, gegrillt, Bier getrunken und mit den Kindern zusammen gebadet. Ich glaube, es war der erste Swimmingpool des Ortes, welchen wir damals seiner Bestimmung übergaben. In den heißen Sommern danach durfte unsere Familie, wenn wir unser Grundstück besuchten, das große Planschbecken regelmäßig mit benutzen; gegen reichlich Radeberger Pilsener, versteht sich.
Bis kurze Zeit nach der Wende, da war das Ferienwesen des Zittauer Gebirges erneut zum Erliegen gekommen. Bereits vorher waren mit dem Kurstatus der beliebten Erholungsorte des Zittauer Gebirges Schwierigkeiten entstanden, weil die Luft längst nicht mehr so rein war, wie zu Vorkriegszeiten. Das hing damit zusammen, dass zwischen Olbersdorf und Zittau, ebenso wie südlich von Görlitz bei Berzdorf und am östlichen Neißeufer bei Bogatynia, dem früheren Reichenau, riesige Braunkohlentagebaue entstanden und in Hirschfelde und Bogatynia große Kohleverstromungsanlagen gebaut worden waren, deren Abgase die umgebende Atmosphäre nachhaltig verpesteten. Herrschte jedoch Südwestwind, wehten die schädlichen, zumeist ungefilterten Abgase, besonders die gefährlichen Schwefeldioxide, von den tschechischen Kraftwerken zu uns herüber. Die Folge davon war, dass an den Südhängen der Lausitzer Berge bis hinüber zum Riesengebirge ein großes Waldsterben um sich griff.
Nach der Herbstrevolution 1989 setzte innerhalb eines einzigen Jahres, wie es der SPD-Politiker Oskar Lafontaine im Fernsehen vorausgesagt hatte, in der gesamten ehemaligen DDR, so auch in der Nieder- und der Oberlausitz, eine durchgreifende Massenarbeitslosigkeit ein. Die Strukturwandlungen der Globalisierung, die die Westdeutschen in vierzig Jahren durchmachen mussten, waren nun von den Mitteldeutschen der „DDR“ in zwei bis drei Jahren zu absolvieren. Durch die Einführung der DeMark stiegen die Betriebskosten der Ostbetriebe in einer Nacht um das Vier- bis Fünffache. Die Beschäftigten der Braukohleindustrie und des Maschinenbaus, die Frauen der Spinnereien, Webereien und Nähereien und mit ihnen die Händler und Kleingewerbetreibenden, die von dieser Industrie gelebt hatten, wurden zu Hunderttausenden arbeitslos. Zudem mochte niemand mehr zur „Sommerfrische“ in das Dreiländereck Polen, Tschechoslowakei und Deutschland reisen. Wir auch nicht! Alle wollten wir die schönen, uns bislang unbekannten, verheißungsvollen Regionen Westdeutschlands kennenlernen.
Undsere Familie vor allem die Alpen. Uns zog es aber auch an den Rhein, auf die Ostfriesischen Inseln, in die deutschen Weltstädte München, Köln und Hamburg. Und danach wollten wir nach Italien, nach Mallorca und in all die anderen attraktiven Orte rund um das Mittelmeer oder gar nach Übersee, in all die Länder, die uns in den schönen bunten Werbekatalogen der westdeutschen Tourismusindustrie nunmehr schmackhaft gemacht wurden.
Die Industrie der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik wurde mittels der Treuhandanstalt und ihrer Filialen in den früheren Bezirken an so genannte Investoren verkauft, zum größten Teil jedoch abgewickelt. Dazu reisten Bataillone von Beratern und Helfern in das Beitrittsgebiet ein, welche von den Einheimischen zunächst und zum größten Teil mit offenen Armen empfangen wurden. Bis auf ganz wenige Skeptiker waren auch alle Oberlausitzer von der Hoffnung beseelt, dass nun in den neu entstehenden Bundesländern der gemeinsame Aufbau einer florierenden Überflusswirtschaft angepackt und Westdeutsche und Ostdeutsche gemeinsam in kürzester Zeit blühende Landschaften in den durch den industriellen Raubbau großenteils verwüsteten Regionen errichten würden.
Und tatsächlich, durch diese Deindustrialisierung wurde die Luft im Dreiländereck zusehends wieder besser, die marode Infrastruktur erlebte eine kolossale Aufbauphase und der Verfall der Ortschaften, der besonders in den fünf ostsächsischen Städten des früheren Sechsstädtebundes, Kamenz, Bautzen, Löbau, Görlitz und Zittau, verheerende Ausmaße angenommen hatte, wurde gestoppt. Unverzüglich wurde der Ausbau der Autobahn Dresden-Görlitz in Angriff genommen, die am Ende nicht einmal mehr mit einem Trabbi befahrbar gewesen war. Die Restauration öffentlicher Gebäude, der private Häuslebau und der Wohnungsbau boomten, wie es schien, ohne Ende. Binnen weniger Jahre hatte sich die für die ehemalige DDR-Führung schier unlösbare Wohnungsfrage erledigt. Ein Teil davon allerdings auch bedingt durch die Tatsache, dass hunderttausende, vor allem junge und gut qualifizierte, Frauen und Männer in die „alten“ Bundesländer abwanderten. Etwas später begann man mit der Sanierung der Braunkohletagebaue und allmählich entstand die heutige Lausitzer Seenlandschaft. Besonders aber die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs hatte sich über Nacht grundlegend gewandelt. Mit einem Mal gab es alles im Überfluss. Auch Radeberger Bier.
Zunächst war es allerdings erforderlich, dass alle noch arbeitenden Betriebe neue Eröffnungsbilanzen nach den Übergangsgesetzen des Vertrages über die Herstellung der Deutschen Einheit bekamen und sich an die Regeln des „freien“ Marktes und des bundesdeutschen Handelsgesetzbuches gewöhnten. Gleichzeitig lief die Welle der Restitutionsverfahren für diejenigen mitteldeutschen Betriebe an, die über den Weg der staatlichen Beteiligungen in den siebziger Jahren enteignet und zu volkseigenen Betrieben gewandelt worden waren. Viele der inzwischen gealterten ehemaligen Besitzer oder deren Erben hofften, mit ihren Kleinunternehmen als freie Unternehmer wieder erfolgreich am weltweiten Wirtschaftsgeschehen teilnehmen zu können.
In dieser wahrhaft revolutionären Umbruchzeit wurden in Mitteldeutschland, dem nunmehrigen Osten Deutschlands, die neuen Landes- und Landkreisverwaltungen, der gesamte Finanz- und Justizapparat und das Schulwesen nach den altbundesdeutschen Regeln gestaltet oder umgebaut. Tausende Helfer, vielfach wohlmeinende Ruheständler, aber auch in ihrem Aufstieg bislang verhinderte Karrieristen aus Westdeutschland, im neuen „Freistaat“ Sachsen vor allem aus Baden-Württemberg und Bayern, begannen unter teilweise schwierigen Bedingungen, jedoch abgefedert mit der so genannten Buschprämie, ihren steilen beruflichen Aufstieg und die einheimische Bevölkerung war anfangs dankbar für ihren Beistand.
In den Landkreis- und Finanzverwaltungen und bei den Justizorganen fanden aber auch viele bekannte Kader ehemaliger Staatsbediensteter der untergegangenen DDR wieder Arbeit und Einfluss. Zugleich mit dem wirtschaftlichen Niedergang der mittelostdeutschen Regionen und ihrer rechtlichen und verwaltungstechnischen Neugestaltung setzte eine umfangreiche Verbeamtungswelle ein, welche die Staatskassen der so genannten neuen Bundesländer heute und in Zukunft unverhältnismäßig hoch belastet.
Peter I. hingegen suchte ohne zu zögern im Westen ein neues Glück, um „Westgeld zu machen“, wie er sich ausdrückte. Im Frühjahr 1990 traute er nach dem Umbruch dem Frieden in der Heimat nicht, kündigte bei Robur Zittau und fuhr mit seinem alten Trabbi zunächst nach Hof, von wo er in das Auffanglager Gießen weitergeleitet wurde. Seinen „Citroen Palast“, um den ihn alle Nachbarn beneideten, ließ er wohlweislich in Jonsdorf zurück. Ziemlich bald bekam er eine Arbeit als Kraftfahrer in Bayern, wo ihm auch eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt wurde. Von dort kehrte er im regelmäßigen Wochenwechsel nach Hause zurück.
Bei den Umgestaltungs- und Bauarbeiten im Haus an der „Hutchwiese“ hatte Peters Ehefrau unermüdlich mitgeholfen und oft auch körperlich sehr schwere Arbeiten verrichtet, obwohl sie an einem Gelenkproblem in beiden Schultergelenken litt. Öfters kam es vor, dass sich eins auskugelte und erste Hilfe geleistet werden musste, um es wieder einzurenken. Im Jahr 1980 war sie bereits an der rechten Schulter operiert worden, hatte aber auch mit dieser weiterhin ihre Schwierigkeiten. Die Operation des linken Schultergelenks stand ihr noch bevor. Am 9. April 1991 hatte das Paar seinen zehnten Hochzeitstag gefeiert. Die beiden Jungs waren inzwischen neun beziehungsweise fast fünf Jahre alt.
Wie tausende junger Ostsachsen, die in der Heimat keine, oder keine vernünftig bezahlte, Arbeit finden konnten, reihte Peter sich mit seinem PKW „Trabant“ jeden zweiten Sonntagnachmittag in die endlos scheinende Karawane der Arbeitspendler ein, um wie sie, über die bald renovierte Autobahn zur fernen Arbeitsstelle in die „alten“ Bundesländer zu kutschieren und um freitagabends mit derselben rollenden Heerschar für das Wochenende wieder heim zu seiner Familie zu fahren. Eine Weile nahm er dann den Weg über die noch kurze Zeit bestehende Tschechoslowakei, die Grenzübergänge Seifhennersdorf und Česka Kubice benutzend. Dann, als er eine noch besser bezahlte Arbeit als Monteur gefunden hatte, arbeitete er für eine Firma in Spanien und der Heimkehrrhythmus änderte sich. Er kam nur noch unregelmäßig und oft völlig unangemeldet nach Hause; bald allerdings mit einem neuen „AUDI 80 Turbodiesel“.
Im April desselben Jahres zog in das nun allein von Sonnhild bewachte Haus der Hutungswiese ein Feriengast ein, welcher aus der schönen Welt- und Hansestadt Hamburg ebenfalls als Aufbauhelfer nach Ostsachsen gekommen war. Ich hatte den großen, hageren Mann in meiner Volontärszeit in Hamburg kennengelernt, als ich ein paar Wochen in einer Rechtsanwaltskanzlei am Mittelweg mitarbeitete, weil ich mich mit dem Gedanken trug, selber eine solche in Zittau oder Görlitz zu eröffnen.
Im Rahmen einer abendlichen Veranstaltung der Hamburger Sozialdemokraten hatte mich Rudi J. angesprochen, ob ich nicht kleine oder mittelständische Unternehmen in der Region kennen würde, die Hilfe in Buchhaltung, Computerwesen und Betriebswirtschaft gebrauchen könnten. Er hätte Zeit, kenne sich außerdem auf dem umfangreichen Gebiet der Fördergelder aus, die der westdeutsche Staat im Milliardenumfang für den „Aufschwung-Ost“ auf den Weg brachte und würde außerdem gerne die ihm bisher unbekannten Gebiete Ostdeutschlands, besonders den neuen Freistaat Sachsen, kennenlernen.
Rudolf J. war offensichtlich ein interessierter Mann, dem der übliche überlegene Siegesdünkel, den man bei vielen aus dem Westen Zugereisten beobachten konnte, vollkommen abging. Ich sagte entsprechende Vermittlungsversuche zu, zumal dies, wie er schnell und richtig erkannt hatte, gut in den Rahmen meiner eigenen neuen Tätigkeit hineinpasste. Und als es dann darum ging, wo er wohl in dieser Zeit in der Oberlausitz wohnen könnte, fielen mir natürlich sogleich die brachliegende Zimmervermietungs-Branche im Zittauer Gebirge und meine Nachbarn Peter und Sonnhild I. ein.
So kam es, dass Rudolf J. im Sommer 1991 einer der ersten Sommergäste nach der so genannten Wende im ansonsten ziemlich besucherleeren Kurort Jonsdorf wurde. Mit weitreichenden Folgen, wie sich wenig später herausstellte.