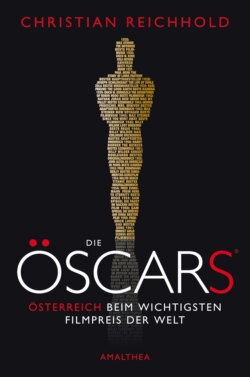Читать книгу Die Öscars® - Christian Reichhold - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MUSIC, MAESTRO, PLEASE!
Оглавление»Ich danke meinen Kollegen Brahms, Bach, Beethoven, Strauss …«
Dimitri Tiomkin, dreifacher Oscar®-Gewinner
Seit 1934 gibt es beim Oscar® einige neue Kategorien. Wurden bei der allerersten Verleihung, wie erwähnt, noch Stummfilmpreise für die besten Zwischentitel vergeben, war mittlerweile der Tonfilm auch in der A.M.P.A.S.® angekommen. Als direktes Resultat wurden nun auch der beste Ton, die beste Musik und das beste Lied gekürt. Und gerade in der Kategorie »Beste Musik« führte in den ersten Jahrzehnten fast kein Weg an den Österreichern in Hollywood vorbei.
Gleich im ersten Jahr gab es eine Nominierung für Max Steiner, der noch unglaubliche 23 weitere folgen sollten. Zwischen 1934 und 1955 gab es nur ein Jahr (1953), in dem der Name Max Steiner nicht auf der Liste möglicher Oscar®-Preisträger stand, in drei Jahren trat er mit jeweils zwei Nominierungen sozusagen sogar gegen sich selbst an.
Geboren wurde Maximilian Raoul Steiner 1888 im Hotel Nordbahn in der Wiener Leopoldstadt, eine Gedenktafel an dem Haus erinnert heute daran. Sein Großvater war Direktor des Theaters an der Wien, Johann Strauß, Jacques Offenbach und Richard Strauss gingen bei seinen Eltern ein und aus, er selbst absolvierte die achtjährige k. u. k. Musikakademie in nur einem Jahr, schloss sie mit 13 ab und lernte bei Gustav Mahler dirigieren. »Mahler hat mir prophezeit, es einmal zum bedeutendsten Komponisten aller Zeiten zu bringen«, erzählte Steiner später lächelnd. »Wenn er geahnt hätte, dass ich es nur bis zu Warner Brothers bringen würde …«
1912, mit 24, übernahm Max Steiner kurzfristig die Leitung des Wiener Ronacher, folgte aber schon bald dem Ruf der Ziegfeld Follies nach New York. Nachdem die großen Filmstudios zu Beginn der Tonfilmära eigene Musikabteilungen gründeten, ging er 1929 nach Hollywood, wo er auch die nächsten 42 Jahre, bis zu seinem Tod, blieb. Neben der Titelsignation der Warner Brothers, die zu Beginn aller Filme des Studios ertönt, schrieb er unter anderem die Musik zu den ersten acht Filmen von Katharine Hepburn, zu fünf Musicals mit Fred Astaire und Ginger Rogers und gleich zu 18 Filmen mit Bette Davis. Insgesamt wirkte Max Steiner im Laufe seiner langen Karriere an mehr als 300 Filmen mit. Mit seinen meist bombastischen Musikthemen, eingespielt von einem 80-Mann-Orchester, war sein Stil wegweisend für die Entwicklung der Musiksprache im noch jungen Medium Tonfilm. Insgesamt drei Mal, 1935, 1943 und 1945, erhielt er dafür den Oscar®. Weil die Bedeutung der Filmmusik von der Akademie in jenen Tagen aber doch noch nicht ganz so hoch eingeschätzt wurde wie heute, gab es für die Gewinner in dieser Kategorie zunächst keine Oscar®-Statuetten, sondern Plaketten. Außerdem wurden die Preise nicht von den Komponisten, sondern von den jeweiligen Leitern der Musikabteilungen entgegengenommen. Und bezeichnend ist wohl auch, dass einige der wichtigsten Arbeiten Max Steiners gar nicht für preiswürdig erachtet wurden. Dazu gehört unter anderem die Musik zu »King Kong« (der Pianist Oscar Levant bezeichnete »King Kong« augenzwinkernd als »eine Symphonie, die von einem Film begleitet wird«), die zu »Casablanca« (diesem Klassiker ist ein eigenes Kapitel gewidmet), vor allem aber die zu dem Welterfolg »Vom Winde verweht« – mit rund drei Stunden die wohl längste Filmmusik der Geschichte. Dabei wollte der Produzent, David O. Selznick, eigentlich nur eine Bearbeitung von klassischen Musikstücken, nichts eigens Komponiertes. Steiner setzte sich aber mit der Idee, Filmmusik als eigene, neue Kunstform zu etablieren, durch. »Vom Winde verweht« gewann letztlich zehn Oscars®, für Max Steiner blieb es bei der Nominierung. Er verlor in jenem Jahr gegen einen anderen Welterfolg: In »Der Zauberer von Oz« sang Judy Garland ihr unvergessliches Lied »Somewhere Over the Rainbow«.
Späte Genugtuung wird Max Steiners Arbeit aber vom American Film Institute (AFI) zuteil. Als man 2005 eine Liste der »Größten Filmmusik-Themen aller Zeiten« erstellte, landete »Vom Winde verweht« auf dem zweiten Platz. Vor »Lawrence von Arabien«, geschlagen nur von »Star Wars«.
Neun Plätze dahinter, auf Platz elf, fand sich der Soundtrack zu »Robin Hood – König der Vagabunden«, der 1939 sehr wohl mit einem Oscar® prämiert wurde. Geschrieben wurde er von Erich Wolfgang Korngold, 1897 in Brünn geboren und neben Steiner der zweite wegweisende Komponist in der Musikabteilung der Warner Brothers.
Bereits drei Jahre zuvor, 1936, hatte er seinen ersten Oscar® gewonnen, begonnen aber hat er noch viel früher: als »Wunderkind« in Wien. Ausgebildet von Robert Fuchs und Alexander von Zemlinsky, schrieb Korngold bereits im zarten Alter von zehn Jahren seine erste Oper: »Gold«. Erichs Vater, Julius Korngold, der gefürchtetste Musikkritiker Wiens, brachte den Klavierauszug des Werks zum damaligen Hofoperndirektor Gustav Mahler, ohne den Komponisten zu nennen. Er sagte nur, die Partitur stamme von einem Zehnjährigen. »Ausgeschlossen«, antwortete ihm Mahler, »da haben Sie sich einen Bären aufbinden lassen.« Drei Jahre später stand Erich, gerade 13 Jahre jung, am Pult des k. u. k. Hofoperntheaters und dirigierte sein Ballett »Der Schneemann«. Mit der Oper »Die tote Stadt« gelang ihm 1920 ein Welterfolg.
1934 folgte Korngold dem Ruf Max Reinhardts in die USA, wo der gefeierte Regisseur seinen ersten und einzigen Hollywoodfilm drehte. »Ein Sommernachtstraum« wurde für Korngold offenbar ein Wintermärchen, zumal er von da an viele Winter in Kalifornien verbrachte, um für den Film zu arbeiten. Die klassischen Themen von so gut wie allen bedeutenden Errol-Flynn-Filmen stammen aus seiner Feder. Korngold sah darin eine Möglichkeit, anspruchsvolle Musik Millionen von Menschen nahezubringen, er erfand die »symphonische Bildpartitur«. Seine kompositorische Tätigkeit begann erst im Projektionsraum mit dem fertig geschnittenen Film, auf den er Musik »nach Maß« machte.
1938 wurde, gegen Ende seines jährlichen USA-Aufenthalts, der »Anschluss« Österreichs vollzogen. »Wir haben uns immer als Wiener gefühlt«, sagte Korngold später, »erst Hitler hat uns zu Juden gemacht.« Er blieb in den USA und nahm 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft an.
Nach dem Krieg arbeitete er wieder abwechselnd in Europa und den USA, im Filmgeschäft allerdings kam sein Stil – anders als der seines Landsmanns Max Steiner – immer mehr aus der Mode.
Im Mai 1957 hielt Steiner die Laudatio zum 60. Geburtstag seines Freundes Korngold, in der er mit ironischem Unterton anmerkte: »Ich kann es gar nicht verstehen, mein lieber Korngold, dass ich in Hollywood nach wie vor so gefragt bin, während nach dir kein Hahn mehr kräht.«
Korngold ging ans Rednerpult und erwiderte: »Schau, lieber Max, das mit dem Erfolg ist ganz einfach. Seit 20 Jahren schreibst du von mir ab, und seit 20 Jahren schreib ich von dir ab. Da darfst du dich nicht wundern, dass du so viel erfolgreicher bist als ich.«
Erich Wolfgang Korngold starb einige Monate danach und liegt in Hollywood begraben. Statt eines Grabsteins ragt eine einzelne Pinie stolz in den Himmel. Die schlichte Grabplatte ziert das Notenzitat »Glück, das mir verblieb« aus seiner Oper »Die tote Stadt«.
Noch einmal zurück zur Liste der »Größten Filmmusik-Themen aller Zeiten«. Da darf natürlich auch der Soundtrack zu »Ben Hur« nicht fehlen, den ein anderer Altösterreicher komponiert hat: der 1907 in Budapest geborene Miklós Rózsa. 1960 mit insgesamt elf Oscars® überhäuft, ist »Ben Hur« – mittlerweile ex-aequo mit »Titanic« und »Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs« – noch immer der erfolgreichste Film der Oscar®-Geschichte. Der Soundtrack ist außerdem eine typische Visitenkarte des akribisch arbeitenden Komponisten. Zwei Jahre lang forschte Rózsa in Musikarchiven auf der ganzen Welt nach passenden Musikelementen, benutzte schließlich griechische, hebräische und orientalische (weil keine römischen überliefert waren) und spielte dann mit einem 100-Mann-Orchester in 72 Studiostunden die Musik ein. Zu diesem gigantischen Aufwand addierte er noch eine neue Studioorgel, denn Miklós Rózsa bestand darauf, die Szenen, in denen Jesus Christus erscheint, mit majestätischen Orgelklängen zu unterstreichen. Und er ließ sich erfolgreich auf Wortgefechte mit den Produzenten ein, die unbedingt das Thema des Weihnachtsliedes »Adeste Fideles« in den Soundtrack eingebaut haben wollten.
Zeitgenossen beschreiben Rózsa wie seine Musik: würdig und majestätisch, aber nicht abgehoben und arrogant. Im Laufe seiner Karriere hat er bei 16 Nominierungen drei Mal einen Oscar® gewonnen. Seine Spezialität waren Monumentalfilme wie »Quo Vadis«, »Spellbound«, »Julius Caesar«, »King of Kings« (nach dessen Kinostart die Bibel in den USA als »Buch zum Film« vermarktet wurde) oder »El Cid«.
Als »Gegenmittel«, wie er einmal sagte, komponierte er zwischendurch aber auch Konzertmusik. Vor allem sein Violinkonzert, das 1953 von Jascha Heifetz uraufgeführt wurde, das Konzert für Klavier und Orchester sowie die Streichquartette gelten mittlerweile als moderne Klassiker.
Billy Wilder gelang es, den Komponisten für »Das Privatleben des Sherlock Holmes« (1970) selbst vor die Kamera zu locken. Miklós Rózsa spielte in dem kurzen Auftritt einen Dirigenten.
Ganz nebenbei unterrichtete der begeisterte Kunstsammler, der wie wenige andere in Hollywood für die Werte der »Alten Welt« stand, außerdem noch Komposition an der Universität, meinte aber: »Eines kann ich den jungen Leuten doch nicht beibringen: wie man in Hollywood einen Job bekommt.«
Wer hätte gedacht, dass auch der Komponist der Arbeiterbewegung, zugleich auch Arnold-Schönberg-Schüler und glühender Marxist, es beinahe zu zwei goldenen, imperialistischen Trophäen gebracht hätte? Tatsächlich war Hanns Eisler zwei Mal, 1944 und 1945, für den Oscar® nominiert – unterlag aber Alfred Newman und Max Steiner.
Hanns Eislers Karriere zählt zweifellos zu den widersprüchlichsten und in ihrer Art doch konsequentesten der Musikgeschichte. Bereits als 19-jähriger Soldat der k.u.k. Armee schrieb er das Oratorium »Gegen den Krieg«, das er später nach den Regeln der Zwölftontechnik umschrieb. Nach den Lehrjahren bei Schönberg ging Hanns Eisler nach Berlin, wo der Philosoph Theodor W. Adorno auf den jungen Komponisten aufmerksam wurde und machte: »Eislers Lieder sind nach Frage und Antwort so außerordentlich, ihr Furor hat solche Kraft, ihre Prägung solche Schärfe, ihr Ton solche existente Substanz, dass nachdrücklich auf sie verwiesen werden muss«, schrieb er. Bald begann Eisler seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Neben proletarischen Kampfliedern schrieb er aber auch die Musik zu Karl Kraus’ Epilog zu »Die letzten Tage der Menschheit«.
Die Flucht vor dem Naziregime führte ihn 1938 in die USA. Da Immigranten jeglicher Kontakt zur kommunistischen Partei verboten war legte sich Hanns Eisler das Pseudonym John Garden zu. Unter diesem Namen führte er anlässlich des 20. Jahrestages der Oktoberrevolution das Lied »Sweet Liberty Land« auf, das zur Hymne der US-Kommunisten wurde. Zwischenzeitlich über Haftbefehl gesucht, weil er seine Aufenthaltsbewilligung nicht hatte verlängern lassen, kam Eisler schließlich nach Hollywood, wo er sich – frei nach dem Motto der Linken »Die ganze Welt hasst Amerika, und ganz Amerika hasst Hollywood« – eigentlich ganz wohl gefühlt haben muss. Hier kam er jedenfalls mit anderen Exilanten zusammen, mit Bertolt Brecht, Theodor W. Adorno, Lion Feuchtwanger, auch mit Thomas Mann und seinem alten Lehrer Arnold Schönberg.
Ständig vom FBI überwacht, wurde Eisler ab 1946 immer wieder verhört und verhaftet, bis er – allen Solidaritätskundgebungen befreundeter Intellektueller, von Albert Einstein über Leonard Bernstein bis Pablo Picasso, zum Trotz – zwei Jahre später schließlich wegen »unamerikanischer Umtriebe« aus den USA ausgewiesen wurde. Über den Umweg Prag landete Eisler auf dem Flughafen Tulln, in der Wiener Schönburggasse stellte die KPÖ ihm zunächst eine Wohnung zur Verfügung.
Bald aber zog es ihn weiter, nach Deutschland, genauer gesagt in die DDR. Die Hanns-Eisler-Komposition »Auferstanden aus Ruinen« wurde 1949 zur offiziellen Hymne des »anderen Deutschland«, er vertonte Gedichte von Kurt Tucholsky, schrieb die Bühnenmusik zu Nestroys »Höllenangst« und sogar den Score zu einem Johannes-Heesters-Film. Als Botschafter der »Akademie der Künste« überbrachte Eisler dem (ebenfalls aus den USA ausgewiesenen) Charles Chaplin die Ernennungsurkunde zum »korrespondierenden Mitglied«. Hanns Eisler war Gründungsmitglied der »Deutschen Hochschule für Musik« und wenige Monate nach dem Bau der Berliner Mauer und vor seinem Tod im Jahr 1962 auch des »Musikrats der DDR«, dessen erster Präsident er wurde.
Seine österreichische Staatsbürgerschaft hat Hanns Eisler bis zum Schluss behalten. Der Liedermacher Wolf Biermann bezeichnete ihn später als seinen Lehrer.
Auch der König der silbernen Operettenära, Robert Stolz (geboren 1880 in Graz), konnte seinem Namen alle Ehre machen und stolz auf zwei Oscar®-Nominierungen zurückblicken: 1945 für die beste Musik in »It Happened Tomorrow« (in dem Jahr verlor er gegen seinen Landsmann Max Steiner), und bereits vier Jahre zuvor, 1941, für den besten Song in »Spring Parade«, der Hollywood-Verfilmung seiner Operette »Frühjahrsparade«, mit dem Kinderstar Deanna Durbin in der Hauptrolle. Robert Stolz war hocherfreut, als die Nominierung bekannt gegeben wurde. Die Gage, die er für die Komposition bekommen hatte, war nämlich längst ausgegeben, und die Reklame somit höchst gelegen – zumal er damals als Dirigent der »Night in Vienna«-Konzerte durch die USA reiste und Konzertsäle füllen musste.
Allerdings waren nicht alle Begegnungen, die der gebürtige Grazer im Zuge seines Aufenthalts in der Filmmetropole hatte, erfreulich. So wurde er beispielsweise dem berüchtigten Komiker W.C. Fields vorgestellt, einem als jähzornig bekannten Misanthropen mit gewaltiger Trinkernase, über den die Presseabteilung seines Filmstudios entschuldigend verlautbaren ließ: »Jemand, der Hunde und kleine Kinder hasst, kann kein ganz schlechter Mensch sein.« Dieser W.C. Fields jedenfalls fuhr hoch, als er erkannte, wer ihm da gegenüberstand, und brüllte Robert Stolz an: »Verdammt! Dann sind Sie also der Unhold, der mich meines Schlafes beraubt und die heilige Ruhe meines Heims gestört hat?« Der Grund für diesen Ausbruch war der Umstand, dass Deanna Durbin damals direkt neben der Villa des Komikers wohnte. Zu dessen zahlreichen Abneigungen gehörte auch und vor allem die gegen Sängerinnen. Vor allem solchen, die in seiner unmittelbaren Nachbarschaft das Singen übten. Und dafür machte er Robert Stolz, der damals ihre erfolgreichsten Schlager komponierte, zumindest mitverantwortlich.
Trotz lukrativer Angebote, in den Vereinigten Staaten zu bleiben, kam Stolz unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Nazidiktatur nach Österreich zurück. Die Nachkriegsvisa des Komponisten und seiner Frau Einzi trugen die Nummern 1 und 2. Als Stolz 1975 hochbetagt starb, ging diese Meldung auch durch die amerikanischen Medien. So populär ist er über all die Jahre dort geblieben.
Stets abseits des Rampenlichts geblieben ist der Komponist Walter Jurmann. Er war einer jener »Unbekannten«, die lieber ihre Arbeit gewürdigt wissen wollten als ihre Person. 1903 in Wien geboren, begann er seine musikalische Karriere im einst mondänen Hotel Panhans am Semmering, ehe er sich aufs Komponieren verlegte.
Mit Beginn des Tonfilms wurden vor allem Opernstars mit kräftigen Stimmen zu Leinwandhelden. Die Geschichten waren meist mehr als dünn, es ging nur darum, die Handlung irgendwie von Lied zu Lied zu führen. Viele dieser frühen Tonfilmschlager wie »Ninon« oder »Oh, Madonna« hat Walter Jurmann für Publikumslieblinge wie Richard Tauber und Jan Kiepura geschrieben, ehe er nach Berlin ging, wo Gassenhauer wie »Mein Gorilla« und natürlich »Veronika, der Lenz ist da« entstanden. Walter Jurmann war wohl eine Art »musikalisches Chamäleon«. Er schrieb französische Chansons (»Le bistro du port«), neapolitanische Volkslieder (»Cosi Cosa«), Südseeweisen (»Love Song of Tahiti«) und Hymnen (»I Give My Heart to America«).
1934 kam er nach Hollywood, wo er die Musik zu Filmen der Marx-Brothers komponierte, er schrieb Soundtracks für die Hollywood-Version des Willi-Forst-Films »Maskerade« (mit Luise Rainer in der Rolle von Paula Wessely) und für »Meuterei auf der Bounty« (gewann 1936 den Oscar® als bester Film des Jahres). Auch »San Francisco« im Jahr darauf wurde für diesen wichtigsten aller Filmpreise nominiert, was aus heutiger Sicht, trotz Clark Gable, Spencer Tracy und Jeanette MacDonald in den Hauptrollen, ein wenig verwundern mag. Laut »Reclams Filmführer« genießt der Streifen aber »in weiten Kreisen einen legendären Ruf, den er wohl nicht zuletzt dem populären Titellied von Walter Jurmann verdankt«. Viele Jahre später, 1984, wurde der Schlager »San Francisco« zum offiziellen »City Song« der Stadt am Golden Gate gekürt. Knapp 50 Jahre davor reichte es gerade einmal für einen Oscar® für den besten Ton. Mitunter macht halt nicht der Ton die Musik, sondern umgekehrt.
Walter Jurmann starb 1971 in der weisen Erkenntnis, dass Komponisten selbst zwar vielleicht vergessen, ihre Melodien aber unsterblich sein würden. Aus Anlass seines 100. Geburtstags wurde in seiner Heimatstadt Wien eine Straße nach ihm benannt. Mittlerweile bemüht sich auch der »Freundeskreis Walter Jurmann« in Los Angeles, Wien und Berlin (dort unter dem Vorsitz des bekannten Entertainers Max Raabe) um eine Renaissance des Komponisten, dem das zurückgezogene Leben mit seiner Frau Yvonne in ihrer gemütlichen Villa in Beverly Hills vermutlich viel mehr bedeutet hat als jede Auszeichnung.
Ohne einen einzigen Erfolg in Hollywood blieb Emmerich Kálmán. Seine größten Operetten wie »Die Csárdásfürstin« oder »Gräfin Mariza« lagen bereits 20 Jahre zurück, als er in die USA emigrieren musste. Dort durchlebte er zwar turbulente Zeiten mit seiner abwechselnd verheirateten und zwischendurch geschiedenen Frau Vera, künstlerisch aber blieb er, abgesehen von einem Musical namens »Miss Underground«, das allerdings nie verfilmt wurde, unproduktiv, und allein schon deshalb von allen Oscar®-Ehren weit entfernt.
Was ihm dennoch Einlass in diese illustre Aufzählung verschafft, ist eine Anekdote, wie Kálmán seinen hoffnungsfrohen Einstand in der Filmmetropole gefeiert haben soll. Die MGM wollte den bekannten Komponisten unter Vertrag nehmen, und Louis B. Mayer fragte ihn, wen er sich denn als Librettisten wünschte: »Wir hätten da zum Beispiel Ihren Landsmann Ladislaus Fodor unter Vertrag«, schlug der Studioboss vor.
»Fodor!«, jauchzte Kalman, »ist meine allergrößte Freund, eine herrliche Schriftsteller, hot geschrieben Welterfolge!«
»Aber«, setzte Mayer fort, »wir hätten da auch noch Ladzi Bush-Fekete.«
»Laddzi!«, jubelte der Komponist. »Also, wir sind wie Brüdär, er ist soooo große Kinstler …!«
»Und dann hätten wir noch den Vadnay.«
»Gitiger Himmäl!«, Kálmán hatte jetzt Tränen in den Augen. »Vadnay, dos ist wie Sohn zu mir, begobt, brillant …!«
»Und schließlich wär da auch noch Lorenz Hart«, schloss Mayer.
»Hart?«, runzelte der Komponist die Stirn. »Hart? Den kenn ich nicht.«
»Also, Meister Kálmán«, fragte Louis B. Mayer, »wen also hätten Sie jetzt gern als Librettisten?«
Emmerich Kálmán dachte lange nach und sagte nach gründlicher Überlegung: »Herrn Hart, bittaschön.«
Als »The most forgotten composer of the 20th century« bezeichnete sich Ernst Toch kurz vor seinem Tod. Dabei hatte auch er 1935, im selben Jahr, als Max Steiner seinen ersten Oscar® gewann, eine erste Nominierung und wurde schon lang davor, vor seiner Emigration in die USA, in einem Atemzug mit Paul Hindemith und Kurt Weill genannt.
Für die Nazis war Ernst Tochs Musik jedoch »entartet«, und so vertrieb man den 1887 in Wien geborenen Komponisten, der allein zwischen 1910 und 1913 vier Mal in Serie den österreichischen Staatspreis gewonnen hatte, ins Ausland. In Großbritannien schrieb Toch zunächst die Musik zu drei Filmen von Alexander Korda, ehe sein Lebensweg ihn weiter nach Amerika führte. In New York lernte er George Gershwin kennen, der ihn nach Hollywood vermittelte. 1935 nahm ihn die Paramount unter Vertrag, die sein Engagement stolz der Presse verkündete: »Mit Ernest Toch ist diese Woche einer der talentiertesten Vertreter moderner Musik nach Hollywood gekommen. Seine Kammermusik und seine symphonischen Dichtungen wurden schon von den bedeutendsten Künstlern und Orchestern der Welt gespielt, dennoch ist der Wechsel zur Filmmusik für Ernest Toch kein Abstieg, er sieht darin vielmehr neue Möglichkeiten für einen modernen Komponisten.«
Und Toch selbst sagte in einem Interview: »So wie die Sprache im Film sich verändert hat, wird sich auch die Musik selbst ändern. In ein paar Jahren wird keiner mehr in die Oper gehen, die ist nur ein Überbleibsel aus einer Zeit, als man noch keine anderen Ausdrucksformen gekannt hat. Der einzige Grund, warum die Oper bis jetzt überlebt hat, ist das unbelehrbare Verhalten vieler Opernbesucher, die sich intellektuell überlegen fühlen wollen.«
Die Euphorie, mit der Ernst Toch an seine Filmarbeit heranging, hielt aber nicht lange. Trotz beachtlicher Leistungen für Leinwanderfolge wie »Peter Ibbetson«, »Der Glöckner von Notre-Dame« oder »Ladies in Retirement«, ein Film, der ihm die zweite von drei Oscar®-Nominierungen einbrachte, fühlte er sich in Hollywood nie so wertgeschätzt wie ein Korngold oder ein Steiner. Dass die Paramount im Vor- und Nachspann seinen Namen stets mit Doktortitel nannte, was höchst selten war und ist, konnte daran auch nichts ändern.
Dr. Ernest, wie er genannt wurde, betrachtete das Komponieren fürs Kino immer mehr als entwürdigende Talentvergeudung zur Bestreitung seines Lebensunterhalts. Bald schon verlegte er sich mehr aufs Unterrichten. Zu seinen Schülern zählten unter anderem die späteren Filmkomponisten Alex North (»Spartacus«, »Cleopatra«) und André Previn. 1957 erhielt er für eine seiner sieben Symphonien den Pulitzer-Preis, 1960 mit dem Grammy die wohl höchste Auszeichnung der Musikbranche, und kurz vor seinem Tod im Jahr 1964 wurde Ernst Toch auch noch das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Das Jüdische Museum in Wien widmete ihm 2010 eine Ausstellung. Unter »most forgotten« stellt man sich also schon etwas anderes vor …
Das trifft wohl eher auf den anderen »Komponistendoktor« zu: Hugo Riesenfeld, der es knapp vor seinem Tod im Jahr 1939 zu einer Oscar®-Nominierung brachte. Seine Berufsbezeichnung lautete damals nicht »Filmkomponist«, sondern »Komponist für Filme«, was einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied macht.
Geboren wurde Hugo Riesenfeld in Wien, wo er auch seine musikalische Laufbahn begann. Später war er unter Gustav Mahler Konzertmeister der Wiener Staatsoper, ehe er 1907 nach Amerika ging, wo er zunächst auch an unterschiedlichsten Opernhäusern engagiert war. Manche Musikerkollegen waren zunächst irritiert über den Neuankömmling, der darauf bestand, zur Violine »Fiddel« zu sagen.
Riesenfelds Filmkarriere begann bereits 1915 am New Yorker Broadway. Wie aber war das möglich, fast 15 Jahre vor dem ersten Tonfilm? Nun, die riesigen Stummfilmpaläste mit weit über 2000 Sitzplätzen leisteten sich in jener Zeit große Orchester, die live zu den stummen Bildern auf der Leinwand spielten. Das Repertoire bestand dabei meist aus mehr oder weniger bereits bekannten Opern- und Operettenmelodien.
Als einer der Ersten begann Hugo Riesenfeld aber, Musik speziell für die laufenden Bilder auf der Leinwand zu komponieren, was ihn in den Augen von Filmhistorikern zu einem der Pioniere der modernen, qualitativ hochwertigen Filmmusik macht. Zudem war er Mitbegründer der Kinothekenmusik, einer thematisch gegliederten Musiksammlung für Stummfilmkinoorchester und -musiker.
Als die Studiobosse hörten, dass allein in die drei New Yorker Riesenfeld-Kinos an die 120.000 Besucher pro Woche strömten, erkannten sie das Potenzial dieser Goldgrube und holten den Komponisten 1923 nach Hollywood, wo er sozusagen »promovierte«. Um seinen symphonischen Dichtungen noch mehr Gewicht zu geben, führte man den ernst dreinblickenden Wiener mit dem Johann-Strauß-Schnurrbart in der Traumfabrik von Anfang an als »Doctor Riesenfeld«. Der hatte als gelernter Österreicher zunächst nichts gegen diesen »geschenkten« Titel, erst Jahre später, als er immer öfter in Filmen als »Doctor Hugo Riesenfeld« genannt wurde, insistierte er bei der PR-Abteilung des Filmstudios: »Ab heute nie wieder ›Doctor‹ Riesenfeld! Ich bin es leid, von jedem in der Kantine gefragt zu werden, was man gegen einen Schnupfen tun kann.«
Auf beachtliche sechs Oscar®-Nominierungen (drei davon allein im Jahr 1944) konnte Hans Julius Salter (1896–1994) am Ende seines langen Lebens zurückblicken.
Er studierte zunächst an der Wiener Musikakademie bei Alban Berg und Felix Weingartner, ehe er Kapellmeister an der Volksoper und später an der Berliner Staatsoper wurde. Bald wurde er vom UFA-Filmpalast am Zoo, dem damals größten Kino Deutschlands, abgeworben, um exakt passende Musiksequenzen zu den Stummfilmen auf der Leinwand zu komponieren und live zu dirigieren. 1930, mit Beginn der Tonfilmzeit, übersiedelte die »Kapelle Hans Salter« vom Kino ins Filmstudio, wo sie bis 1933 Musik zu einem runden Dutzend Filmen einspielte.
Nach Salters Emigration nach Hollywood brachte sein österreichischer Freund Joe Pasternak ihn bei Universal Pictures unter, wo er in den darauffolgenden Jahrzehnten die Soundtracks für um die 450 Filme schrieb, aus Gründen der Studiopolitik und aus Bescheidenheit aber nur bei 150 von ihnen namentlich erwähnt wurde.
Salters Credo: den Film für sich selbst sprechen lassen, und dort, wo Worte nicht ausreichen, mit Musik das ausdrücken, wo die Kunst der Schauspieler endet. Hans J. Salter versorgte auch als einer der ersten Filmkomponisten Regisseure bereits vor Beginn der Dreharbeiten mit Musik. Während der Dreharbeiten wurde die dann eingespielt, damit die Schauspieler sich leichter in die jeweilige Stimmung versetzen konnten. Dieses Playback-Verfahren erwies sich aber letztlich als zu aufwendig (und vor allem als zu teuer) für das Studio und wurde bald wieder eingestellt.
Salter schrieb jedenfalls »Musikteppiche« für Deanna Durbin und John Wayne, für Frank Sinatra und Elvis Presley. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören »Black Friday«, »Dracula’s Son«, »Meuterei am Schlangenfluss« und »Gefrühstückt wird zu Hause«.
Hans J. Salter machte weder viel Aufhebens um seine Person noch um seine Arbeit, die er 1966 in einem Interview in aller Schlichtheit so beschrieb: »Ich frage mich nur, was der Autor und der Regisseur uns mit einer Szene sagen wollten, ob sie zur Unterstützung ein bisschen Musik brauchen, oder ob die nicht eher ein Element der Verwirrung wäre und daher in den Hintergrund gehört.«
Die »Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films« (ja, auch die gibt es in Los Angeles) verlieh Salter 1993 den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. »Man nennt mich jetzt den ›Meister des Horrors‹«, sagte der 97-Jährige vergnügt in seiner Dankesrede, »weil keiner versteht, wie ein freundlicher, guterzogener Wiener sich solche schrecklichen Melodien einfallen lassen konnte.«
Im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand hingegen Fritz Löwe, und das fast sein ganzes Leben lang. Schließlich war sein Vater, Operettentenor Edmund Löwe, kein Geringerer als der erste, der in Franz Lehárs »Die lustige Witwe« in Berlin den Danilo sang.
1901 in Wien geboren, wuchs Fritz im Berliner Theatermilieu auf und schrieb bereits mit 15 den Schlager »Kathrin«, von dem mehr als eine Million Notenexemplare verkauft wurden. 1924 begleitete er seinen Vater auf eine Amerikatournee – und blieb gleich dort. Der Durchbruch kam aber erst Anfang der 1940er-Jahre. Mittlerweile nannte er sich Frederick Loewe (»Loh-uw« ausgesprochen) und bildete gemeinsam mit dem Librettisten Alan Jay Lerner eine der erfolgreichsten Partnerschaften der Musicalgeschichte. Gemeinsam schrieben sie Welterfolge wie »Brigadoon«, »Camelot« oder »My Fair Lady«, wurden allerdings für keinen davon mit einem Oscar® belohnt. Das liegt an den Spielregeln der Akademie. Nur und ausschließlich Originalsongs und Originalscores können ins Oscar®-Rennen geschickt werden, alle genannten Musicals existierten zum Zeitpunkt ihrer Verfilmung aber bereits in Bühnenfassungen und waren somit ausgeschlossen.
Nur selten schrieb das Duo Loewe/Lerner direkt für Hollywood. Bei »Gigi« zum Beispiel drehten sie den Spieß aber um, machten zuerst eine Filmfassung und adaptierten die dann später für die Bühne. Das Ergebnis war beeindruckend. »Gigi« räumte 1958 neun Oscars® plus einen Ehren-Oscar® für Maurice Chevalier ab. Einer der Preise, jener für das Titellied, ging an Alan Jay Lerner und Frederick Loewe. Der kam, nach einem Infarkt mit anschließender Herzoperation gesundheitlich noch angeschlagen, langsamen Schrittes auf die Bühne und sagte: »Ich möchte Ihnen aus der Tiefe meines angebrochenen Herzens danken.« Die Euphorie war so groß, dass die Telephonistinnen des Filmstudios angewiesen wurden, sich mit »M-Gigi-M« zu melden.
Die Gagen für die Stars waren damals so großzügig, dass viele von ihnen gar nicht wussten, wohin mit dem vielen Geld. Als Loewe und Lerner einmal nach einem Mittagessen bei einem Autohändler vorbeikamen, stand dort das neueste Rolls-Royce-Modell in der Auslage. Beide zeigten daran Interesse, bis der Verkäufer dezent darauf hinweisen musste, dass es sich bei dem Wagen um ein Einzelstück handelte. Darauf ließ einer dem anderen den Vortritt beim Kauf. Als das auch zu keinem Ergebnis führte beschloss Loewe, seinem Partner den Wagen zu schenken.
»Nein, ich schenke ihn dir«, erwiderte Lerner.
»Nein, ich dir«, entgegnete Loewe.
Und so ging es weiter, bis Loewe schließlich sagte: »Schluss jetzt, ich schenke dir den Rolls – und keine Widerrede! Du hast eh schon fürs Mittagessen gezahlt.«
Noch einmal, 1974, bekam er eine Oscar®-Nominierung, allerdings für die vergleichsweise schwache Musik zu »Der kleine Prinz«. Danach zog sich Frederick Loewe, der sich seinen Traum, so etwas wie eine amerikanische »Fledermaus« zu komponieren, mit »My Fair Lady« längst erfüllt hatte, auf sein riesiges Anwesen in Palm Springs zurück, wo er 1988 starb.
Ein Oscar® und drei Nominierungen, nebst Golden Globe und Grammys ist die beachtliche Ausbeute von Ernst Siegmund Goldner, besser bekannt als Ernest Gold.
1921 in Wien geboren, musste er das Wasagymnasium abbrechen, um sein Leben zu retten. Als 17-jähriger Neuankömmling in Amerika hielt er bereits mit Kompositionen seine Familie über Wasser. Als sein Klavierkonzert in der New Yorker Carnegie Hall aufgeführt wurde, bezeichnete es ein Kritiker verächtlich als »Filmmusik«. Das und seine Verehrung für Max Steiner brachten ihn 1945 nach Hollywood, wo man Ernest Gold zunächst nicht viel zutraute, wie er später sagte: »In den ersten 13 Jahren habe ich in Hollywood nur kleine, unbedeutende und wohl auch die schlechtesten Filme bekommen … Ich habe orchestriert und komponiert und fühlte mich wie eine Jukebox, in die man Geld reinwirft und aus der Musik herauskommt.« Erst seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur und Produzenten Stanley Kramer, dessen »Hauskomponist« er wurde, brachte die Wende. Ernest Gold schrieb die Musik zu Filmen wie »On the Beach«, »Das Urteil von Nürnberg«, »Eine total, total verrückte Welt« und »Das Narrenschiff«.
Seinen größten Erfolg aber feierte er mit einem anderen Regisseur: mit dem Österreicher Otto Preminger, der ihn für sein Monumentalepos »Exodus« engagierte. Der Soundtrack gewann 1961 den Oscar®, und die Titelmelodie wurde vielfach interpretiert, von so unterschiedlichen Künstlerinnen wie Connie Francis, Édith Piaf oder Angelika Milster.
In den 1980er-Jahren, als der Stil der Filme sich abermals stark wandelte, zog Ernest Gold in den Vorstand der amerikanischen Filmakademie ein. Er konnte sich vor seinem Tod 1999 noch über den Hitparadenerfolg seines Sohnes Andrew freuen, der mit »Thank You for Being a Friend« das Titellied zur US-TV-Sitcom »Golden Girls« geschrieben hatte und so an die Familientradition anknüpfte.
Ganz nah an einem, nein, an drei Oscars®, ist Anfang der 1960er-Jahre auch der Wiener Entertainer Günther Frank (geboren 1936) vorbeigeschrammt. Er gab damals (wie heute) regelmäßig Gastspiele in den USA und trat unter anderem auch im legendären New Yorker Nobelhotel Waldorf Astoria auf. Dort begleitete ihn ein alter Akkordeonspieler im beinahe ebenso alten Smoking, und dieser »Herr Max« bat ihn in unverkennbarem Wiener Dialekt: »Gehn S’, Herr Frank, Sie haben so a scheene Stimm’. Möchten S’ nicht amal was von mein’ Buben singen? Er schreibt so scheene Sachen, is der jüngste Student in der Juilliard-Musikschule. Ich hab a Riesenfreud’ mit ihm. Wenn S’ wollen, ich tät Sie gern mit meinem Martin zusammenbringen, er is ja erst 17, er kennt ja noch niemand in dem G’schäft … Schaun S’, vielleicht g’fallt Ihnen was. Er hat da a Lied g’schrieben, das wär genau das richtige für Sie: ›The Travelin’ Man‹. Das könnten S’ doch auf Platte aufnehmen, es tät Sie nix kosten.«
Günther Frank versprach Herrn Max natürlich in klassischer Wiener »Na, schau ma amal, denn werd’n ma schon seh’n«-Mentalität, sich mit seinem Sohn zusammenzusetzen, und beinah ebenso natürlich hat er es dann nie getan.
Das tat stattdessen Liza Minnelli, die den Song unter dem Titel »The Travelin’ Life« auf ihrem Debütalbum einspielte. »Der Bub« wurde bekannt als Marvin Hamlisch, kassierte, gerade einmal 29 Jahre jung, allein in der Oscar®-Nacht 1974 drei Oscars® und gilt als einer der meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts.
1944 als Sohn jüdischer Emigranten aus Wien in New York geboren, bekam er seine erste Chance schließlich von einem anderen Österreicher, vom Produzenten Sam Spiegel, von dem hier später noch die Rede sein wird. Spiegel engagierte Marvin als Klavierspieler für seine Partys. Auf einer dieser Partys lernte Marvin Hamlisch Barbra Streisand kennen (deren Großeltern väterlicherseits auch aus Österreich stammen). Sie engagierte ihn als Probepianist für »Funny Girl«. Streisand verkörperte darin den einstigen Broadwaystar Fanny Brice, jene Rolle, die ihr später einen Oscar® als beste Schauspielerin einbringen sollte.
Marvin Hamlisch schrieb in den folgenden Jahren die Musik zu Filmen wie »Der Clou«, »James Bond – Der Spion, der mich liebte« oder »Sophies Entscheidung«, um nur drei zu nennen. Für sein Musical »A Chorus Line« gewann er 1975 den Pulitzer-Preis. Als diese Show in den 1980er-Jahren in Wien aufgeführt wurde, reiste der Komponist in die Heimatstadt seiner Eltern, wo er sich in wunderbarem Wienerisch mit amerikanischem Akzent für eine Ehrung bedankte, die der damalige Bürgermeister Helmut Zilk ihm zuteil werden ließ.
Als Marvin Hamlisch 2012 starb, gingen am Broadway für eine Trauerminute lang die Lichter aus. Bei der Gedenkfeier für den Komponisten traten Liza Minnelli, Aretha Franklin und Barbra Streisand auf, und die Streisand sang auch bei der Oscar®-Verleihung im Jahr darauf ihrem verstorbenen Freund zu Ehren »The Way We Were«, eine seiner schönsten Kompositionen.
An die Glanzzeit der österreichischen Filmkomponisten in Hollywood erinnert heute der »Max Steiner Award«, der seit 2009 von der Stadt Wien im Rahmen der jährlich stattfindenden »Hollywood in Vienna«-Gala im Wiener Konzerthaus vergeben wird. Namhafte Musiker wie John Barry (»James Bond«, »Out of Africa«), Alan Silvestri (»Forrest Gump«, »Lara Croft«), Lalo Schifrin (»Mission Impossible«, »Bullitt«), Randy Newman (»Toy Story«, »Monk«) oder James Newton Howard (»King Kong«, »The Dark Knight«) zählen zu den bisherigen Preisträgern. So unterschiedlich die Musikstile sind, die sie vertreten, eines haben diese Künstler doch alle gemeinsam: Tränen der Rührung, wenn sie ihre Auszeichnung in Wien entgegennehmen. Nicht, dass diese vielfachen Oscar®- und Grammy-Preisträger nicht an Ehrungen gewöhnt wären, aber es ist (und da sind sie sich einig) doch etwas Besonderes, sie von jener Stadt zu bekommen, wo alle großen Komponisten gelebt und gearbeitet haben und ohne die auch die Filmmusik der Gegenwart nicht denkbar wäre.
»Würden Mozart und Beethoven heute komponieren, sie würden für den Film schreiben«, ist beispielsweise Randy Newman sich sicher. Und wenn am Ende jeder »Hollywood in Vienna«-Gala Max Steiners gewaltige Titelmelodie zu »Vom Winde verweht« erklingt, bekommen nicht nur die Preisträger feuchte Augen.