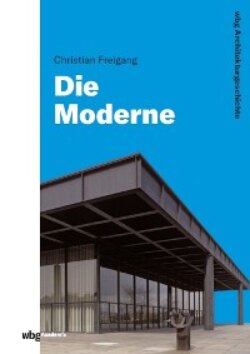Читать книгу WBG Architekturgeschichte – Die Moderne (1800 bis heute) - Christian Freigang - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Industrialisierung der Architektur
Materialien und Technologien
ОглавлениеIn der Tat bildeten technische Entwicklungen eine der wesentlichen, unabdingbaren Voraussetzungen für die radikalen Veränderungen in der Geschichte der Architektur während des 19. Jh.s. Hierbei sind vor allem die massenhafte Verwendung von Metall, speziell Eisen und Stahl, sowie die Technik des Stahlbetons von entscheidender Bedeutung, die die Bauformen genauso betreffen wie die Produktionsweisen und grundsätzlichen Auffassungen von Architektur. Aus solchen Gründen ist die Geschichte der modernen Architektur früher gerne als eine Reaktion auf technologische Entwicklungen dargestellt worden. Das ist zwar etwas einseitig, doch müssen zum Verständnis des Bauens seit etwa 1850 die grundsätzlichen Merkmale der Eisen/Stahl- wie der Betonkonstruktion benannt werden, welche die traditionellen Bauweisen in Stein, Backstein und Holz ersetzten. Bei der Eisenarchitektur bildet ein Metallskelett das konstruktive Grundgerüst, das etwa mit Backstein oder Glas ausgefacht oder mit verschiedenen Materialien verkleidet wird oder auch für sich stehen kann (Brückenbau, Eiffelturm, □ 15). Im Unterschied zum Steinbau entsteht ein Gebäude nicht durch allmähliches Aufschichten, sondern durch die Montage von industriell und vorab produzierten, vorwiegend Zugspannungen aufnehmenden Standardelementen (|▶ 9|, □ 1). Deren Produktion war erst seit der Zeit um 1800 möglich. Zwar gab es schon in Antike und Mittelalter handgeschmiedete Eisenklammern und Anker, doch waren diese nicht standardisiert und exakt berechenbar herzustellen. Roheisen, das Primärprodukt beim Schmelzen von Eisenerzen und dem Reduktionsmittel Koks oder Kohle, konnte zwar in Standardformen gegossen werden, war aber wegen seiner Sprödigkeit nur wenig auf Zugspannung zu belasten. Erst die Reduzierung des im Roheisen enthaltenen Kohlenstoffs (von 2, 5–4 % auf unter 1, 7 %) ermöglichte die Herstellung von schmiede- und vor allem walzbarem Stahl. Dies geschah seit 1776 durch das Puddelverfahren, bei dem hoch erhitzte Luft in das flüssige, ständig umgerührte Roheisen geblasen wurde. Seit Mitte des 19. Jh.s konnte mit der Entwicklung der Bessemerbirne die Stahlproduktion nochmals verbessert werden. Für die Stahlproduktion in industriellem Maßstab war also das Vorkommen von Eisenerzen und Kohle, zudem aber von Holz als Brennmaterial wichtig. Ebenso entscheidend war aber auch die Entwicklung von Walzverfahren seit dem späten 18. Jh., mit deren Hilfe gleichsam endlose Eisenprofile in gleichmäßiger Qualität produziert werden konnten. Die T-, I- und Doppel-T-Walzprofile bilden die Grundelemente der meisten historischen Stahlbauten. Diese Profilierungen verhindern bei weitgehender Material- und Gewichtsreduktion Belastungsverformungen, sie bieten aber auch genügend gerade Flächen zur einfachen Anbringung weiterer Trägereinheiten. Dies wurde bis in die erste Hälfte des 20. Jh.s mit Nieten oder Schrauben bewerkstelligt. Für diese mussten sämtliche Löcher schon vor der Montage exakt berechnet und gebohrt sein (□ vgl. 1). Seit ca. 1930 kam auch das Lichtbogenschweißverfahren auf den Baustellen zum Einsatz. Bei dem zuvor meist angewandten Gasschmelzschweißverfahren wurden die Nähte temporär so geschwächt, dass sein Einsatz am Bau nicht möglich war. – Stahl als Baumaterial ist verhältnismäßig leicht, doch kann er industriell in Standardformen vorgefertigt und auch über weite Strecken transportiert werden. Zur Montage sind oftmals keine gesonderten Gerüste vonnöten, der Bau scheint gleichsam von selbst zu wachsen. Die hervorragenden Trägereigenschaften erlauben kühne, weitspannende Konstruktionen. Allerdings schwindet die Stabilität bei großer Hitze rapide, weswegen es im 19. Jh. immer wieder zu spektakulären Brandkatastrophen kam, bei denen die Stahlskelette weich wurden und in sich zusammensackten. Überdies eignet Eisen und Stahl als Baumaterialien nicht nur eine ‚schmutzige‘, rostende bzw. banale Oberfläche, den Skelettkonstruktionen fehlt auch die Körperlichkeit und plastische Kraft, die in der Auffassung des 19. Jh.s die essentiellen Kriterien waren, um eine künstlerisch wirksame, vom Licht modellierte Außenhülle zu kreieren |▶ 9|. Die frühe Kritik an der Eisenkonstruktion betraf aber auch ihre markante Technizität und die scheinbare Auflösung der Gattungsgrenzen (vgl. S. 36 und □ 15). Ein ausgiebiger und komplizierter Rechenprozess mit zahlreichen Parametern stand am Anfang des Entwurfs, nicht mehr eine künstlerische Idee. Zudem war das Grundmaterial der gewalzten Stahlprofile mit demjenigen von banalen technischen Apparaturen identisch: Eisenträger und Eisenbahnschienen sind grundsätzlich dasselbe |▶ 10|.
□ 1 Walzprofile und Nietverbindungen einer Eisenkonstruktion (Markthalle in Breslau von R. Plüddemann, E. 19. Jh.)
Diese mangelnde Körperlichkeit hat die Betonkonstruktion nicht, die heute die am häufigsten angewandte Bautechnik ist (ital. cimento armato oder calcestruzzo armato; franz. béton armé; engl. concrete). Es handelt sich um eine Verbundbautechnik, bei der die Vorteile des auf Druck belastbaren (Kunst)Steins mit denjenigen der auf Zug belastbaren Stahlkonstruktion miteinander kombiniert werden. Das Eisen wird als innere Bewehrung innerhalb eines vielfältig formbaren Gemenges von Bindemitteln (Zement) und Zuschlagstoffen (Kiesel, Bims etc.) verwendet. Diese werden, mit Wasser vermischt, in flüssigem Zustand in vorab erstellte Negativformen der Konstruktion, die sog. Schalung gegossen oder gar gespritzt. Das Wasser wird in der entstehenden Hydratisierung gebunden, der gelöschte Kalk härtet unter Sauerstoffaufnahme aus, so dass insgesamt ein Kunststein entsteht, der innen armiert ist. Eisen/Stahl und die Zementmasse verbinden sich innig miteinander und weisen überdies denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten auf, so dass sie bei Temperaturschwankungen identisch reagieren. Erfunden wurde die Technik in der Mitte des 19. Jh.s (François Coignet, Joseph Lambot, Joseph Monier), und zwar zunächst zur Herstellung von Kübeln und Boten, in deren Zementwände Drahtgitter eingelegt waren. Seit dem Ende des Jahrhunderts wurde die Technik in zahlreichen Abwandlungen weiterentwickelt, bald entstanden weltweit agierende Betonunternehmen wie François Hennebique, Wayss & Freytag u.a. Meist handelte es sich bei den Bauten um fachwerkartige Skelettkonstruktionen aus geraden Balken, die aus einfachen Verschalungen mithilfe von Brettern entstanden (□ 2, |▶ 25|). Der Betonbau hat viele Vorteile, denn außer seiner Trag- und Bruchfestigkeit sowie seiner Härte ist er absolut feuersicher. Er kann schnell und höchst wirtschaftlich errichtet werden, hat zudem eine lange Lebensdauer bei insgesamt geringem Pflegeaufwand. Zudem können mit ihm standardisierte Einzelteile hergestellt werden, etwa Decken- und Balkenplatten, Hohlsteine, Wabenformen, Gewölbeelemente usw. Vor allem aber handelt es sich ästhetisch um einen plastisch-körperlichen Baustoff, der sogar nachträglich auf der Oberfläche bearbeitet werden kann. Je nach Zuschlägen können auch Farbigkeit und Musterung reichhaltig variiert werden, aufgrund des Grundstoffes Zement hat er aber eine grundsätzlich graue Tönung. Die Formen des Kunststeins sind wesentlich von den Schalungsformen abhängig. Diese selbst können prinzipiell sehr variabel sein, denn sie sind konstruktiv nicht wirksam |▶ 29, 39, 45|. Die aus ihnen gebildete Positivkonstruktion bildet indessen eine monolithische Einheit, die in sich stabil und weder geschichtet noch montiert ist. All das ist präzise vorherberechenbar und entsprechend optimierbar. Beim Spannbeton, insbesondere für weit spannende Balken angewandt, werden die Zugspannungen der Armierung vor dem Verguss simuliert, um eine ideale Position der Stahlkerne zu garantieren. Ähnlich wie im Fall der Eisen- und Stahlkonstruktionen eignet dem Beton eine breite Einsetzbarkeit, denn er wird im Tief- wie im Hochbau eingesetzt. Da er im 19. Jh. lange für banale Konstruktionen verwendet wurde und die Grundfarbe Grau mit lebloser Neutralität assoziiert wird, haftete dem Beton lange der Makel des Unkünstlerischen an |▶ 25|. Vor allem aber gibt es keine natürlich sich aus dem Beton ergebende konstruktive Urform (wie etwa die aus Baumstämmen gefertigte Blockhütte), so dass es schwierig ist, eine ‚richtige‘, weil konsequent materialgerechte Betonkonstruktion zu benennen.
□ 2 Schema eines Betontragewerks nach F. Hennebique (um 1900)