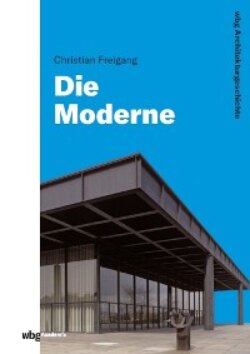Читать книгу WBG Architekturgeschichte – Die Moderne (1800 bis heute) - Christian Freigang - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Einleitung Geschichte der Geschichten der Architektur
1800–2000
ОглавлениеDie Architekturgeschichte des 19. und 20. Jh.s hat lange gebraucht, bevor sie sich selbst historisch reflektierte. Das lag daran, dass noch bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts das 19. Jh. als die Epoche der Dekadenz, der beliebigen Vielfalt und des lügnerischen Prunks galt und die Kontrastfolie für die Avantgarden seit dem Anfang des 20. Jh.s bildete. Einer solch negativ verorteten Epoche konnte kaum die Ehre einer profunden historischen Darstellung angetan werden. Auch für konservative Kunsthistoriker blieb lange die Architekturmoderne des 20. Jh.s fremd, ja sie unterlag weiterhin der populären Verdammung, die ihr seit den 20er Jahren entgegen gebracht wurde und die auch nach 1945 – trotz ihrer allgemeinen Rehabilitation in der Bundesrepublik als anti-nationalsozialistisches, demokratisches Bauen – vielfach weiterbestand. Diese Verurteilung galt ebenso im Osten Deutschlands, wo bis in die 60er Jahre die ‚westliche‘ Moderne als imperialistisch kritisiert werden konnte. – So ist es nicht unverständlich, dass es lange nur vereinzelte historische Gesamtdarstellungen gibt. Immerhin erschien 1915 und 1917 im „Handbuch der Kunstwissenschaft“ eine sehr knappe, expressionistisch-volkspsychologisch argumentierende Darstellung der Zeit ab 1800 (Griesbach 1915, Burger 1917). Gustav Adolf Platz veröffentlichte schon 1927 eine detaillierte Gesamtdarstellung der Architekturgeschichte seit 1900 als Ergänzungsband der „Propyläen-Kunstgeschichte“ (Platz 1927), ließ aber bezeichnenderweise das 19. Jh. aus. Den eigentlichen Ausgangspunkt der Geschichtsschreibung des Bauens des 19. und 20. Jh.s bildete Nikolaus Pevsners „Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius“ von 1936 (Pevsner 1936), 1949 neu unter dem Titel „Pioneers of Modern Design“ herausgegeben. Die englische Arts-and-Crafts-Bewegung wurde hier zusammen mit der Industrialisierung zum Generator eines neuen zeitgenössischen Stils. Pevsner schrieb als Kunsthistoriker, der seine eigene Gegenwart – die Studien zu dem Buch entstanden schon vor seiner Emigration aus Deutschland nach England – historisch ‚ableiten’ wollte. Das ist insofern bemerkenswert, als Berufskollegen wie Hermann Beenken und Hans Sedlmayr zur selben Zeit dem 19. Jh. insbesondere mangelnde Einheit und Größe attestierten – mit dekadentistischer, nationalsozialistisch gefärbter Note.
Im Weiteren entstanden historische Gesamtdarstellungen, die aus den Blickwinkeln von Protagonisten der Moderne verfasst waren. Für mehrere Jahrzehnte wurde Sigfried Giedions „Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition“ (Giedion 1941), 1941 in den USA erstveröffentlicht, zur Bibel sämtlicher Architekturstudenten. Die Moderne hatte sich hiermit eine historische Legitimation gegeben, erschien nicht weiter wie in den Avantgardediskursen der 20er Jahren als der deus ex machina zur Erneuerung des Bauens. Diese fast zwanghafte Traditionsbildung wird vor allem daran deutlich, dass Giedion die Entwicklung der Architektur eng mit derjenigen der Malerei parallelführt und daraus eine notwendige Entwicklung insbesondere zu den Architektursprachen von Le Corbusier und Alvar Aalto ableitet. Bruno Zevi, als Architekturkritiker ebenfalls engstens in die Diskurse um eine aktuelle ‚organische Architektur’ involviert, legte 1950 eine detaillierte Gesamtdarstellung vor (Zevi 1950), in der als Star nunmehr Erich Mendelsohn auftrat. Henry-Russell Hitchcocks Überschau über das 19. und 20. Jh. von 1958, eigentlich eine etwas eintönige Geschichte von stilistischen Filiationen (Hitchcock 1958), stellte zum ersten Mal die Bedeutung der USA heraus. Wenig später las Reyner Banham, auch er intensiv in der damals aktuellen Diskussion um den Brutalismus engagiert, in „Theory and Design in the First Machine Age“ (Banham 1960) die Moderne als Geschichte ihrer technischen Herausforderungen. Die bis heute anspruchsvollsten Überschauen bieten Leonardo Benevolo (Benevolo 1960) sowie Manfredo Tafuri und Francesco Dal Co (Tafuri/Dal Co 1967), jener wegen der Umfassendheit, mit der auch der Städtebau einbezogen ist, diese aufgrund ihrer methodischen Perspektivierung. Die Architekturgeschichte des 19. und 20. Jh.s wird hier in marxistischer Perspektive in Bezug auf das Kapital und die Produktionsbedingungen dargestellt und daraus Kritik an einer Moderne abgeleitet, die sich dieser gesellschaftlichen und politischen Bezüge nicht immer klar war. Unter den Überschauen seit den 80er Jahren (Frampton 1980, Colquhoun 2002) wendet sich insbesondere die globale Architekturgeschichte von Spiro Kostof (Kostof 1985), von der sich der dritte Band dem 19. und 20. Jh. widmet, in gewisser Weise von einer Erfolgsgeschichte der großen Namen ab, um dagegen auch unspektakuläre soziologische und urbanistische Entwicklungen ins Feld zu führen. Derartige Kontextualisierungen finden sich auch in den jüngsten Überblicken über das 19. Jh. (Bergdoll 2000) und das 20. Jh. (Cohen 2012), wo die Architekturgeschichte mit der Veränderung von Wahrnehmungsweisen und Weltdeutungen bzw. von Mentalitäten zusammengeführt ist. Seit kurzer Zeit ist zu Recht auch die jüngere Vergangenheit – die Architektur der 1960er und 70er Jahre – in den Blickwinkel der historischen Erforschung gerückt worden. Der folgende Extrakt aus einer Architekturgeschichte im betreffenden Zeitraum muss selektiv verfahren: ‚Große Erzählungen’ oder gar der Versuch, ungebrochen fließende Entwicklungsströme nachzuzeichnen, sind verdächtig bzw. unmöglich geworden. Gemäß dem Untertitel des Buches sollen aber – implizit gesetzte – Akzente auf die Kriterien des künstlerischen Status von Bauwerken und ihrer Wahrnehmung sowie der technologischen und soziologischen Bedingungen gelegt werden. Bewusst ist die Geschichte der Architekturtheorie in einem eigenen Kapitel (vgl. S. 79–98) skizziert: Wenngleich sie auch vielfältig in die Praxis der baulichen Gestaltung verwoben ist, so geht es in diesem Buch doch nicht darum, Architekturgeschichte primär auf ihren gedanklichen Konzeptualisierungen aufzubauen, sondern konkrete Realisierungen in den Vordergrund zu stellen.