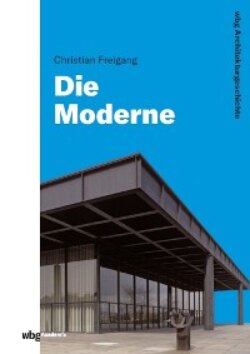Читать книгу WBG Architekturgeschichte – Die Moderne (1800 bis heute) - Christian Freigang - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorbemerkung zur Neuauflage
Überblickswerke haben Ü selbst wenn dies im Zeichen der Nachmoderne anachronistische Züge zeigen kann – immer etwas mit Kanonisierung zu tun: Ein bestimmter Blick auf einen Gegenstand soll in praktische, lehrreiche, informative, hoffentlich originelle Form gegossen werden. Die Autoren dieser Buchreihe waren sich dieser Herausforderung schon 2013 bei der ersten Auflage bewusst. Die Nachfrage hat aber gezeigt, dass durchaus Interesse und Bedarf an diesem Versuch besteht, einen bestimmten, individuellen Zugang zu über 1000 Jahren Architekturgeschichte zu eröffnen. Wir freuen uns daher, wenn diese Sonderausgabe der anhaltenden Nachfrage entgegenkommt.
Berlin, Chapel Hill und Darmstadt 2018
Vorwort des Herausgebers
Die WBG Architekturgeschichte umfasst drei Bände und erläutert kompakt die bedeutendsten Entwicklungen, Hauptthemen und wesentliche Schlüsselwerke des Bauens ab ca. 800 bis heute in Europa und ausgewählten weiteren Gebieten. Der erste Band („Klöster – Kathedralen – Burgen“) umfasst das Mittelalter bis ca. 1500, der zweite („Ordnung – Erfindung – Repräsentation“) behandelt die Architektur der Neuzeit von 1450 bis 1800, also Renaissance und Barock, der dritte ist einer ‚langen’ Moderne, also der Epoche von der Französischen Revolution bis heute, gewidmet („Baukunst – Technik – Gesellschaft“). Die Epochenschwellen – um 1500 bzw. um 1800 – folgen einer lange bestehenden und gut begründeten Einteilung der europäischen Architekturgeschichte: Vor der Neuentdeckung der antiken Säulengrammatik, dem sog. Vitruvianismus, im 15. Jahrhundert und vor der gleichzeitigen Erfindung des massenhaften Bilddrucks war das Bauen grundsätzlich anders: eine virtuos gehandhabte Technik im Dienst von Liturgie und Ritual, Verteidigung und Verkehr. Danach, im vitruvianischen Zeitalter, wurde das Bauen zu einer rhetorisch-künstlerischen Sprache, die vermittels eines universellen Kanons verstanden und bewertet sein wollte. Dies wiederum änderte sich seit 1800 in grundlegender Weise: Architektur sollte nunmehr (auch) unmittelbar wirken oder aber vielfältig ältere Stile abrufen oder neue Bautechniken gestalterisch steigern; der Vitruvianismus unterliegt seither einer grundlegenden Verdammung oder zumindest Revision.
In jedem Band bildet die exemplarische Darstellung von jeweils 50 besonders signifikant erscheinenden, realisierten und erhaltenen Ensembles den Schwerpunkt. Das stellt sicherlich eine knappe Auswahl berühmter und auch weniger bekannter Bauten dar, ein kleiner Ausschnitt aus der immensen Geschichte des Bauens. Doch geht es darum, die faszinierende Vielzahl der Kriterien, aus denen Architektur entstanden ist und entsteht, an konkreten Gebäuden, weniger an theoretischen Entwürfen, zu erfahren. Bauen heißt im Gegensatz zu den anderen Künsten immer, in die Erde einzugreifen, mit der Schwere der Materialien richtig umzugehen, auf gesellschaftliche und politische Gegebenheiten zu reagieren und nicht zuletzt: omnipräsent zu sein, unübersehbar, wunderschön oder auch störend und beunruhigend, der Pflege wie der Kommentierung bedürftig. Das ist die Besonderheit von Architektur als kulturellem Faktor, und deswegen bilden hier hauptsächlich konkrete Bauten den Ausgangspunkt, Bauten, an denen beispielhaft größere und theoretische Zusammenhänge erläutert werden: Was etwa sind die Vorteile des Spitzbogens, warum benötigt ein Herrscher ein Schloss, kann und soll Architektur ‚sprechen’, in welchem Zusammenhang können Philosophie und Architektur stehen?
Die Beschreibung der Schlüsselwerke folgt prinzipiell einer chronologischen Ordnung, ohne dass beabsichtigt ist, hier eine kontinuierliche Entwicklungsgeschichte in allen Verästelungen vorzulegen. Deren Grundzüge sind gleichwohl in einem eigenen Kapitel ausgeführt, ebenso wie Erläuterungen zu essentiellen Themen der Architekturtheorie sowie zur Entwicklung der Erforschung der Architekturgeschichte. Wichtige Einzelthemen, zum Beispiel zur Bautechnik, den Säulenordnungen, der Architektenausbildung, zu Baugattungen und Vermittlungsmedien, sind in separaten Themenblöcken dargestellt. Querverweise sorgen dafür, dass sich die Kenntnisse vertiefen und erweitern lassen. Die Texte können also auch auswahlweise und springend gelesen werden. Literaturverweise ermöglichen es, Weiteres zu den Themen in Erfahrung zu bringen. Zeittafel und Register tragen zur praktischen Benutzbarkeit der Bände bei.
Die Absicht der Autoren, allesamt Hochschullehrer im Bereich der Architekturgeschichte, ist es, nicht Altbekanntes vorzutragen, sondern neuere Erkenntnisse in ihre Texte einfließen zu lassen. Insofern beansprucht die WBG Architekturgeschichte, ein faszinierendes Thema aktuell und angemessen übergreifend zu überblicken: intensiv, ohne zu überborden; vielfältig, ohne beliebig zu sein; unterhaltsam, ohne ins Oberflächliche zu gleiten; originell, ohne Einseitigkeit zu forcieren; didaktisch, ohne belehrend zu wirken. Sie wendet sich an alle, die an der Geschichte der Architektur interessiert sind oder beruflich mit ihr zu tun haben.
Berlin, im Mai 2013
Christian Freigang