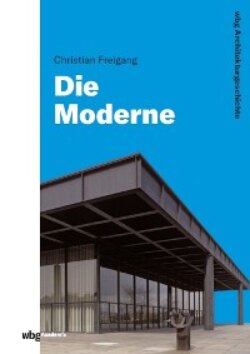Читать книгу WBG Architekturgeschichte – Die Moderne (1800 bis heute) - Christian Freigang - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Architektur und Emotionen
Wahrnehmungskriterien der Architektur
ОглавлениеDie Geschichte der modernen Architektur ist unter vielen Blickwinkeln beschrieben worden: als Überwindung einer moralisch bedenklichen Dekorationsarchitektur in Richtung auf eine ‚wahre‘ Baukunst, als Umsetzung neu entwickelter Techniken und Produktionsverfahren (vgl. S. 11f.) oder als Erfüllung sozialer Aufgaben. Bis vor kurzem wurde kaum beachtet, dass Architektur, gerade in dem hier behandelten Zeitraum, auch die Aufgabe hat, in verschiedenster Weise auf Gemüt und Psyche zu wirken. Architektur nimmt insofern Einfluss auf eine in Öffentlichkeit agierende und kommunizierende Gesellschaft. Dies setzt schon im 18. Jh. ein, als wirkungsästhetische Ziele aus der Gartenkunst auf das Bauen übertragen werden. Insbesondere die Theorieentwürfe von Germain Boffrand, Jacques François Blondel und Nicolas Le Camus de Mézières ordnen der Architektur psychologische Wirksamkeit – zwischen den Gefühlen von Freude, Ernsthaftigkeit, Trauer, Schrecken und Erschaudern – zu. Daran knüpft unmittelbar Étienne-Louis Boullée am Ende des 18. Jh.s mit seinen Entwürfen an (von Engelberg 2013, S. 323–326), die das Ziel haben, die erhabenen Naturwirkungen in der Architektur „ins Werk zu setzen“. Diese spätaufklärerische Ästhetik der Leidenschaften wirkt unmittelbar auch auf die deutsche Architekturdebatte. Im 19. Jh. findet sich die psychologische Wirkqualität indessen weniger prägnant begrifflich formuliert; die theoretische Literatur ist stark durch rationalistische Ansätze (Rolle von Konstruktion und Material) geprägt. Gleichwohl finden die psychologischen Kriterien in hohem Maße Eingang in die architektonische Praxis und Wahrnehmung. Begriffe wie Fröhlichkeit, Ernsthaftigkeit, Gelassenheit, Bedrückung, Erhebung usw. finden sich vielzahlig in Kritiken oder in Wettbewerbs- und Preisurteilen, unterschwellig aber z.B. auch im zentralen Kunsttraktat des französischen 19. Jh.s, in Charles Blancs „Traité des arts du dessin“ (1867). Vor allem aber berührt auch der in der ersten Hälfte des 19. Jh.s um die Frage der Farbigkeit der antiken Architektur in ganz Europa ausgetragene Streit die Frage nach der emotionalen Wirkung der gebauten Umgebung |▶ 12|. Was die Baupraxis angeht, so sind nur auf der Grundlage einer derartig weiterwirkenden psychologischen Ästhetik der Architektur die bewusst emotionslosen Häuserfassaden der Pariser Straßenregulierung unter dem Präfekten Haussmann einerseits wie die Dramatisierung architektonisch-psychologischen Erlebens in der Pariser Oper andererseits zu verstehen |▶ 12|. Farben, Materialien, Raumdispositionen und -abfolgen sind hier als empathische Inszenierungsmittel eingesetzt. Umgekehrt ist zu beachten, dass gezielt strenge Architekturen implizit auf die bürgerliche Maxime der ‚Sittlichkeit’ als Gegenposition zu unkontrollierbaren Affektinduktionen zielen. Überspitzt formuliert stellt sich die bürgerliche Stadt des 19. Jh.s als eine regelrechte Topographie der Emotionenerzeugung, -konditionierung und -repression dar: Ernsthaftigkeit qua Bauten der Bildung, seelische Erbauung in der Kirche, Ausgelassenheit im Zirkus, Niedergeschlagenheit vor dem Gefängnis, Trauer auf dem Friedhof usw.
Ende des 19. Jh.s entwickeln sich die Einfühlungsästhetik, die Psychophysik und die Psychologie zu eigenen Wissenschaften, die insgesamt die affektive Stimulierung der Psyche als Wahrnehmungsinstanz untersuchen. Solche Ansätze spielen sodann seit dem Ende des 19. Jh.s im Bauen, gerade auch des Jugendstils, eine zentrale Rolle |▶ 19|. Ziel des Architekten ist es, über seine Innenräume und Fassaden verschiedenartige Stimmungen zu erzeugen. Das wird vor allem im Privathausbau, in der Theater- und der Denkmalsarchitektur sowie im Kirchenbau wirksam. Den Hintergrund dafür bildet der Anspruch, dass Architektur nicht länger dadurch zu verstehen sei, dass man – mit entsprechendem Bildungshintergrund – Stile ‚erkennt’ und allegorische Dekorationen dechiffriert. Im Gegenteil sollen die Bauten unmittelbar auf die Seele eines jeden wirken. Darin liegt aber gleichzeitig der Keim der radikalen Erneuerungsbestrebungen in der Architektur kurz nach 1900: Seelische Affizierung wird nun vielfach als emotionale ‚weibliche‘ Verführung durch Architektur abgewertet und diesem eine positiv verstandene ‚männlich’-objektive Schönheit als Ideal guter Baukunst entgegengesetzt |▶ 25|. Die im Zusammenhang der Jugendstilkritik deutlich werdende Polarisierung zwischen Emotion und Ratio als entscheidende Sensorien bei der Produktion und Wahrnehmung von Architektur wird durch die Krise des Ersten Weltkrieges zugunsten einer als überzeitlich begriffenen, rationalen Architektur entschieden. Gleichwohl wirken die Kriterien sensueller Stimulierung und emotionaler Überwältigung gerade in der sich entwickelnden Moderne weiter. Gerade bei Le Corbusier als einem der theoretischen Wortführer spielt die emotionale Überwältigung durch die technische Rationalität der neuen Architekturen eine zentrale Rolle. Auch die Farbigkeit mancher moderner Architekturen, etwa in Wohnsiedlungen |▶ 30|, soll direkt erfahrbare psychische Energien erzeugen.
Trotzdem wurde das Kriterium der emotionalen Wirkkraft von Architektur innerhalb der internationalen Moderne kaum explizit als Ziel benannt. Man wollte ‚sachlich’ und ‚objektiv‘ sein. Umso leichteres Spiel hatte das Bauen in den Diktaturen, in denen emotionale Kriterien als massenpsychologische Instrumente neu aktiviert wurden, zwischen kameradschaftlicher Gemütlichkeit und pathetischer Überwältigung. Die Architektur der Nachkriegszeit hat die emotionale Komponente hingegen vielfältig ausgebaut. Vor allem im Kirchenbau und auch in Gedenkstätten gibt es zahlreiche Ansätze, seelisch irritierende Räume und Lichteffekte zu schaffen. Das reicht bis zu Projekten der jüngsten Vergangenheit wie Peter Zumthors Projekt zur Berliner „Topographie des Terrors“, Peter Eisenmans Denkmal für die ermordeten Juden in Europa in Berlin (S. 77, □ vgl. 38) und Daniel Libeskinds Jüdischem Museum in Berlin |▶ 49|. Darüber hinaus hat sich der Begriff der ‚Atmosphäre‘ in der neueren Ästhetik zu einem Leitbegriff entwickelt (Gernot Böhme), der auch von der Architektur bzw. dem Architekturdiskurs aufgenommen wird. Hier geht es um Stimmungswerte, die aus Umgebungen auf ein Individuum psychologisch wirken. Diese Umgebungen können architektonisch geformte Räume und Materialien sein, aber vor allem auch situative, durch bestimmte soziale Komponenten bestimmte Umgebungen. Vielfältig sind solche Mechanismen aber auch für Event- und Konsumarchitekturen umgesetzt, in denen es – etwa bei anspruchsvollen Shopping Malls – darum geht, komplexe Raumbildungen mit Infrastrukturen und emotional ansprechenden Ambientes zu verbinden.