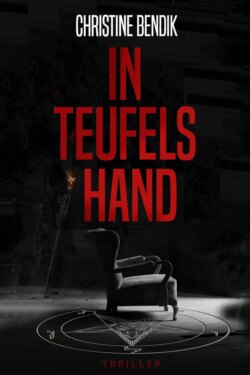Читать книгу In Teufels Hand - Christine Bendik - Страница 6
Kapitel 3
ОглавлениеNatalja
»Bürgerhospital Frankfurt, Innere Abteilung, Schwester Claudia am Apparat.«
»Na sag mal«, grummelte ich. »Der Papst ist einfacher zu erreichen.« Ich hatte mich schier verzehrt vor lauter Sehnsucht nach der Mausestimme. Es war sieben Uhr durch, Claudia hatte gerade Pause. Ich ahnte, dass sie schon mal das ein oder andere Glimmstängelchen rauchte, vor dem Haupteingang der Klinik. Beim Stichwort Zigarette griff ich automatisch in die Tüte mit der Ersatzbefriedigung: Gummibärchen.
»Hi Allia. Nice, dich zu hören, das Flugzeug ist also noch heil.«
Haha, das Flugzeug! Piepmäuschenpiep. Es klang erfrischend unbekümmert. Ich konnte das Herzgesicht meiner kleinen Schwester vor mir sehen, die dunklen Rotweinlippen, die stets ein wenig fiebrig wirkten, während mein Blick über den offenen Aktenschrank gegenüber streifte.
»Was gibt es denn«, fragte sie, »mitten in der Nacht?«
»Alles und nichts«, erwiderte ich. Am Telefon besprach ich nicht gern meine Sorgen und Nöte, ich wollte ein persönliches Treffen und konnte warten, weil ich Claudias Rat schätzte. Obwohl sie die Jüngere war, musste ich ihr in Bezug auf Männer deutlich mehr Erfahrung zubilligen.
»Und wie geht es mir so, nach dem Urlaub? Und Mama? Ihr habt bestimmt geredet.«
Da war sie wieder: die Schwesternsprache. Wie geht es mir. Damit meinte sie mich. Und mir ging es beschissen. Nicht, weil mir der intensive Geruch der Tigerlilien auf meinem Schreibtisch Kopfschmerzen bereitete, sondern wegen Carlos.
»Mama«, fuhr ich fort, »richtet dir übrigens Grüße aus. Sie will zu uns ... na ja, so um den ersten Mai herum ...« Geno gurrte zustimmend. Ganz in Gedanken hatte ich das Kerlchen auf meiner Schulter ins Büro getragen, das sonst für es tabu war.
»Ach?«, fiepte Claudia. »Wieso vermiete ich nicht einfach mein Gästezimmer?«
Ich zuckte mit den Schultern, als könne sie es sehen. Die Süßigkeit brannte in meinem Rachen. Über Claudias Minderwertigkeitsideen mir gegenüber hatten wir schon öfter gerätselt und waren auf keinen grünen Zweig gekommen. Es ging wohl um so subtile Geschichten wie die Verteilung liebevoller Blicke, kleiner Streicheleinheiten mit einem zärtlichen Über-den-Schopf-fahren oder das Geschenk eines mütterlich liebenden Lächelns. Es ging um das Leuchten in stolzen Mutteraugen. Claudia fand, dass sie weit schlechter dabei wegkam als ich.
»Du hältst doch eh nichts vom Laufen, oder?«, sagte ich zu meiner Verteidigung. Ich hörte sie noch schimpfen, wie viele Kilometer sie täglich in der Klinik ableistete, und dass sie es verdient hätte, sich am Wochenende auf die Couch vor den Fernseher zu fläzen. »Und Mama will unbedingt in den Hessenpark und dann im Taunus spazieren gehen«, fügte ich an. Außerdem drehte Mama an ihrem Hochzeitstag allein in ihren vier Wänden in Friedrichsdorf-Burgholzhausen durch, seit Paps verstorben war. Alles erinnerte an ihn, auch wenn sie selbst nur noch den ersten Stock bewohnte, den sie nach dem Brand neu hatte hochziehen lassen.
An dieser Stelle hielt ich es für angebracht, das Thema zu wechseln. »Und du, Maus? Was hast du so gemacht die Tage? Was habt ihr gemacht, du und Mika?« Ich lachte auf. Das reizte auch den Grünen auf meiner Schulter zum Lachen. »Es ist doch noch Mika?« Eine berechtigte Frage. Claudia wechselte die Partner wie die Frisuren.
»Mika? Wieso Mika? Seit gestern heißt mein Schatz Tom.«
»Na bitte.«
»Erwischt«, lachte sie. »Du hast falsch gedacht. Mika ist aber so was von aktuell. Du, das könnte was Ernstes werden!«
Ich staunte Bauklötze.
»Ist nicht wahr?«
»Wir sind jetzt offiziell verlobt.«
»Claudi, Claudi. Ich muss mich sehr wundern. Du wirst doch am Ende nicht sesshaft?«
Sie seufzte. »Abwarten. Er ist wunderbar. Engt mich nicht ein.«
»Kunststück. Bei deinem Freiheitsdrang.«
»Und was treibt mein Lieblingsschwager so?« Nun, der Begriff des Lieblingsschwagers relativierte sich, wenn man bedachte, dass es nur diesen einen gab. Ich spürte, wie sich meine Schultermuskeln spannten und mein Lächeln irgendwie bitter wurde. Der gestrige Abend stand schlagartig vor mir. Der Abend und Roja.
»Treffen?«, lenkte ich ab. »Um Zwölf im Café Mozart?« Das nostalgische Cafè in einer Parallelstraße der Frankfurter Zeil bot eine leckere Kuchenauswahl und duftende Crépes und war für mich und mein Handicap in einer verlängerten Mittagspause ein passender Abstecher.
»Nice idea«, meinte Claudia. »Vielleicht ein andermal. Ich treffe Mika um zwölf, schlafen muss ich auch irgendwann. Bin total gerädert, in der Klinik ist zurzeit die Hölle los.«
»Die Hölle?«
»Ansonsten ist die Omi in Zimmer achtzehn ja echt eine Süße. Faselt viel von ihrem Sohn in Florida und so, Disneyland, Mickey Maus. Ganz unterhaltsam.«
»Aber?«
»Hat ein Darmproblem. Und immer die Finger in der Windel.«
»Claudi, ich bewundere dich ...«
»Ich könnte dir Storys erzählen ...«
Oh ja, das könnte sie. Und sie erzählte reichlich, während unserer Telefonate. Von Machos, die die einzige Krankenschwester auf der Station als persönliches Eigentum betrachteten, oder von Opas, die nachts aus der Klinik türmten, um auf Weltreise zu gehen oder sich wenigstens einen entspannenden Kurztrip in die Eros-Center der Frankfurter Kaiserstraße zu genehmigen. Ich hatte stets ein offenes Ohr. Irgendwo brauchte jeder seine seelische Müllhalde.
Im Hintergrund hörte ich ein Geräusch, als ob Bestecke klapperten.
»Stichwort Hölle«, fuhr Claudia fort. »Dazu fällt mir glatt die Wasserleiche ein.«
»Du meinst den Pfarrer? Wie hieß er gleich?«
»Keine Namen, bitte. Du hattest den doch nicht auf dem Tisch?«
Die Frage konnte sie sich selbst beantworten. Mein Institut im Herzen Frankfurts war eine viel zu unbedeutende Klitsche für solch brisante Fälle. Mit Sicherheit hatten Heilmanns Bestattungen im Westend den Zuschlag gekriegt.
Ein Gummibärchen starb den Sekundentod.
»Er war mein Patient«, fuhr Claudia fort.
»Mit Darmproblem?«
»Nö. Nierenspende. An seine seltsame Schwester.«
»Seltsam?«
»Die Wortbedeutung ist: unkonventionell, fremdartig.«
»Herzlichen Dank, Frau Lehrerin.«
»Unkonventionell, genau. Sie erinnerte mich an Dana. Aber das Wunderliche scheint in deren Familie zu liegen. Wer wird denn schon freiwillig Pfaffe?«
Da lag mal wieder ein wunder Nerv von ihr blank. Über Religionen und Sekten, den Herrgott und sein Fußvolk, hatten wir nächtelang diskutiert. Claudia war schließlich aus der Kirche ausgetreten. Ich bewunderte ihre Konsequenz. So wirklich war ich selbst von den jeweiligen Vereinen nicht überzeugt, doch ich redete mir ein, dass es sich für eine Bestatterin besser machte, wenn sie sich in puncto kirchliche Zeremonien auskannte. So blieb ich halbherzig der katholischen Kirche, auch mit meinen jährlichen Spenden für das Glockengeläut, erhalten.
»Erklärst du mir den Zusammenhang?«, bat ich Claudia. »Ich meine: Nierenspende mit Hölle.« Geno plusterte sein Köpfchen auf. Ich durfte ihn kraulen.
»Die Hölle, das sind die Polizisten. Schleichen seit Tagen auf meiner Station herum und gehen mir mit ihren Fragen gehörig auf den Zeiger.«
»Verstehe. War es Suizid bei dem Pfarrer?«
»Kommst du, in die Acht?«, hörte ich die Stimme einer anderen Schwester.
»Riecht eher nach Mord«, erwiderte Claudia auf meine Frage.
»Woher weißt du das?«
»Was ein junger Polizist schon mal so plappert. Nicht jeder kennt so was wie Schweigepflicht.«
Ich nickte und schmunzelte.
»Was ist denn jetzt?« Die Stimme im Hintergrund drängelte.
»Na dann«, sagte Claudia. »Very nice, dich zu hören. Ach, und von wegen Pfaffen und anderen Teufeln: Pass gut auf dich auf, Schwesterherz, wenn du nachts allein durch die Straßen wandelst.«
»Was heißt das nun wieder?« Und seit wann wandelte ich?
»Liest du keine Zeitung?«, meinte sie, ungerührt der Drängerin.
»Ach so, das.« Sie sprach von der Teufelssekte, die seit Jahren mitten unter uns lebte, und die Tage im Frankfurter Stadtwald bei einer Orgie erwischt worden waren, wo sie wie losgelassene Teenies ihren Messwein tranken und eine Wasserpfeife schmauchten. Harmlos und irgendwie süß.»Wärst denen eh ein viel zu zäher Brocken«, frotzelte Claudia.
»Wie meinst du das?«
»Die neuen Apostel, so munkelt man, opfern bei ihren Messen zur Not auch Tiere.«
»Zur ... Not? Du meinst ...« Das glaubte sie nicht im Ernst. Menschenopfer? Wir lebten doch nicht im Mittelalter.
»Keine Sorge«, sagte ich noch. »Mein Rollstuhl ist schneller, als der Teufel erlaubt.«
Claudia stimmte in mein Lachen ein. Ich fürchtete mich nicht vor den Teufelsanbetern. In Wahrheit waren sie Laschis mit kleinem Selbstwertgefühl. In diesen Gruppen ging es doch viel weniger um Satan als um Macht und Geld, es ging um die Hierarchie in den eigenen Reihen.
Claudia und ich verabredeten uns für Dienstag. Am Montag fand ich reichlich Gelegenheit, den Koffer zu leeren, die Wäsche zu waschen und mit dem Staublappen durch die Wohnung zu fahren. Die Fenster starrten vor Dreck, der Osterputz war fällig, doch das mochte Georgina, meine Hilfe, erledigen.
Carlos belegte noch das Bad. Um halb acht würde er aufbrechen ins Goethe-Gymnasium. Mona war in diesen Augenblicken schon auf dem Weg zu einem Kunden. Ich hingegen wollte hinunterfahren ins Institut, Pit begrüßen und die aktuellen Vorgänge besprechen. Im selben Moment stand der vierzigjährige Bommersheimer aber schon vor meinem Schreibtisch, mit seinem schiefen Schulbubengrinsen und dem kurzgeschorenen Haar. Bestatter war so ungefähr das Letzte, woran seine schlaksige Erscheinung und das Gesicht mit der schmalen Goldrandbrille erinnerten. Eher hätte man ihn in die Schublade Grundschullehrer gesteckt, doch wer einmal einen Arbeitsbericht von ihm gelesen hatte, zweifelte auch an dieser Variante: Pit schrieb, wie ihm der Bommersheimer Schnabel gewachsen war.
Beschdaddungsundernehme.
»Gude, Allia.« Er trat ein, zur selben Zeit wie Georgina, die sich des vollen Abfallkorbs annahm. Sie hatte wohl wieder schlecht geschlafen, unter ihren Augen schimmerten bläuliche Ränder.
»Was ist los, Pitti? Schaust ja, als wär einer gestorben.« Grinsend kniff ich ihn in die Seite. Er musterte mich.
»Du hast kei Ahnung, odder?«
Ich stellte fest, dass Mona sich noch im Haus aufhielt, denn sie steckte den Kopf zur Tür herein. Irgendwie schaute sie genauso belämmert drein wie Pit.
»Es ist einer gestorben«, erklärte Pit und tauschte einen Blick mit Mona, danach verschwand ihr Kopf wieder, und auch meine Perle verließ den Raum, den Papierkorb unter dem Arm.
Ich nickte. »Weiß ich doch. Der Herzinfarkt.«
Erst überlegte ich, niemand hatte mich über einen Neuzugang informiert, und das ging gar nicht. Aber dann musste ich lachen, als ich den verwirrten Ausdruck in dem Lausbubengesicht sah.
„Noch kei frische Luft geschnappt, heut?« Pitti schnaufte. »Das tote Professorsche ... wie drück isch es vorsischdisch aus ...«
»Professor? Nun mach es nicht so spannend, mein Blutdruck ... schon viel zu hoch heute Morgen ...« Demonstrativ deutete ich auf den Aktenstapel, der auf mich wartete.
»Er heißt Dimitrios Galanis, einundfuffzisch Jahr alt«, erklärte Pit mit leicht hilflosem Ausdruck. »Isch hab den Perso gefunne, in seiner Hosentasch. Und eine Rechnung von Amazon.«
»In welchem Raum?«
Pit zuckte mit den Schultern und deutete Richtung Tür. Draußen hörte ich Mona werkeln. Allmählich wurde ich sauer. Vorsorglich wendete ich meinen Rollstuhl.
»Will mich mal einer aufklären ... Wer ist denn jetzt der Tote? Frankfurter?«
Ein Nicken.
»Und was ist an dem ... Professor so besonders, außer, dass er klammheimlich durch meine Hintertür ...?«
Pit deponierte eine Plastiktüte auf dem Schreibtisch. Seine hellen Augen fixierten mich.
» Der Galanis is unvollständisch, gewissermaßen.«
Sofort kamen mir Bilder. Nikotinkrüppel hatten wir hin und wieder mal auf dem Tisch. Ich fummelte in der Tüte herum. Pit hörte nicht auf, mich anzusehen, indessen meine Finger auf etwas Kaltes, Rundes stießen. Ich spähte in die Tüte, fand einen Opalring. Irgendwie wurde mir mulmig bei dem Anblick. Das Teil sah fast aus wie …Der Ring sank in die Tüte zurück.
»Okay. Unvollständig. Was heißt das?“
Ich stand bereits in den Startlöchern, die Hände an den Rädern. Am besten war, ich sah selbst nach dem Rechten.
»Der Professor is rasiert.«
Ich hüstelte. Als wäre Galanis der Erste mit epilierter Brust oder einer Rasur im Schambereich! Pit war altmodisch in diesen Belangen, da hielt sie seinen Freund Jochen für deutlich aufgeschlossener.
„Galanis fehlt ein Stück Skalp, Briefmarkengröße.«
Nichts hielt mich mehr im Büro. Pit schloss auf.
»Warte mal!«, rief er, doch ich war schneller. Raum drei war wie die zwei anderen gut gekühlt, dennoch roch ich die Leiche. Man sagte, mit der Zeit gewöhne man sich. Meine Nase reagierte schon auf die feinsten Nuancen. Ich hatte meinen Beruf von der Pike auf erlernt, Familienbetrieb, war gewissermaßen zwischen Särgen aufgewachsen und hatte mit meinen Freunden darin Verstecken gespielt. Und dennoch war ich stets froh, die Verstorbenen bald Erde, Feuer oder Wasser überantworten zu dürfen, die Fenster zu öffnen und den Tod aus dem Haus zu jagen. Es hatte etwas von Tabula rasa.
»Das ist Frau Markwart«, stellte ich irritiert fest, als ich das Laken vom Kopf der Leiche in unserem Raum für Neuankömmlinge zog.
Doch wieder deutete Pit Richtung Tür. »Isch hab wohl gestern Abend vergesse, das Tor abzuschließe.«
Herrgott, musste man ihm denn heute jeden Wurm aus der Nase ziehen?
»Pitti, du sprichst in Rätseln. Im Hof – das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Besser, du informierst den Horst Stein.«
Ich schwankte, ob ich wirklich zuerst den Gerichtsmediziner anrufen sollte oder doch die Polizei, als ich vor dem Toten stand.
Er lehnte sitzend mit dem Rücken an der Häuserwand. Unter halb offenen Lidern hervor sah er durch mich hindurch. Er hatte braune Augen. Braun mit einem Schuss goldenen Gelbs wie Safran.