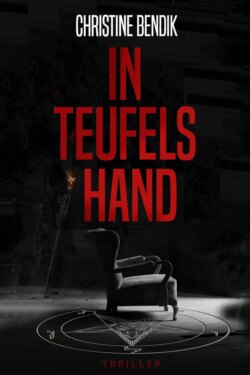Читать книгу In Teufels Hand - Christine Bendik - Страница 9
Kapitel 6
ОглавлениеNatalja
Ich bestand darauf, selbst am Steuer zu sitzen. Das Fahren bereitete mir großes Vergnügen, vor allem, seit mein Van mit dem komfortablen Joysteer-System ausgestattet war. Mit wenigen Eingaben ließen sich Lenkung, Automatikgetriebe, Bremse, Gas, Licht oder Blinker bedienen. Ich erinnerte mich, den Van in Blau gekauft zu haben, heute jedoch erschien er honiggelb. Der Pollenflug war enorm dieses Jahr.
Eine Sirene jaulte, in Höhe der Konrad-Adenauer-Straße erfasste ich im Rückspiegel einen Feuerwehrwagen. Ich verdrängte leidlich die Gedanken an unseren Wohnhausbrand.
Den Van parkte ich im Parkhaus am Gericht. Auf der Zeil herrschte Hochkonjunktur, wir sahen Leute, die das Frühjahr mit kurzen Hosen begrüßten, andere in hochgeschlossenen Jacken. Fahrradfahrer, Jogger, Fußgänger mit Rucksäcken und Plastiktüten von Lidl. In Höhe der Hirsch-Apotheke hatte sich eine Menschentraube gebildet, die dem Heimatlieder schmetternden Japaner mit dem Shetlandpony an der Leine zuhörte, der Münzen in seinem am Boden stehenden schwarzen Zylinder sammelte.
»Hoch auf dem gelben Wahagen, sitz ich beim Schwager vorn ...«
Linkerhand Deichmann, das Lieblingsgeschäft Monas.
»Wow, sieh dir die Schwarzen an.« Mona geriet ins Schwärmen. »Die Sandalen da auf dem Podest, mit den Korkabsätzen. Du, können wir kurz?«
Sie wusste genau, dass ich nicht in das Klischee »Frau – Schuh – hin und weg« passte. Ich hasste Schuhe kaufen. Womöglich hing dieser Umstand mit meiner Behinderung zusammen, ich konnte die Teile ja nicht ihrem eigentlichen Zweck zuführen. Brav schickte ich mich dennoch an, Mona zur Eingangstür zu folgen, die aufgrund der sommerlichen Temperaturen weit offenstand. Mona hatte mir mit der Fahrt in die Stadt eine Freude gemacht, eine Hand wusch die andere.
Wir hatten das Geschäft noch nicht betreten, da stoppte mit quietschenden Reifen ein schwarzer Fiat vor dem Eingang. Eine ausgemergelte Frau stieg aus, in Jeans, die Kapuze ihres dünnen, grauen Sweatshirts auf dem Kopf und einen Arztkoffer in der Rechten. Passanten drückten die Nasen an den Schaufenstern platt, einige wollten neugierig den Laden stürmen. Im Vorbeigehen hob die Frau drohend die Hand, es hieß Stopp, bis hierher und nicht weiter.
»Eine Sturzgeburt«, raunte eine Alte mit Federschmuck am Hut. »Beneidenswert! Ich weiß, was ich mitgemacht habe. Also mein erstes Kind ...«
Ich überhörte die unappetitliche Geschichte mit den tagelangen Wehen und anschließender Zangengeburt so gut es ging. Hinter dem Schaufenster, zwischen zwei Schuhregalen, erblickte ich eine Verkäuferin, Mitte zwanzig, mit dem Namensschild »Tine Fabian« am Revers. Mit Schwangerenbauch und kreidebleichem Gesicht kauerte sie auf einem hölzernen Stiefelknecht. Das dunkle Haar klebte ihr auf der Stirn und um sie her breitete sich die farblose Lache des Fruchtwassers über den Teppich.
»Ist wohl Essig mit neuen Sandalen, Liebste«, bemerkte ich nüchtern, an Mona gewandt.
»Zischen wir ab«, murmelte sie. Ihre Mundwinkel hingen, die schönen Schuhe ... Aber irgendwie ... und obwohl ich Gaffer nicht leiden konnte ... Etwas hielt mich wie magisch zurück. Und dieses Etwas oder dieser Irgendwer, das war definitiv nicht die Patientin.
»Harm, der verfluchte Bastard«, stieß die Schwangere hervor und es folgte ein Schrei, der mir durch Mark und Bein ging und mich an meinem Kinderwunsch zweifeln ließ.
»Ganz ruhig, Tine.« Die Hebamme maß Puls und Blutdruck. Harm, so dachte ich, hieß sicher der Vater, und auf den war Tine nicht gut zu sprechen.
Die Stimme der Hebamme elektrisierte mich, gleichzeitig hegte ich den Verdacht, dass sie sich mit dem Reden stark zurückhielt. Für die Stimme einer Frau klang mir das Timbre zu tief und wie absichtlich verstellt.
»Komm jetzt«, forderte Mona mich auf. Ich konnte mich kaum von der Türe lösen. Die Hebamme mied meinen Blick.
»Glotz nicht so, Opa«, keifte Tine, mit dem Blick zum Schaufenster. »Schlappschwänze, alle Typen, von wegen dabei sein bei der Geburt. Aber warte, der lernt mich kennen. Ich zieh das Balg bestimmt nicht allein groß.«
Eine andere Verkäuferin unterstützte gemeinsam mit der Hebamme die Schwangere beim Aufstehen.
Ich sah diese dürre Frau an der Seite Tines, erhaschte einen knappen Blick auf Wangen, Lippen, Kinn und ein paar graue Locken, die die Kapuze nicht verbarg. Und in meinem Findet-Dana-Wahn ertappte ich mich bei der Idee, dass dieses kantige Frauengesicht sich womöglich vor mir persönlich versteckte.
Es war natürlich Unsinn. Ich benieste meine Einfalt und dachte gleichzeitig, wie ungerecht manchmal das Schicksal war. Die eine Frau wollte kein Kind haben und bekam trotzdem eins. Und was war mit mir? Meine Periode verspätete sich mal wieder und das schürte unnötig meine Hoffnung. Mein Gynäkologe nannte mich das Fräuleinwunder, nach Jahren ungewollt kinderloser Ehe trotz gebärfreudigen Beckens. Und Mama setzte noch eins drauf, indem sie ohne Not bereits das dritte Paar Babyschuhe häkelte, in neutralem Gelb.
»Herrgott, Chefin«. Mona zupfte mich am Ärmel. Sie kannte mich nicht so indiskret.
»Es gibt nichts zu gaffen«, erklärte nun eine dritte Verkäuferin und schloss die Ladentür.
»Sieht nach Hausgeburt aus«, mutmaßte Mona und deutete auf die Wohnung über dem Laden. Ich antwortete nicht, war mit meinen Gedanken beschäftigt und erwartete das übliche Händezittern. Dr. Bartheld, mein Hausarzt, hatte mich beruhigt, es ginge wohl vielen Menschen wie mir. Manchmal gab es diese Déjà-vus. Man glaubte, Leute zu sehen, die längst verstorben waren, glaubte, sie an ihren Gesten, ihrem Gang, ihrem Lächeln zu erkennen.
Die Sonne spitzte nun hinter dem Deutsche-Bank-Monstrum am Ende der Häuserschluchten hervor, worauf wir geradewegs zusteuerten. Nach dem feinen Ledergeruch im Geschäft nahm ich Frankfurts schweren Atem umso intensiver wahr: Abgase, altes Fett aus den Frittenbuden, Döner, Brezeln, Zuckerwatte, Schweiß, Chanel No.5.
Zu Parfum fielen mir mein bescheidener Einkaufszettel und die Hebamme ein. In ihrem Vorübereilen hatte ich einen vagen Duft von Kölnisch Wasser gerochen, der mich erinnerte an ... Und wäre die Frau rothaarig gewesen und fülliger, viel fülliger um die Hüften – ich hätte sie glatt gefragt, ob ihr Vater wohl Peter Sanftleben hieß. So wie meiner.
Nichts liebte ich mehr als die Ferienzeit, wenn Carlos frei hatte, für uns kochte, seinen Hugo-Boss-Duft verströmte und, bei entsprechender Laune, seine spanischen Gesänge La Cucaracha und Guantanamera das Haus erfüllten. An diesem späten Nachmittag war ich direkt froh, für mich allein zu sein, denn er nahm gerade die letzte Elternsprechstunde wahr.
Der Name Roja klang noch in meinem Ohr und hatte einen Keil zwischen uns getrieben. Carlos behauptete steif und fest, Roja sei sein neues Kosewort für meine Person. Warum nur konnte ich es nicht glauben? Vor meinem Urlaub hatte er mich nie so genannt, und plötzlich? Was war in der Zwischenzeit in seinem Kopf, mit seinem Herzen passiert, hatte ihm die Sehnsucht das neue Wort ins Ohr geflüstert? Doch ja, mit etwas gutem Willen fanden sich auf meinem Schopf einige wenige rotblonde Haare, Anteile von Mama Sanftleben. Oder gab es da eine andere Rothaarige, mein sauberer, stiller Carlos und eine kleine Affäre?
Womöglich vermisste er doch mehr, als er mir eingestand. Zwar war meine Lähmung psychogen und es gab keine organischen Ursachen. So konnte ich durchaus etwas fühlen. Nur selten benötigte ich einen Katheter und ab und an spürte ich gar ein Kribbeln in den Schenkeln, so, als wolle mein Körper mir sagen: Steh auf und geh! Und doch wies ich Carlos manchmal ab, wenn er Sex wollte, weil ich mich unbeweglich, unattraktiv und müde fühlte.
Unbeweglich. Das Wort leitete meine Gedanken über zu Galanis. Bewegungslos. Leblos. So hatte er vor mir gelegen, mit offenen Augen, die mir unbedingt noch etwas sagen wollten. Die Vorstellung, es könne eine besondere Bewandtnis haben, den Mann ausgerechnet an meine Adresse zu liefern, jagte mir immer noch kalte Schauer über den Rücken. Und dass der Kriminalbeamte Weyers mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt hatte, mit diesem ernsten Ausdruck und den Worten: »Jederzeit, Frau Sanchez« – das machte mir die Sache auch nicht einfacher.
Eine Stunde blieb mir, bevor ich die Kränze und Blütenkörbchen an die Trauerhalle des Hauptfriedhofs an der Waldlust auslieferte, für die bedauernswerte Mina Markwart, die mit vierundzwanzig Jahren ein schwerer Schlaganfall ereilt hatte.
Ich hätte ein Bad nehmen können, ein Gläschen Prosecco zur Entspannung. Wenn erst Mama einzog, musste ich mir diese Freuden verkneifen, da sie mich jede freie Minute mit Beschlag belegen würde. Doch ich fürchtete mich vor meinen eigenen Gedanken, und es existierte eine viel bessere Möglichkeit abzuschalten, ohne ins Grübeln zu geraten: ein Besuch des Urwaldzimmers.
Das Telefon schnurrte, am anderen Ende war Marc.
»News for you«, meinte er knapp.
Ich wartete.
»Well«, fuhr er fort. »Dein Professor Galanis ...«
»Ja?«
»Er war nicht der brave Arzt, für den wir ihn halten.«
»Ist mir nicht neu«, trumpfte ich auf. »Er soll bereits in Pension ...«
»Seit Kurzem soll er den Aposteln den Rücken gekehrt haben.«
»Ist nicht dein Ernst?«
»Sie nannten ihn wohl Barfaee.« Ich notierte.
Marc sagte: »Vor ein paar Tagen erst soll er seine Oberurseler Hütte seinem Bruder vermacht haben, ebenfalls Apostel. Keine Ahnung, ob im Zwang oder freiwillig. Im Moment laufen ja noch die Ermittlungen. Ich schätze, danach wird der Bruder einziehen.«
Interessant. Marc schien bis aufs I-Tüpfelchen informiert, und wahrscheinlich wusste auch Horst Stein das alles längst.
»Und jetzt?«
»No idea. Aber so viel ist klar: Die Teufel werden in nächster Zeit jede Menge Besuch kriegen. Von Vater Staat.«
Galanis also ein abtrünniger Satanist. Hatte diese Abtrünnigkeit, diese Nicht-Akzeptanz der satanischen Spielregeln etwas mit der Skalpierung zu tun?
»Sag mal, woher weißt du das alles?«
»Hab so meine Quellen.«
Ich nickte grimmig. Marc und die Geheimniskrämerei. Die beherrschte er perfekt, wenn er nichts sagen wollte, schwieg er wie ein Grab – und zwar bis zum eigenen kühlen Grab.
»Gib's zu«, frotzelte ich, »du bist selbst einer von denen.« Es sollte witzig klingen, doch meiner Stimme fehlte die Leichtigkeit. Noch immer das Handy am Ohr, starrte ich in die Rechtecke aus Licht, die die Sonne von den Sprossenfenstern im Flur hierher auf das dunkle Laminat vor meinen Reifen warf. Die charakterlichen Facetten meines Journalistenfreundes reichten von Sprunghaftigkeit zu Verantwortungswillen, von sprühendem Witz zu Bierernst, von kühler Beherrschtheit zu unstillbarer Neugier. Er war nicht wirklich zu fassen, und man durfte ihm getrost alles und nichts zutrauen.
Ein Teil der sechs großzügigen Zimmer über den Geschäftsräumen hatte nach dem Wohnhauskauf brach gelegen, bis Carlos, der ohnehin schon dreimal wöchentlich viele Stunden im Fitnesscenter verbrachte, sich einen Raum mit Hantelbank, Laufband und anderen teuren Folterinstrumenten einrichtete. Das nahm ich zum Anlass, mir im Zimmer nebenan ebenfalls einen alten Traum zu erfüllen.
»Wollen wir?«, wandte ich mich an den Grünen, nachdem ich unter seinen neugierigen Blicken eine Pizza in den Ofen geschoben hatte. »Zu Trudie, Kokolein, Agathe Bauer?« Manchmal wunderte ich mich direkt, welch zarte Töne Geno anzuschlagen vermochte, wo sich der eine oder andere Nachbar schon über sein durchdringendes Organ beschwert hatte.
»Krck«, das hieß so etwas wie »Aber gern doch, Frauchen«.
Das Dschungelzimmer war eine Art Wintergarten. Ein Feigenbaum schmiegte sein Blattwerk wie lichthungrige Finger an die Fensterscheiben mit den aufgeklebten Greifvögeln. In den Pflanzenschalen am Boden wuchs ungiftiges Katzengras. Das Herz ging mir auf, sobald ich diesen Raum befuhr, doch gerade hatte ich Mühe, die Gedanken an das Gespräch mit Marc zu verdrängen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass Satanismus im Mörderspiel war. Und in manch meiner Gedanken um die Teufelsanbeter schlich sich, ohne greifbaren Grund, nun auch Danas Gesicht.
Was hatte Oma Lucia immer gesagt, die eine Art Hassliebe mit ihrer Enkelin verband? »Die nimmt keinen geraden Weg, die nicht. Die endet noch mal im Fegefeuer. Wie sie schon herumläuft, immer die schwarzen Fummel. Und das in dem Alter. Wieso sagst du denn nichts dazu, Franz?«
Sofort hatte ich den blauen Wellensittich Agathe Bauer auf dem Kopf, samt seiner Freundin Trudie, in zartem Gelb.
»Ihr kleinen Racker«, lachte ich und bemerkte, wie die Vogelblicke meine Hände nach Fressbarem absuchten. Kolbenhirse hatte ich mitgebracht, Apfelstücke und ein hart gekochtes Ei. Ich legte die Kostbarkeiten in den Futternapf unter dem Obstbaumgeäst. Sekunden später waren alle zur Stelle: vier Wellen-, vier Nymphensittiche, vier Prachtrosellas. Bei dem Anblick der tafelnden Meute bekam ich Hunger, hatte aber noch vierzehn Minuten auf die Pizza zu warten.
Wenn ich Agathe und Trudie so ansah, musste ich an mein erstes Sittichpärchen und an Claudia denken, die damals, sechzehnjährig, eine regelrechte Phobie gegen das Flattern ihrer Flügel entwickelt hatte. Während des Freiflugs der Vögel mied sie mein Zimmer wie die Pest. Und, als sei es gestern gewesen, stand wieder das Bild vor mir: der strahlende Augusttag mit der trügerischen Maske. Wir hatten noch zusammen Kaffee getrunken, wie immer samstags, nachdem Paps das Geschäft abgeschlossen hatte.
Stunden später war nicht nur mein Elternhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sondern auch das Ladengeschäft mitsamt dem Trauerzimmer im Erdgeschoss und der darin frisch aufgebahrten Gerda Hofmeister, deren letzter Wunsch ausdrücklich gewesen war: keine Einäscherung, bitte.
Bei der Aktion, Mama ins Freie zu bringen und sich anschließend um Claudia und mich zu kümmern, hatte mein Vater eine schwere Rauchvergiftung erlitten und war am nächsten Tag an den Folgen verstorben. Auch Wheena, Danas Kätzchen, musste ihr Leben in den Flammen lassen.
Mehr oder minder erfolgreich versuchte ich zu verdrängen. Doch ein Bild ging mir nicht aus dem Kopf: Wie Claudia, todesmutig, dem roten Inferno trotzte, sich durch die Flammen kämpfte und gleich darauf oben auf der Treppe erschien, mit von der Hitze gekräuselten Haaren, den kupferfarbenen Käfig mit den wohlbehaltenen Sittichen in ihren Händen. Sie starrte zu mir hinunter, die ich lauthals schluchzte. Ich schluchzte nicht vor Freude beim Anblick meiner Vögel. Ich schluchzte, weil Vater und ich die Treppe hinabgestürzt waren. Ich schluchzte, weil er ohnmächtig neben mir lag. Und weil ich meine Beine nicht mehr spürte.
Die Polizei ging von Brandstiftung durch Jugendliche aus, doch der Fall wurde nie geklärt. Es war ein Sommer des Schreckens, auch für Carlos, besonders aber für Mama, Claudia und mich. Genau wie jener Sommer, der uns Dana genommen hatte.
Ohne Carlos' Hilfe ersparte ich mir den kleinen Kraftakt, in den wackligen Schaukelstuhl vor dem Panoramafenster mit dem herrlichen Ausblick über die Dächer der Stadt zu gelangen. Ich bediente den Bremshebel meines fahrbaren Untersatzes, lehnte mich entspannt zurück, das Gesicht Richtung Abendsonne, spürte Müdigkeit in die Glieder fließen.
Geno hielt die Augen geschlossen und kauerte, mit dem Flügel an meine Wange geschmiegt, entspannt auf einem Fuß. Die täglichen Kratzer, die mir die spitzen Krallen vermachten, störten ihn herzlich wenig. Ob beim Arzt oder in der Sauna, es war ja ich, die die Erklärungsnöte hatte: »Nein, das kommt nicht von den heißen Nächten.«
Ich verschickte zwei SMS, eine an Claudia, eine an Mama. Mittagspause war stets eine gute Gelegenheit zum Aufarbeiten der kleinen, auf die lange Bank geschobenen Pflichten. Um mich her stoppte der melodische Ruf Charlys, des Prachtrosella-Hahnes, und auch das Schnattern der Wellensittiche verebbte. Sie waren müde wie ich. Ich rekelte mich, tauchte tiefer in die Schlafschwere, fast fielen die Augen schon zu.
Der kleine Bachlauf auf dem Pflanzenbeet tat mit seinem Plätschern ein Übriges zur Entspannung. In meinen Augenwinkeln sah ich es im Astwerk sitzen, das geliebte Vogelvolk mit den dick gefressenen Bäuchlein. Ich dachte noch, wie herrlich es wäre, mal wieder die Malsachen aus der Truhe zu holen. Prachtrosella in Öl. By N. Sanchez.
Ich hörte ein Martinshorn gellen, leiser werdend mit der Ferne. Die Szene aus der Fußgängerzone tauchte auf, wie ein Blitzlicht. Dann war ich meinen Sorgen entrückt. Beim Erwachen meldeten sich jene sofort und drängend: Dana. Carlos. Roja. Vertrauen. Liebe. Marc. Der zweite brisante Gedanke erreichte mein Hirn, als ein Brandgeruch mir in die Nase kroch. Mist, die Pizza!