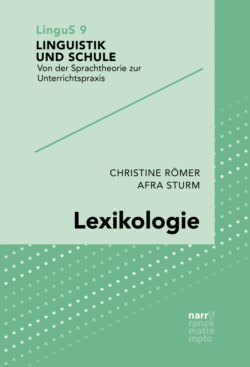Читать книгу Lexikologie - Christine Römer - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Das mentale Lexikon
ОглавлениеEin etablierter Terminus ist mentales Lexikon (auch inneres Lexikon) als Bezeichnung für den mentalen Wortspeicher im Langzeitgedächtnis des menschlichen Gehirns. Das mentale Lexikon existiert nur individuell im jeweiligen menschlichen Geist und enthält das Wissen über den Wortschatz der speziellen Person. Das interne Worterkennungssystem identifiziert beim Lesen beispielsweise Wortgestalten (mit ihren zugehörigen Lautfolgen), die vor unseren Augen erscheinen. Entsprechen die identifizierten Buchstabenfolgen bestimmten grafischen Mustern bzw. entsprechen die wahrgenommenen Lautfolgen bestimmten Lautmustern, stellt das mentale Lexikon die zugehörigen semantischen, syntaktischen und sonstigen Wortcharakteristika der betreffenden Wörter zur Verfügung. Um kommunizieren zu können, müssen die beteiligten Sprechenden und Hörenden auf identische Lexikoneinheiten und auch auf Regeln, die die Lexeme zu Syntagmen und Sätzen kombinieren, zurückgreifen können.
Das Wort ist nicht als Ganzheit im mentalen Lexikon gespeichert: Das lexikalische Wissen zur Lautung (Lautform), Schreibung (orthografische Form), Bedeutung, Verknüpfung und Verwendung ist modulhaft mit netzartigen Verknüpfungen gespeichert.
Man kann das lexikalische Wissen im mentalen Lexikon zu folgenden Modulen gruppieren:
Phonologisches und artikulatorisches Wissen: Klangmuster und die Aussprachen
Orthografisches Wissen: Schreibungen, Regelwissen
Morphologisches Wissen: Flexionsformen und -muster, Wortbildungsmuster
Syntaktisches Wissen: Wortartenzuordnung und entsprechende Frames
Semantisches Wissen: Verbindung zum Konzept
Pragmatisches Wissen: Zugehörigkeit zu einer Varietät, zu einer Fachsprache etc.
(Siehe weiter Römer 2019: Kap. 6.1., Pustejovsky/Batiukova: Teil II. Kap. 6)
Das mentale Lexikon muss den Sprachbenutzern und -benutzerinnen für das Verstehen und Verwenden von Wörtern Informationen über ihre Lautformen, orthografischen Formen, über ihre semantischen, syntaktischen und pragmatischen Charakteristika zur Verfügung stellen.
In wissenschaftlichen Beschreibungen veranschaulicht und repräsentiert man die lexikalische Wissensstruktur im mentalen Lexikon u.a. mit Lexikoneinträgen (engl. lexical entry). Zu einer sprachlichen Grundeinheit gehören danach ein komplexer Lexikoneintrag mit mindestens folgenden Komponenten:
1 den (lautlichen und grafischen) Formen der sprachlichen Einheit,
2 den Bedeutungen der sprachlichen Einheit,
3 der Wortart und Flexionsklasse (wenn flektierbar) der sprachlichen Einheit,
4 der lexemspezifischen Fügungspotenz (die angelegten Ergänzungsglieder). So verlangt im Deutschen ein Substantiv in der Regel in der Verwendung ein Artikelwort, an dem das Genus, der Numerus und Kasus erkennbar ist. Alle Verben eröffnen „Leerstellen“ für Ergänzungsglieder.
Für das Wort Fahrer kann folgender minimaler Lexikoneintrag im mentalen Lexikon angenommen werden:
1 Fahrer (grafische Form), [ˈfaːʀɐ] (phonetische Form)
2 Person, die a) ein Fahrzeug steuert oder die b) als berufliche Tätigkeit ein Fahrzeug lenkt
3 Substantiv, Maskulinum, Plural: Nominativ Fahrer
4 mit Genitivattribut (Fahrer des Autos)
In den Lexikoneinträgen verbinden sich die phonologischen, semantischen, morphologischen und syntaktischen Charakteristika von Wörtern, die in komplexere syntaktische Strukturen (Syntagmen und Sätze) eingebracht werden.
Die Prozesse der Worterkennung und Wortverwendung sind zum einen Gegenstand der Psycholinguistik und stehen – wie Untersuchungen zur Struktur des mentalen Lexikons – im Zentrum der kognitiven Lexikologie. So werden u.a. folgende Verarbeitungsprozesse unterschieden (Christmann 2010):
Wahrnehmungsgesteuerte Verarbeitungsprozesse: Dabei werden Grapheme und Phoneme miteinander verknüpft und so ein Wort gebildet. Es handelt sich dabei um Prozesse, die vom Signal hin zum Wort verlaufen.
Wissensgesteuerte Verarbeitungsprozesse: Die Bedeutung eines Ausdrucks, eines Textes wird aus dem Wissen über ein Schema gesteuert, das heißt, die Prozesse verlaufen vom Wort zum Signal. Dabei kann das Vorwissen die Wahrnehmung auch übersteuern, das heißt, wir hören oder lesen etwas anderes als die tatsächlich vorkommenden Ausdrücke, bspw. Eisbärsalat statt Eisbergsalat oder knabenbringende statt gnadenbringende Weihnachtszeit (Kellner 2005).
Semantisches Priming und Häufigkeitseffekt: Semantisch ähnliche sowie häufige Wörter werden leichter und schneller erkannt als semantisch wenig ähnliche oder eher seltene Ausdrücke.
Besonders aus dieser Perspektive sind die Prozesse der Worterkennung und Wortverwendung auch Gegenstand der Lese- und Schreibforschung, insbesondere im Hinblick auf Lese- und Schreiberwerbsprozesse.