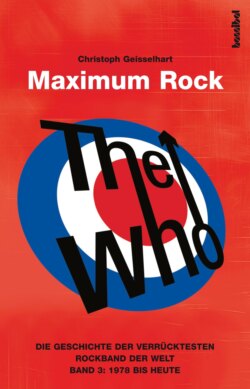Читать книгу The Who - Maximum Rock III - Christoph Geisselhart - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.: Wie der Hase so läuft: Der Wandel vom Quartett zur Fünf-Mann-Band
„Jungs, ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt, aber ich werde bei The Who mitmachen.“
Rabbit verkündet seiner Band Crawler den Ausstieg
„Sobald ich wütend werde, höre ich sofort auf. Schlagzeugspielen ist nichts, worüber man seinen Zorn auslässt.“
Kenney Jones über sein Selbstverständnis als Schlagzeuger
„Bringt Pete Townshend zurück auf die Straße mit The Who, tot oder lebendig!“
Johns Neujahrsmotto 1979
„Es kam mir vor wie das deutsche Woodstock.“
Who-Fan Andreas Mock über das Open-Air-Konzert in Nürnberg, den ersten Who-Auftritt ohne Keith Moon in Deutschland
Kenney Jones wurde im Dezember 1978 als gleichberechtigter Partner bei The Who offiziell vorgestellt. Roger hatte wieder einmal bewiesen, dass er Niederlagen schnell schlucken konnte, wenn es dem Wohl der Gruppe diente. Er stellte sich sogar entschiedener als Pete und John hinter den neuen Schlagzeuger und teilte jedem Journalisten mit: „Kenney ist jetzt ein Teil von uns, und wenn einer von euch sagt, dass wir ohne Keith nicht mehr dieselben sind, werde ich ihm persönlich die Beine brechen.“ Rogers vollmundige Kampfansage konnte freilich nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass The Who, abgesehen von ihm selbst, gar nicht mehr dieselben sein wollten.
„Ehrlich gestanden öffnete uns Keiths Tod ja eine Menge Türen“, befand Pete. „Kenney spielt nicht nur ganz anders als Keith – er ist auch ein viel bodenständigerer Drummer, der einer Band Rückhalt gibt. Er ist eine vollkommen andere Persönlichkeit. Keith war ein unglaublich positiver Musiker und Interpret, aber persönlich eine Bestie an Negativität. Er brauchte dich für seine Selbstdarstellung, auf und neben der Bühne. Kenney ist ein sehr viel positiverer Mensch; er passt auch gut zu den anderen Jungs in der Band.“
Kurz nach der Zusage von Kenney Jones hatten die Who auch den bereits vertrauten Keyboarder John „Rabbit“ Bundrick in die Ramport Studios eingeladen. „Ich denke, das war nur eine Art Vorwand, damit sie testen konnten, was ich im Studio drauf hatte“, erzählt der 1946 in Texas geborene Tastenspieler, der hauptsächlich mit dem Trio Free bekannt geworden war und den Spitznamen seinen prominenten Schneidezähnen verdankte:
„Wir arbeiteten vom 6. bis 10. November miteinander, und am letzten Tag bat mich Bill Curbishley zu einem Plausch mit Pete. Sie fragten mich offiziell, ob ich bei den Who mitmachen wollte. Ich sagte, ich müsse mit meiner Band Crawler noch eine Amerikatour machen. Sie akzeptierten meine Verpflichtung und meinten, wenn ich den Job haben wollte, sollte ich nach Abschluss der Tournee nach England zurückkommen und meinen Platz bei ihnen einnehmen. Mann, was für ein Leben! Allerdings wusste ich noch nicht, wie ich das den Jungs von Crawler beibringen sollte. Am 13. brachen wir nach Amerika auf. Nach einem Monat hatte ich immer noch nichts gesagt und stand so unter Druck, dass ich nach unserem letzten Auftritt fast platzte. Ende Dezember 1978 führte uns unser Manager zu einem Abschlussdinner aus. Wir tranken, aßen, redeten, und die anderen machten Pläne, wie es weitergehen sollte. An mir lief alles vorbei. Sie fragten mich, was los sei, und plötzlich explodierte ich wie ein Vulkan: ‚Okay, Jungs, das war’s. Ich steig’ aus, ich bin draußen. Macht, was ihr wollt, aber ich steige bei The Who ein.‘ Sie brachen in Gelächter aus und meinten: ‚He, Rabbit, wovon redest du? Du kennst die Who nicht mal, wer hat dich denn gefragt, ob du bei ihnen einsteigen willst?‘ Sie hielten es für eine typische Wahnidee von Rabbit, dem Spinner, aber ich sagte nur: ‚Oh doch, ich kenne sie. Sie haben mich gefragt, ob ich Crawler verlassen und bei ihnen einsteigen will, und ich habe gesagt: ,Ja, nach dieser Tour.‘ Also bin ich draußen, Jungs. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich fliege jetzt nach England und steige bei den Who ein.‘“
Und so wurden The Who zum Quintett. Das sakrosankte Konzept vom wilden Vier-Männer-Ensemble, das so viel Krach macht wie zehn Big Bands zusammen, gehörte also bereits acht Wochen nach Keiths Tod der Vergangenheit an – notgedrungen, denn es war vor allem Keith gewesen, der ein ganzes Orchester ersetzt hatte.
Pete begrüßte den Umstellungsprozess mit kaum verhohlenen Stoßseufzern, denn er hatte spätestens nach der anstrengenden Studioproduktion von Who Are You keinen Weg mehr aus der Sackgasse gesehen, in die er mit den Who unweigerlich geraten war, nachdem ihr Solist an den Pauken die erforderliche musikalische Weiterentwicklung nicht mitgehen konnte. Während Roger noch zögerte und sich unsicher fühlte, ob und wie Keith zu ersetzen sei, pflanzte Pete eine Wegmarke nach der anderen ein:
„Lange Zeit hatte ich mich eingeschränkt gefühlt, weil ich vorwiegend Rhythmusgitarre spielte. Deshalb wollte ich für die Band einen Keyboarder, der Klavier und Orgel spielte, und nach Möglichkeit noch einen zweiten Gitarristen, damit ich auf der Bühne mit Synthesizern arbeiten und verschiedene Gitarrenparts ausprobieren konnte. Damit wären wir endlich in der Lage gewesen, unsere komplexeren Kompositionen aufzuführen, die es ja in unserem Repertoire durchaus gab.“
Petes Wunschformation entspricht übrigens exakt der aktuellen Who-Tourband (2007/2009), die ja mit Petes Bruder Simon an der zweiten Gitarre, Zak Starkey am Schlagzeug, Pino Palladino am Bass und Rabbit an den Tasten sowie mit Pete und Roger ein Sextett ist.
Mit der Verpflichtung von Rabbit, der nicht als vollwertiges Mitglied aufgenommen wurde, sondern eher eine Art ständiger Mitarbeiter wurde, und mit Kenney Jones, der ein taktgenauer, sachlicher Schlagzeuger mit einem kraftvollen, aber traditionellen und wenig experimentierfreudigen Stil war, glaubte sich Pete musikalisch schon Ende 1978 so weit abgesichert, dass The Who aus dem zu eng gewordenen Korsett ausbrechen konnten. Auch für sich als Bühnenkünstler sah er neue Freiheiten, nachdem weder Rabbit noch Kenney als neue Kollegen sonderlich extrovertiert schienen. Rabbit verschanzte sich gern meist nahezu unsichtbar fürs Publikum hinter seinen Keyboards, und Kenney lehnte zu viel Emotionalität am Schlagzeug erklärtermaßen grundsätzlich ab: „Über die Jahre hinweg musste ich mir ständig anhören, wie toll das Leben als Schlagzeuger sei, weil ich doch meine Frustrationen samt und sonders an den Trommeln ausleben konnte. Das habe ich niemals getan. Im Gegenteil, sobald ich Wut und Ärger verspüre, höre ich sofort auf. Ich bin stolz darauf, ein akustisches Instrument zu spielen; das ist nichts, worauf man seinen Frust auslässt.“
Man mochte diese Äußerung auch als bewusste Distanzierung zum überirdischen Vorgänger Keith Moon auffassen. Kenney Jones galt als korrekter, gradliniger und kontrolliert lebender Mensch; er war glücklich verheiratet mit Jane Osborne, der Tochter des Dirigenten und Komponisten Tony Osborne, und Vater von zwei Söhnen, Dylan und Jesse. Die Neigung, sich auf und hinter der Bühne in Exzessen gehen zu lassen, kannte man von ihm nicht. Besser gesagt: Er zeigte solche Neigungen nicht, bis er bei The Who einstieg. Ian McLagan schilderte Kenney als Faces-Schlagzeuger noch als zurückhaltenden, fast schüchternen Mensch, der sich den Dramen des Musikgeschäfts meist klug fernhielt. Doch der Mythos oder die geheime Kraft hinter The Who erfasste den Neuen bald ebenso heftig wie die verbliebenen Bandmitglieder, die sich der Illusion hingaben, dass sie den Weg ihrer Gruppe nach Gutdünken lenken konnten.
Große Bands zeichnet stets eine besondere Fähigkeit aus: nämlich jene, dass sie über sich und ihre Rolle Klarheit erlangen und aus den internen Prozessen musikalische Energie beziehen, die sie an ihr Publikum weitergeben können. Gerade aus diesem Grund ist die Rockmusik ja hauptsächlich von Bands geprägt worden, also weniger von Einzelpersönlichkeiten wie etwa der Schlager, die Popmusik oder der Rock’n’Roll. Die gruppendynamischen Prozesse innerhalb einer Rockband scheinen auf die Anhängerschaft auszustrahlen, und das macht wohl auch ihre Magie und Identität stiftende Kraft aus. Einige große Gruppen haben den Verlust eines Gründungsmitglieds nie verkraftet und sich bald danach aufgelöst, wie Led Zeppelin, die nach dem Tod ihres Schlagzeugers John Bonham im September 1980 offiziell aufgaben – John Bonham wurde übrigens wie Keith nur zweiunddreißig Jahre alt, und er starb tatsächlich so, wie man es Keith zudichtete: an seinem Erbrochenen nach übermäßigen Alkoholkonsum. (Bonhams Sohn Jason, 1966 geboren und also fast gleich alt wie Zak Starkey, saß im Dezember 2007 am Schlagzeug, als Led Zeppelin noch einmal für ein groß angekündigtes Wohltätigkeitskonzert zusammenkamen.) Andere Musikerkollektive haben ihr internes Drama relativ offen in ihrem Werk verarbeitet, wie etwa Pink Floyd, die ihrem „Crazy Diamond“ Syd Barrett ein musikalisches Denkmal setzten, wenngleich wohl eher aus schlechtem Gewissen.
Die dritte – und offenbar erfolgreichste – Variante der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse ist, das Trauma unter den Teppich zu kehren. Die Rolling Stones haben das mit Brian Jones vorgeführt, und in gewisser Hinsicht folgten ihnen die Who in diesem Muster. Die hervorstechenden Talente von Brian Jones, seine leuchtende Bühnenpräsenz und die freie, vielschichtige Musikalität, wurden von den beiden stärksten Persönlichkeiten der Stones, Mick Jagger und Keith Richards, auf fast unheimliche Weise absorbiert, so dass die für die Band wichtigen Elemente trotzdem irgendwie erhalten blieben. The Who hatten mit Keith Moon vor allem ihre irrwitzige, anarchistische Radikalität verloren. Doch auch hier entstand eine seltsame Eigendynamik, aufgrund derer die verbliebenen – und in Maßen auch die neu hinzugewonnenen – Bandmitglieder anscheinend die Anteile neu belebten, die durch Keiths Tod abhanden gekommen waren.
Beobachten ließ sich diese Entwicklung besonders an Pete, der sich unmittelbar nach Keiths bedrückendem Abgang in Hyperaktivität stürzte, die er, seiner Gewohnheit folgend, mit erhöhtem Alkoholkonsum begleitete. Im schon erwähnten und von Dennis Wholey (sic!) geschriebenen Büchlein über Alkoholismus The Courage To Change (1984) erzählt er:
„Ich hatte immer das Gefühl, dass Trinken und Arbeit in völlig angemessener und passender Weise zusammengehörten. Meine Frau erkannte darin ein potenzielles Problem, während ich der Auffassung war, dass es zu mir und zu meinem Lebensstil gehörte. Und das, obwohl ich in Roger Daltrey einen großartigen Partner hatte, der niemals exzessiv trank, nicht am Beginn unserer Karriere und bis heute nicht. Aber ich meinte, ich trüge mehr Verantwortung, weil ich die Songs schrieb und der Sprecher der Gruppe war.“
Petes Erklärungen klingen heute ziemlich einsichtig, aber sie machen nicht plausibel, weswegen er in die gleichen Konflikte rutschte wie vor ihm Keith Moon. Seine Ehe und das ihm heilig gewordene Familienleben gerieten im Verlauf des Jahres 1979 plötzlich aus den Fugen, und erstmals seit seiner bislang ernsthaftesten Krise Anfang der siebziger Jahre, als mit dem Scheitern von Lifehouse auch seine künstlerische Existenz auf dem Spiel gestanden hatte, zeigte Pete 1979 auf der Bühne ein Ausmaß von Trunkenheit, das ihn erkennbar in seinen Fähigkeiten beeinträchtigte.
Noch überdeckte er allerdings die drohende Gefahr mit der rastlosen Geschäftigkeit eines Keith Moon zu seinen besten Zeiten. Pete wirkte nicht nur am Quadrophenia-Film mit und an Paul McCartneys Rockestra, sondern auch am neuen Soloalbum des Ex-Beatle, Back To The Egg. Außerdem begann er eine Vielzahl eigener Projekte; er arbeitete mit seinem Schwiegervater Ted Astley und mit dem jungen Baba-Anhänger Raphael Rudd im Studio, er schrieb ein Fernsehspiel, engagierte sich gegen Rassismus und nahm noch einige Songs für ein Wohltätigkeitsalbum auf, dessen Erlöse Meg Pattersons neu eröffneter Suchtklinik in Sussex zuflossen. Die Produktion hieß The Free Charity Album und umfasste neben Who-Songs auch Beiträge anderer Musiker mit schmerzhafter Drogenvergangenheit wie Eric Clapton, George Harrison, Keith Richards und Jack Bruce.
Mit Beginn des Jahres 1979 standen überdies auch die Proben für die geplante Who-Tournee auf dem Programm. Sie sollte nach dem Willen des Managements zeitgleich mit der Premiere von Jeff Steins Dokumentation The Kids Are Alright bei den Filmfestspielen von Cannes starten. Doch Roger bestand darauf, dass die englischen Fans ein Anrecht hatten, die neu formierte Band als erste zu sehen, und so wurde eilig ein Konzert im Rainbow Theatre arrangiert, wo die Gruppe bei Proben eigentlich nur den letzten Schliff an ihr Programm legen wollte. Die Show wurde gerade einmal achtundvierzig Stunden vorher angekündigt – und war in weniger als einer Stunde ausverkauft. Auch dies ist wohl ein weiterer und oft zitierter Beleg dafür, dass The Who mit dem wiedererwachten Modkult ganz oben schwammen. Im Melody Maker stand jedoch über das Konzert zu lesen:
„Der Anteil der Modbelegschaft war bestürzend gering. Ein halbes Dutzend Parkaträger, eine Flaggenjacke und eine einsame Lambretta Li150, auf die nicht mal ein zusätzlicher Scheinwerfer montiert war. Falls die hastig auf die Beine gestellte Who-Feier eine Armee von alternden Mods aus ihren Höhlen gelockt hatte, dann waren die meisten von ihnen in Tarnung unterwegs.“
Waren die in Zeitungen und Who-Chroniken besungenen Heerscharen eines neuen Modkults also nur ein Medienphantom? Der Ex-Mod Kenney Jones musste an diesem 2. Mai 1979 in jedem Fall aus der Deckung kommen, um seinen Einstand als Nachfolger Keith Moon zu geben, der allgemein als unersetzlich gegolten hatte. „Mir standen nur fünf Tage zur Verfügung, um zehn Jahre Material einzustudieren“, sagt Kenney. Die Osterferien hatten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Band konnte deswegen nicht die vereinbarten zwei Wochen lang proben. „Alle dachten natürlich, dass ich die Who-Songs bestens kannte, aber mein Gedächtnis war schon immer miserabel, und alles, woran ich mich erinnern konnte, waren alte Faces-Songs. Die Proben waren ein ziemlicher Alptraum.“
Man darf aber annehmen, dass Kenney Profi genug war, um sich mit den relevanten Who-Songs auf anderem Weg vertraut zu machen, auch wenn er Roger, John und Pete sagte, dass er bei sich zu Hause nicht die ganze Zeit ihre Platten laufen lasse. Solche Äußerungen zielten vermutlich eher darauf ab, erstens den schier übermenschlichen Erwartungsdruck zu mildern, den Kenney fraglos verspürte, und zweitens deutlich zu machen, dass hier nicht irgendwer in die zu großen Fußstapfen eines Trommeltitans treten wollte, sondern dass es Kenney Jones war, ein Mann mit eigenständigem Profil und eigener ruhmreicher Vergangenheit.
Zur Premiere der neuen Who im Rainbow Theatre war es dreitausendfünfhundert Fans gelungen, eine Eintrittskarte zu ergattern, und sie wurden Zeugen eines erstaunlichen Neubeginns, wie der Melody Maker berichtete:
„Fünf Figuren betraten gegen halb neun im Laufschritt die Bühne und stürzten sich in eine eigenwillige, fast respektlose Darbietung von ‚Substitute‘, was das gesamte Publikum vom ersten Takt an auf die Beine riss. Für die nächsten beiden Stunden setzte sich niemand mehr hin. Dass die Band ein Killerset hinlegen würde, wurde schon nach der Hälfte der nächsten Nummer klar: ‚I Can’t Explain‘ hatte nichts gemeinsam mit den heimeligen Erwartungen, die sich die Fans offenkundig auf die Fahnen geschrieben hatten. Daltrey, Townshend und Entwistle spielten in Bestform; Bundrick und Jones bemühten sich, deren einschüchternde Präsenz durch eine Mischung aus Zuversicht und Entschlossenheit zu bekräftigen. Es soll festgehalten werden, dass Kenney Jonnes nicht Keith Moon ist und auch nicht versuchte, dessen einzigartigen Stil nachzuäffen. Er hielt sich klug an eine Spielweise, die sich irgendwo zwischen Carmen Appice und Prairie Prince bewegt, was heißt, dass er alle erforderlichen Ausschmückungen einflocht, ohne sich um die notwendige Aufgabe zu drücken, eine machtvolle Basis für Bass und Gitarre zu bilden. Er begann sichtlich bange, sogar nervös, bis Daltrey, wie um die Befürchtungen der Anhängerschaft zu zerstreuen, in gespieltem Ernst ‚zwei neue Mitglieder der Band‘ vorstellte: Entwistle und Townshend. Erst daraufhin verschwand einiges von der Anspannung in seinem Gesicht.“
Aufmerksamen und kundigen Beobachtern entging freilich nicht, dass Jones, der früher auf einem eher elementaren Schlagzeug agiert hatte, plötzlich hinter einer ähnlichen Trommelburg saß wie sein legendärer Vorgänger. Er nutzte die ganze Bandbreite des fünfzehnteiligen Schlagzeugs aber kaum – ja, er gestand sogar unumwunden ein, dass zumindest die zweite Basstrommel für ihn ein bloßes Zierobjekt war. Ob Roger, Pete und John ihm das überproportionale Drumkit verordnet hatten, um ihre musikalische Tradition dem Anschein nach fortzuführen, oder ob Kenney sich selbst hinter die monumentale Beschickung versetzt hatte, blieb ungeklärt und war letztlich auch unwichtig, solange er erfüllte, wofür ihn Pete und John engagiert hatten: eine eher solide als einfallsreiche Quintessenz des Schlagzeugfeuerwerks wiederzugeben, das Keith Moon als erratischer Pionier seiner Zunft in vierzehn Jahren in die Welt gesetzt hatte.
Ganz neue Songs präsentierten The Who ohnehin nicht. Vom letzten Album gab es aber immerhin drei Kostproben: „Who Are You“, „Sister Disco“ und, als wichtigster Triumph der Erneuerung, „Music Must Change“, jenen musicalartigen Sechsachtelschunkler, an dem Keith Moon im Studio gescheitert war. Kenney bewältigte das für Rockmusiker eher untypische Metrum souverän. Damit wurde „Music Must Change“ natürlich kein besseres Stück, jedenfalls kein mitreißender Who-Song. Doch der Beweis war erbracht, dass die neue Besetzung mit Kenney und dem unauffällig das Soundspektrum erweiternden Rabbit, dessen Keyboards meist deutlich leiser abgemischt waren als Rogers Stimme, das zeitgemäße Medium darstellte, das Pete für seine neuen Kompositionen brauchte. Zwar gab es diese neue Stücke noch nicht, oder sie blieben in Petes Asservatenkammer verborgen, aus der er sich bald für sein erstes Soloalbum bediente; doch The Who spielten im Rainbow immerhin noch zwei Quadrophenia-Titel, die früher gern daneben gegangen waren, „The Punk And The Godfather“ und „The Real Me“, dazu das von Pete als notwendig erachtete „Dreaming From The Waist“, ebenfalls ein schwieriger Song mit Taktwechseln.
All dies funktionierte so reibungslos, dass die Fans glücklich und die Kritiker des Lobes voll waren: „Es war ein hervorragender, großartiger, wunderschöner Rock’n’Roll-Auftritt: nicht mehr und nicht weniger; eine erstklassige Show, wie nur The Who sie zustande bringen können“, schrieb der New Musical Express. „Auf rätselhafte und magische Weise belebten The Who ihre Geschichte nicht nur neu, sondern sie gestalteten sie um, als begännen sie wieder von vorn.“ Dieser letzte Satz gilt bis heute und ließe sich problemlos in eine Konzertkritik der jüngsten Who-Tournee einfügen.
Auch Pete und John waren sehr zufrieden. „Ich muss mich nicht mehr so viel um die Drums kümmern“, sagte ein sichtlich entspannter Who-Bassist nach der Show. „Keith war so unberechenbar; ich hatte ständig Sorgen, dass er aus dem Takt geriet. Kenney ist viel beständiger, und man kann mit ihm viel einfacher zusammenspielen. Es gibt wohl keinen Schlagzeuger auf der Welt, mit dem das Zusammenspiel schwieriger war als mit Keith.“ Schwieriger, aber eben auch ergiebiger, wie man bald merken sollte. Roger lag nicht falsch in seiner Analyse, dass Keith Moons „Funktion nicht bloß ‚bumm-tschick‘ war. Seine spezielle Spielweise hielt den ganzen Laden zusammen. Wenn man dagegen Kenney nimmt ... alles, was der machte, war ‚bumm-tschick-bumm-tschick‘, und das brachte mich fast zum Wahnsinn. Manchmal wäre ich auf der Bühne am liebsten gestorben.“
Roger war der einzige in der Band, der sich fortan uneingeschränkt zum Keith-Moon-Fan erklärte. Er hatte auch äußerlich den radikalsten Schnitt vollzogen. Seine blonden Engelslocken waren dem Fortschritt zum Opfer gefallen, Tommy gab es nicht mehr. Jetzt gab es Mods und New Wave und eine anstehende Filmrolle als McVicar, und deswegen trug Roger das Haar nun kurz und akkurat. „In seiner schwarzen Bomberlederjacke sah er kerniger aus und sang kraftvoller denn je und gab damit anderen Fünfunddreißigjährigen im Publikum neue Hoffnung, die sich gefragt haben mochten, ob sie es auf irgendeine Weise bis an die Vierzig schaffen konnten“, kommentierte Mark Williams im Melody Maker.
Solcherart gestützt, gestutzt und gestärkt setzten The Who in der Woche nach der Rainbow-Premiere nach Frankreich über, um die Erstaufführungen ihrer beiden Leinwandproduktionen The Kids Are Alright und Quadrophenia zu bewerben, die beide bei den Filmfestspielen von Cannes starteten. Zeitgleich dazu fanden am 12. und am 13. Mai zwei Who-Konzerte vor insgesamt fast achtzehntausend ekstatischen Fans im Amphitheater von Fréjus statt. Schon der erste Auftritt bestätigte den hervorragenden Eindruck, den die neuen Who bei ihrem Debüt in London hinterlassen hatten. Die vielen mitgereisten englischen Journalisten waren des Lobes voll. Nach der Show offenbarte sich freilich auch der Unterschied zu früher, wie der langjährige Wegbegleiter Chris Welch vermerkte:
„Auf der Filmleinwand nahm Keith Moon sein Schlagzeug auseinander und schleuderte die Reste inmitten von Rauchwolken und dem glorreichen Kreischen des Feedbacks übers Parkett. Auf der Bühne dagegen trieb Kenney Jones die Who zu einer neuen Reife voran. Die beiden verkörpern vielleicht den stärksten Kontrast zwischen damals und heute. Keith hätte jede Minute dieses Medienspektakels in vollen Zügen genossen. Oben-ohne-Nixen am Strand von St. Tropez, Filmpremieren in Cannes, Konzerte in einem römischen Amphitheater, Partys, Pressekonferenzen – er hätte alle seine Rollen mit manischer Inbrunst ausspielen können.“
Zweifellos wurde Keith trotz seiner schicksalsbedingten Abwesenheit zum heimlichen Star der Who-Filmfestspiele von Cannes. Jeff Steins Dokumentation The Kids Are Alright war beinahe so etwas wie ein Denkmal für den Medienclown Moon the Loon geworden – sehr zum Verdruss übrigens von John, der sich als musikalischer Leiter mit vollem Einsatz in das Projekt geworfen hatte und seine Rolle hinter den Kulissen unter Wert gewürdigt sah. Pete wurde sowieso ständig zitiert, obwohl er den Regisseur angewiesen hatte, jedem Bandmitglied die gleiche Präsenz zuzugestehen. Roger stand als Sänger bei allen Musikszenen im Fokus der Kameras, und Keith sorgte für die Unterhaltung und für die publikumswirksamsten Zitate – John hatte allmählich die Nase voll, immer nur den bescheidenen Schattenmann abzugeben. Sein Vorstoß kurz vor der Premiere, Keiths Dominanz durch einen Neuschnitt des Films zurückzudrängen, musste aus Zeitgründen jedoch vertagt werden.
Auch Roger war mit dem wilden Leinwandmachwerk zunächst nicht zufrieden. Ihn störte wie John die fehlende Professionalität, und er sann recht laut darüber nach, ob es klug gewesen war, die Aufgabe einem jugendlichen Anfänger wie Stein zu überlassen. Pete hielt sich weitgehend bedeckt, aber ihm war ebenfalls anzumerken, dass er nicht allzu begeistert war: „Es ist ja keine richtige Dokumentation über The Who oder über ihre Geschichte, sondern bloß eine Sammlung von allem, was gerade verfügbar war“, erklärte er in der Zeitschrift Sounds.
Dagegen fand Steins Who-Hommage volle Zustimmung bei den Fans und weitestgehend auch bei der Kritik, die den Film tatsächlich als Nachruf auf Keith Moon verstand, obwohl der trommelnde Derwisch definitiv erst nach dessen Fertigstellung verstorben war. Die New York Times bezeichnete den Film überdies als „eigensinnig uninformativ“, was für den jungen Regisseur, der sich vom bandinternen Gerangel um sein Erzeugnis bemerkenswert unbeeindruckt zeigte, das größte Kompliment darstellte, das man ihm machen konnte: „Der Film ist schließlich nicht für Menschen gemacht worden, die die Times lesen“, meinte Stein, „sondern für die Leute aus Queens und aus Brighton. Ich wollte niemals eine gradlinige, chronologische Dokumentation schaffen. Ich wollte kein historisches Dokument. Ich wollte ein hysterisches Dokument.“
Das ist ihm zweifellos gelungen. The Kids Are Alright ist unter den Rockmusikfilmen bis heute einmalig und in gewisser Weise unerreicht. Roger, der das Werk bald mit den Augen der Fans zu sehen gelernt hatte, beschreibt das entscheidende Kriterium: „Die meisten Rockmusikfilme sind sehr prätentiös. Sie werden nur für den Zweck produziert, Robert Plants Schwanz groß aussehen zu lassen. The Kids Are Alright ist völlig anders. Innerhalb der ersten halben Stunde werden wir zu kompletten Idioten gemacht.“
Und genau deswegen liebten die Fans diesen Film, der die Höhepunkte der Band so unterhaltsam und so spektakulär festhielt. Jeff Stein hatte es auf den Punkt gebracht, ein Fan, der für seinesgleichen gesammelt hatte, was die Who vierzehn Jahre lang geboten hatten: großartige Musik, einzigartige Charaktere und Keith Moons unsterblichen Humor, der vor der eigenen Person nicht haltmachte, geschweige denn vor seinen Bandkollegen. Und der ganze anarchistische Witz wurde melancholisch umweht vom Trauerflor, den der zu früh verschiedene Hauptdarsteller – oder Selbstdarsteller – aus dem Jenseits herüberflattern ließ, eine süßlich schmerzhafte Gewissheit, dass die dargestellte Zeit unwiederbringlich vorüber war. Erst das machte den Film richtig groß – der Tod seines wichtigsten Akteurs.
Der Erfolg strahlte vor allem auf das von John mit viel Liebe und Mühe produzierte Soundtrackdoppelalbum ab. Es erreichte Platz acht in den US-Longplay-Charts, was den perfektionistischen Who-Bassisten schließlich doch einigermaßen versöhnlich stimmte. Insgesamt freilich genügte Steins Konzept nicht, um über die Kritiker und die zahlenmäßig begrenzte Who-Fangemeinde hinaus massenhaft Kinobesucher anzuziehen. The Kids Are Alright wurde kein Kassenschlager, was die Unzufriedenheit der Band vielleicht am besten erklärt. Entsprechend hoffnungsvoll sahen die Who ihre zweite Produktion in Cannes, die eher das Zeug zum Publikumsmagnet hatte. Quadrophenia war laut Pete ein sehr kraftvoller Film: „Wir treten darin nicht auf, und es gibt nicht gerade höllisch viel Musik zu hören, aber wir sind sehr stolz darauf. Das beste für mich ist, dass es nun nichts mehr zu erklären gibt an Quadrophenia. Die Story ist eindeutig und jeder kapiert sie.“
Pete schielte unverkennbar schon in Richtung USA, wohin die Who im Spätsommer für eine ausgedehnte Tournee reisen wollten und wo Quadrophenia fünf Jahre vorher im Dschungel des anglo-amerikanischen Kulturaustauschs stecken geblieben und grandios gescheitert war. Der Film erlitt jedoch dasselbe Schicksal wie das Album und blieb in Nordamerika nur ein Insidertipp: Die Modkultur war ein allzu britisches, bestenfalls europäisches Phänomen, und die vordergründige Auseinandersetzung zwischen Mods und Rockern – mochte sie noch so sehr die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen auf der ganzen Welt thematisieren – erreichte das ländliche Amerika überhaupt nicht und seine Großstädte nur in Maßen.
In England hingegen, wo der Film im Sommer in die Kinos kam, erfüllten sich die Hoffnungen der Band und des Regisseurs, der einen klassischen Leinwandstreifen mit allen Effekten und Emotionen schaffen wollte, um das gesamte jugendliche Publikum zu erfassen. Die Themenbereiche Mobilität, Gewalt, Gruppenkonflikte, Rebellion gegen Autorität, Identitätsentwicklung und Rockmusik sprachen die Zielgruppe an – zumal in einer Zeit, da jeder männliche Teenager in den Industrieländern West- und Mitteleuropas, der etwas auf sich hielt, ein Mofa, Moped oder Kleinkraftrad haben wollte, eine Vespa oder gar ein richtiges Motorrad.
Rocker, ob gewaltbereit oder friedlich, waren überdies häufig in den Schlagzeilen, vor allem wegen der martialisch auftretenden Hell’s Angels, denen eine bedenkliche Nähe zur Kriminalität nachgesagt wurde. In Deutschland, wo man bisher wenig von Mods gewusst hatte, spielten die Zeitläufe der Band thematisch wie publizistisch besonders in die Karten. Die Hamburger Abteilung der Hell’s Angels beispielsweise terrorisierte die Szene in St. Pauli unverhohlen schlagzeilenträchtig mit Schutzgelderpressungen und Gewaltdemonstrationen, bis sie 1983 als „kriminelle Vereinigung“ verboten wurde. So urteilte der deutsche Film-Dienst durchaus positiv über Quadrophenia: „Der Film ist dank guter Darsteller und schwungvoller Regie ein bemerkenswertes Generationsporträt ohne falschen nostalgischen Glamour.“
Die Besetzung der vielleicht interessantesten, da ambivalenten Figur des gescheiterten Modführers Ace mit einem aufstrebenden New-Wave-Musiker namens Sting, der mit seiner fulminanten Drei-Mann-Band The Police musikalische und modische Akzente gesetzt hatte, erwies sich ebenfalls als kluger Schachzug mit internationaler Auswirkung. Hits wie „So Lonely“, „Roxanne“, „Can’t Stand Losing You“ oder „Message In A Bottle“ erreichten bis zum Filmstart (in Deutschland am 19. November 1979) auch Kontinentaleuropa, und manch einen oder eine zog es danach sicherlich ins Kino, um den neuen Popstar mit dem blondierten Haar zu sehen. New-Wave-Musiker hatten gegenüber den zu mutwilliger Hässlichkeit tendierenden Punkrockern ein vergleichsweise sauberes, properes Image, das den weiblichen Teil des Publikums deutlich mehr ansprach. Dem 1951 geborenen Gordon Matthew Thomas Sumner diente Quadrophenia jedenfalls als perfektes Sprungbrett für seine Weltkarriere unter dem Namen Sting.
Vor den Filmen – Steins Spektakel erreichte im Winter 1979 ebenfalls die Bundesrepublik – kam jedoch die Originalmusik live nach Deutschland. Jawohl, nach dreieinhalb Jahren Pause und nach Auftritten in Paris, Glasgow, Edinburgh und London, wo Pete nach eigener Auskunft so betrunken gewesen war, dass er das Solo des ihn begleitenden klassischen Gastgitarristen glatt verschlief, beehrten die Who auch ihre deutschen Fans wieder mit einem Konzert. Und mit was für einem! Der Auftritt am 1. September 1979 auf dem Zeppelinfeld von Nürnberg war eine der größten Rockmusikveranstaltungen, die bis dahin in Deutschland stattgefunden hatten. Veranstalter Fritz Rau hatte diesen Megaevent perfekt organisiert. Sogar die letzte Hürde, einen Zollbeamten, der den Who zunächst die Einreise verwehrte, weil ihre Pässe nicht in Ordnung waren, überwand der Konzertpromoter mit dem untrüglichen Gespür souverän. Die damals unerhörte Investition von über einer Million Mark für ein Rockmusikspektakel sollte sich für Lippmann und Rau lohnen. Mehr als fünfundsechzigtausend Menschen kamen, um die neuen Who zu sehen – und natürlich auch so prominente Vorgruppen wie AC/DC, Cheap Trick oder Scorpions. Unter den Besuchern war Andreas Mock aus Kassel, der den weiten Weg nach Nürnberg im Sportwagen des Klavierlehrers seiner Freundin auf sich genommen hatte:
„Ines war schuld, dass ich als Teenager zum Who-Fan geworden war und mir im Alter von fünfzehn Jahren ein Schlagzeug von meinen Eltern gewünscht hatte. Sie schwärmte für ‚Tommy‘ Roger Daltrey, und wenn ich sie besuchte, lief den ganzen Nachmittag dieses Doppelalbum. Wir waren dermaßen infiziert, dass ich mein Drumkit in ihrem Klavierzimmer aufbaute, und wir versuchten allen Ernstes, Tommy in der Besetzung von Klavier und Schlagzeug (!) nachzuspielen.“
Ein solches Vorhaben hätte vermutlich der Ausnahmetalente von Keith Moon und Rabbit Bundrick bedurft, um auch andere Menschen als die beiden entflammten Nachwuchsmusiker zu entzücken. Aber dermaßen für Schlagzeug und Klavier sensibilisiert, ist Andreas Mock natürlich ein geeigneter Zeuge des erst neunten Auftritts der Band mit Drummer Kenney Jones und Keyboarder Rabbit. Bei dreißig Grad Außentemperatur und nach vier Stunden auf dem Notsitz des Sportwagens – Ines durfte natürlich neben dem Klavierlehrer Platz nehmen – erreichte das Trio den monumentalen Ort des Geschehens: das Zeppelinfeld, Teil der gigantischen Anlage, die Hitlers Baumeister Albert Speer einst für die Aufmärsche der Reichsparteitage in Nürnberg hatte errichten lassen. Andreas Mock erzählt:
„Die Vorgruppen versuchten mit mehr oder weniger Erfolg, die Massen zu begeistern. Aber erst AC/DC schafften es, die Menge zum Toben zu bringen. Ich kam mir vor wie beim deutschen Woodstock. Ich fühlte mich wie im Traum. Auf der Bühne erschienen meine Helden Roger, Pete, John – gern hätte ich natürlich mein Vorbild Keith Moon gesehen, der fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor gestorben war und der sicherlich durch niemand ersetzt werden konnte; doch Kenney Jones machte einen guten Job und passte damals hervorragend ins Konzept der Band. The Who boten ein unglaubliches Spektakel aus Lautstärke und Lichteffekten. Die Lasershow, damals eine Revolution in Sachen Bühnenbeleuchtung, erzeugte bei ‚Won’t Get Fooled Again‘ eine fantastische Atmosphäre. Zum Abschluss dann mein persönliches Highlight: ‚See Me, Feel Me / Listening To You‘, das Tommy-Finale. Mir kam es vor, als spielte die Band dieses Stück länger als fünfzehn Minuten, die Menschen wollten gar nicht aufhören zu singen. Es war das Größte, was ich in meiner jungen Karriere als Who-Fan erlebt hatte, und mir war es auch egal, die Rückfahrt wieder zusammengekauert in diesem dämlichen Sportwagen verbringen zu müssen. Ich hatte etwas Einmaliges erlebt und gesehen: die bis heute größte Rockband aller Zeiten live!“
Unser Zeuge erinnert sich noch, dass der Auftritt in Nürnberg ein enormes Presseecho zeitigte und Ausschnitte davon anderntags sogar in der Tagesschau gesendet wurden. Insofern gilt: Härtetest bestanden. Rabbit und Kenney fügten sich harmonisch in die Gruppe ein; die deutschen Fans waren hingerissen, und der Boden für die Filme Quadrophenia und The Kids Are Alright, die wenig später in die Kino kamen, war bereitet.
Das Open-Air-Konzert in Nürnberg war der letzte kontinentale Probelauf unter ähnlich kolossalen Bedingungen, wie sie die anschließende Tournee durch die Vereinigten Staaten mit sich brachte. The Who schienen bestens dafür gerüstet.