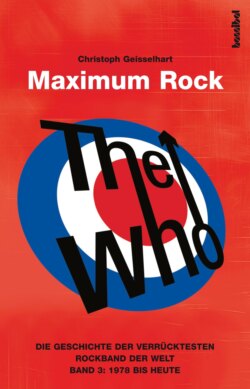Читать книгу The Who - Maximum Rock III - Christoph Geisselhart - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4.: Empty Glass: Die wilde Tour der leeren Gläser und die Frage, ob Pete im Alleingang die besseren Who-Songs macht
„Die meisten meiner Songs handeln von Jesus.“
Pete Townshend
„Genau besehen macht Pete Townshend sowieso bessere Who-Platten als die Who selbst.“
Keith Richards, Rolling-Stones-Gitarrist
„Völliger Blödsinn.“
Johns Antwort auf Keith Richards
„Ich sollte in fünf Jahren acht Alben produzieren. Alle Songs schreiben, aufnehmen, touren, Öffentlichkeitsarbeit machen – völlig unmöglich, das zu schaffen.“
Pete über die lukrativen, aber auszehrenden Plattenverträge 1979/1980
„Ich kam mir oft genug wie im Gefängnis vor – nach wilden Partys in zerstörten Hotelzimmern.“
Roger Daltrey über seine Rolle als McVicar
Je länger Keith Moon tot war, desto mehr schien sich seine Abwesenheit bemerkbar zu machen. Eine seltsame Schwere begleitete die Band, eine Art von alptraumhafter Benommenheit, die nach der Tragödie von Cincinnati fast mit Händen zu greifen war. Wie sehr hätte man in dieser Situation Keiths Unbekümmertheit brauchen können!
Mit der Fortsetzung der Tournee verblassten die Eindrücke des Unglücks natürlich; seine Folgen blieben jedoch unübersehbar. Das erste Konzert fand am Tag danach statt, passenderweise im Memorial Auditorium von Buffalo. Es begann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit fast zwei Stunden Verspätung, um allen Fans Gelegenheit zu geben, in Ruhe einen Platz zu finden. The Who, die wegen der Ereignisse spät angekommen waren, verzichteten auf den obligatorischen Soundcheck. Gleichwohl lieferten sie laut Augenzeugenberichten „eine der besten Shows, die die Stadt je gesehen hat.“
Der emotional immer noch stark aufgewühlte Roger widmete das Konzert den Opfern der Katastrophe vom Vorabend. Die Band erfuhr sehr große Loyalität und Unterstützung von Fans und Medien, in den USA sogar noch mehr als in Großbritannien. Einige Veranstalter und Kommentatoren sahen sich freilich in der Auffassung bestärkt, dass die sogenannte „britische Rowdyband“ einen Risikofaktor darstellte. In ihren Köpfen geisterte die Vorstellung einer ekstatischen Gewaltorgie herum, bei der die durch Rockmusik aufgepeitschten Fans in der Arena des Coliseums außer Kontrolle geraten waren. Man erinnerte sich an Townshends rituelle Gitarrenvernichtung und schloss daraus, dass die Toten von Cincinnati Opfer einer in unverantwortlicher Weise mitreißenden Bühnenshow geworden waren. Dass die Menschen vor den Toren der Halle zerdrückt worden waren, weil die städtischen Ordnungskräfte versagt hatten, wurde über das Vorurteil von drogenberauschten heidnischen Musikern, die nicht minder berauschte Jugendliche aufwiegeln, übersehen.
Die Band und ihr Management standen jedenfalls nach Cincinnati unter noch argwöhnischerer Beobachtung, zumal sie in Schadensersatzprozesse verwickelt wurden, die sie zum Teil noch jahrelang beschäftigten. Obwohl alle Klagen und Regressansprüche nach und nach und ohne Wenn und Aber abgewiesen wurden, litt der Ruf der Gruppe darunter. Vielleicht noch mehr als die Band litten aber die Fans unter den oft ermüdenden und ernüchternden Schutzmaßnahmen, die fortan bei allen Konzerten ergriffen wurden.
„Sofort nach Cincinnati verdoppelten, verdreifachten, vervierfachten wir die externen Sicherheitskräfte, teilweise auch, um Schuldzuweisungen abzuwehren“, erzählt Pete. „Das war ja das Problem in Cincinnati gewesen: die externen Ordnungskräfte, Leute, die wenig Erfahrung mit Rockkonzerten hatten, deren mangelhaften Kenntnisse und Kommunikation. Aber nach einer Weile beschwerten sich die Kids. Überall, wohin sie blickten, standen Bullen. Das verdarb ihnen den Abend. Sie dachten, okay, es geschah in Cincinnati, aber doch hier nicht. In Seattle beklagte sich sogar eine Zeitung über allzu viele Sicherheitskräfte, die Jugendlichen von Seattle hätten sich schließlich immer anständig betragen. Ehrlich gesagt finde ich, dass man das Festival Seating ziemlich zu unrecht für alle Probleme verantwortlich machte. Das war eine schlimme Überreaktion. Ich mag Festival-Seating. Wenn ich zu einem Konzert gehe, will ich nicht an einem blöden nummerierten Sitz festkleben und mir jedes Mal Beschwerden anhören, sobald ich aufspringe. Ich will herumgehen können oder tanzen oder mir eine Cola holen, mich nach vorne durchkämpfen oder von hinten zuschauen. Auch von meiner Position von der Bühne herab kann ich sagen, dass man mit Festival Seating die beste Stimmung erzielt.“
Auch Richard Barnes monierte die teils übertrieben wirkenden Sicherheitsvorkehrungen:
„Bei vielen Konzerten nach Cincinnati waren Hunderte von Polizisten und Sicherheitskräften im Einsatz. In manchen Örtlichkeiten konnte man kaum sich kaum vom Sitz erheben, ohne dass man von Ordnern bedroht wurde. In einer Halle hatte die Polizei Spezialkräfte mit Hunderten von Hunden um die Bühne herum platziert, als The Who hereinkamen.“
Liest man die Berichterstattung über die auf Cincinnati folgenden zehn Konzerte dieses Tourabschnitts, findet man allerdings nicht viele Anhaltspunkte für eine niedergedrückte oder verhaltene Stimmung im Auditorium. Im Gegenteil, die Fans ließen sich von überbesorgten Ordnern und bisweilen unsinnigen Polizeiaufmärschen in ihrer Euphorie kaum bremsen. Musikalisch boten die Who stets ausgezeichnete Vorstellungen; sie sprühten vor Spielfreude und überraschten ihre Anhänger mit vielen spontanen Einlagen und Variationen. Die Setliste zeugt von enormem Selbstvertrauen der Band und von einer Sicherheit, die nicht zuletzt dem soliden Kenney Jones zu verdanken war.
Heute wird die Ära des braven Taktgebers Kenney oft negativ gesehen, was nicht fair ist, da sich die Probleme der Gruppe weniger an seiner Person festmachen lassen, sondern nach Keiths Tod vor allem mit Petes persönlicher Entwicklung zusammenhingen. Sicherlich hätte man sich Keiths Clownereien bisweilen gewünscht, doch die Who-Fans empfingen den uneitlen, bodenständigen Kenney überwiegend mit Begeisterung, in England dank seiner glaubwürdigen musikalischen Vergangenheit sowieso, in den USA wegen seines kraftvollen, gradlinigen Stils und seines bescheidenen Auftretens.
Auf der Bühne zeigten sich The Who also wieder einmal als starke energiegeladene Einheit mit einem großartigen Repertoire an unsterblichen Klassikern und einigen sensiblen, komplexen Neukompositionen. Hinter den Kulissen freilich herrschten alles andere als Eintracht und Euphorie. Der Burgfriede nach Kenneys Verpflichtung zwischen Pete und John auf der einen Seite und Roger auf der anderen wurde unter dem Druck der wechselvollen Ereignisse und wegen der unterschiedlichen Gepflogenheiten auf Tour schnell wieder sehr brüchig. Tourbegleiter Richard Barnes notierte:
„Roger geht meistens eigene Wege. Er raucht und trinkt nicht und ist versessen auf Sport. Eine der fünf Limousinen im Who-Konvoi ist stets strikt rauchfrei wegen Roger. Tabakrauch greift seine Stimme an, und deswegen geht Roger Rauchern aus dem Weg, wenn immer es möglich ist. Er benötigt volle acht Stunden Schlaf, auch aus diesem Grund beteiligt er sich kaum an späten Partys oder an Ausflügen in Diskos. Er lebt nach einem völlig anderen Zeitplan als der Rest der Gruppe. Pete, Kenney und John hingegen machten ziemlich viel Party während dieser und der beiden USA-Tourneen von 1980. John und Kenney traf man fast immer an der Hotelbar, und an freien Tagen trieben sie sich in Klubs herum und versuchten, Rogers Enthaltsamkeit auszugleichen. Während der ersten Tournee schien Roger besonders zum Ziel der Späße seiner Kollegen zu werden. Vor allem natürlich weil er nie zugegen war, aber auch wegen seines Ernährungsbewusstseins, seiner extremen Sorge ums Geld und seiner Unfähigkeit, sich zu entspannen. Er hatte eine eigene Masseuse dabei, die ihn nach jeder Show durchwalkte. Auch über Rogers Geschäftstüchtigkeit wurden viele Witze gerissen. Wenn die Band zum Beispiel zu spät aus den Garderoben kam, sagte jemand von der Crew: ‚Ich krieg’ die Jungs schon raus.‘ Und dann rief er: ‚Roger! Auf der Bühne liegt ein Fünfzig-Dollar-Schein!‘ Einmal war ich dabei, als sich Roger bei Bill Curbishley darüber beklagte, dass ihm diese Witze über seine Knauserigkeit allmählich auf den Geist gingen. Ein betretenes Schweigen entstand. Dann sagte Bill: ‚Aber Roger, du bist nun mal geizig.‘ Roger konnte aber auch sehr großzügig sein. Wenn jemand hart gearbeitet hatte, ließ er sich oft eine besondere Belohnung einfallen. Er kümmert sich ständig um irgendwelche Aspekte der Tour. Sehr oft waren seine Befürchtungen auch gerechtfertigt, und er ist wirklich der einzige in der Gruppe, der kontinuierlich über die Tournee und ihre Probleme nachdenkt. Rogers ganze Obsession gilt dem Tee. Doug Clark, sein persönlicher Assistent, trug immer ein T-Shirt mit dem Aufdruck ,Tasse Tee, Doug?‘ Das waren Rogers Lieblingsworte; Doug musste ihm zu den unmöglichsten Gelegenheiten Tee aufbrühen. Roger hatte sogar einen britischen Wasserkocher mit einem amerikanischen Adapter dabei, damit er sich auf seinem Hotelzimmer nach allen Regeln der Kunst Tee machen konnte. In den USA tunkt man ganz banal einen Teebeutel in heißes Wasser. Aber Roger bestand darauf, dass Doug den Tee korrekt zubereitete, und so wurde Doug oft während der Konzerte losgeschickt, um eine Tasse Tee nach britischer Art zu aufzubrühen.“
Für Pete, John, Kenney und Rabbit, die zu jener Zeit allesamt harte Trinker waren und nach den Auftritten mit Gästen und der Crew bei Brandy, Cognac und Champagner zusammensaßen, lieferte die spezielle und dem Leitbild des Rock’n’Roll ziemlich konträre Lebensführung ihres Sängers, die auf Tee, ausgewogener Ernährung, Sport, Massage und regelmäßigem Schlaf beruhte, immer wieder eine Steilvorlage für ironische Kommentare. Pete und John waren begnadete Spötter, und bekanntlich lacht man in einer Gruppe auf Kosten der nicht Anwesenden besonders herzlich.
Doch nicht nur in der Wahl des passenden Getränks oder am Schlafbedürfnis schieden sich die Geister in der Band. Der Antagonismus zwischen Pete und Roger entzündete sich vielmehr neu an der grundsätzlichen Ausrichtung ihrer Musik und der Zukunft der Band. Jeder der beiden Leitwölfel verkörperte einen anderen elementaren Aspekt, der zum Fortbestand beitrug. Pete, der sich mit seinen Kollegen so leutselig die Gläser teilte, der fürs soziale Arbeitsklima zuständig schien und die Songs schrieb, hatte in Wahrheit eine viel größere Distanz zur Band als Roger, der immer zuerst an The Who dachte.
Pete überlegte ja unterdessen ernsthaft, wie viel Zeit und welches Material er in seine eigene Karriere investieren durfte, konnte, vielleicht sogar musste. Ende 1979 wurde bekannt, dass er einen gesonderten Plattenvertrag mit dem New Yorker Label Atlantic abgeschlossen hatte, das zum Unterhaltungsriesen Warner Brothers gehörte. Warner-Chef Mo Ostin war ein großer Who-Fan und mit Pete gut bekannt. Der Vertrag sah vor, dass Townshend in den nächsten sechs Jahren drei Alben als Einzelinterpret herausbrachte. Das bedeutete, dass er plötzlich sehr konkret vor der Entscheidung stand, welche Songs er für die Who nutzen sollte und welche für sich selbst.
Roger beobachtete diese kreative Abnabelung des Songwriters zumindest mit Sorge, wenn nicht gar mit Argwohn. Offen konnte er nichts dagegen einwenden, denn er selbst hatte noch einen Plattenvertrag mit MCA, wo auch The Who seit 1965 in den Staaten ihre Platten veröffentlichten. Roger schuldete MCA sogar noch eine LP, und nachdem auch John, der allerdings gerade ohne Solovertrag war, und selbst Keith schon eigene Alben herausgebracht hatten, konnte man Pete schwerlich verbieten, seine kreativen Einfälle nicht auch für eigene Projekte zu nutzen.
Im Unterschied zu Roger und auch zu John war Pete jedoch der unentbehrliche kreative Motor von The Who, und falls er seine Songs von anderen Musikern nach seinen Vorstellungen einspielen ließe, mochte das Resultat durchaus den Aufnahmen mit der Gruppe sehr ähnlich werden. Wenn Roger Kompositionen von Paul McCartney oder Leo Sayer sang, hatte das dagegen viel weniger Auswirkungen auf die Band.
Roger war seit seiner Verkörperung von Tommy das einzige Who-Mitglied, das Pete auf Augenhöhe begegnen konnte. Seine von den Kollegen oft belächelte grundsolide Arbeitsauffassung und Lebensführung war in Wahrheit die Basis für eine erstaunliche Professionalität und Produktivität. Roger lebte so ausschließlich für seinen Beruf wie ein Leistungssportler. Er hatte konsequent eigene Platten veröffentlicht und erfolgreich an seiner Filmkarriere gearbeitet. Die der Band gehörende Produktionsgesellschaft The Who Films Ltd. drehte seit Sommer 1979 in Shepperton an McVicar, einem Film über Englands berühmtesten Ausbrecher und Gefängnisintellektuellen. Roger hatte die Filmrechte der Autobiografie gekauft, die John McVicar während seiner Haft verfasst hatte, und identifizierte sich stark mit dem rebellischen Individualisten, den Scotland Yard einst als „gefährlichsten Mann Großbritanniens“, als „Public Enemy Number One“, gesucht hatte.
„Wir durchliefen beide die gleiche Art von pubertären Fantasien“, erklärt Roger. „Mit fünfzehn hatte ich dasselbe Ego. Wie er wollte ich viel Geld haben. Ich wollte ,the Face‘ sein, der Rädelsführer, die Nummer eins, und ich wollte das tollste Auto fahren. Auch ich war ein Straßenkämpfer. Ich machte das Gleiche durch wie er, aber mit Hilfe der Rockmusik. Ich musste nicht in einem gestohlenen Auto vor einer Bank lauern, um einen Adrenalinstoß zu bekommen. Das erlebte ich auf der Bühne. Aber wenn ich nicht zum Rock’n’Roll gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich eine Art John McVicar geworden. Teil einer Band zu sein, bedeutete meine Befreiung.“
Aus diesem Grund hielt Roger stets an den Who fest. Er meinte, dass die Band ihn vor einem fragwürdigen Schicksal im Arbeiter- und Kriminellenmilieu bewahrt hatte, und dafür war er unendlich dankbar. Einige seiner früheren Kumpel aus Shepherd’s Bush hatten inzwischen unerfreuliche Bekanntschaft mit Gerichten und Haftanstalten gemacht; andere mühten sich Tag für Tag mit schlecht bezahlter Lohnarbeit in Fabriken ab. Dass auch er unter ungünstigen Umständen wahrscheinlich ein solches Leben hätte führen müssen, vergaß Roger nie. Dafür schluckte er manches herunter, dafür ertrug er den Spott seiner Kollegen, und dafür kämpfte er jeden Tag auf der Bühne und hinter den Kulissen des Who-Konzerns.
Aus diesem Bewusstsein, für das Richtige einzutreten, zog er die Glaubwürdigkeit und innere Stärke, die Pete oft fehlte. Dessen Konzepte waren vorwiegend geistiger Natur. Seine Kreativität wurzelte im emotionalen Chaos, in den nur halb aufgearbeiteten Traumata seiner Kindheit und in seiner frühen Jugend, als er ein verklemmter, gehänselter Außenseiter mit Omnipotenzfantasien gewesen war. Die Angst vor Einsamkeit – beziehungsweise die unstillbare Sehnsucht nach Gemeinschaft – hatte ihn zur Rockmusik geführt und nicht zur Kunst oder in die Literatur, wohin er von seiner Veranlagung sicher ebenfalls gepasst hätte. Jetzt trieb ihn der kreative Eifer zu einer neuen Art von Selbstbestätigung und Selbstverwirklichung, zu größerer künstlerischer Freiheit und in die Nähe gefährlicher Abgründe.
Die unheilvolle Verknüpfung von Alkohol und Arbeit machte fast allen in seiner Umgebung Sorgen. Als die Who Mitte Dezember 1979 nach London zurückkehrten, um Weihnachten zu Hause zu verbringen, drohte das Privatleben der drei Partygänger Pete, John und Kenney zu kollabieren. Die trinkfreudigen Who-Instrumentalisten hatten während der Tournee die Vorzüge des Rockstardaseins bis zur Neige ausgekostet und ein kleines Heer von Groupies hinter sich hergezogen; selbst der brave Kenney ließ sich von den Verlockungen in Gestalt von willigen amerikanischen Girls überwältigen und musste als Folge erleben, wie ihm sein vormals geordnetes Familienleben immer mehr entglitt.
Was das Vernaschen von Groupies betraf, war Roger keine Ausnahme, wie er offen bekannte – abgesehen davon, dass er die Ladies nach einem leichten Gurkensandwich mit einer Tasse Tee diskret auf sein Zimmer bestellte und sie vor dem Zubettgehen zur Sicherung des Nachtschlafs wieder hinauswarf, wie Keiths getreuer Konzertbegleiter Dougal Butler berichtete. Aber Roger hatte die berufsbedingte Untreue sozusagen mit seiner Frau abgesprochen und einen Kodex vereinbart, der ihre Ehe stabil hielt. Er trennte innerlich streng zwischen Privatleben und seiner Rockstarexistenz:
„Ich habe eine unglaubliche Frau. Natürlich vögle ich herum. Und sie weiß es. Wenn sie das auch macht, sage ich: ‚In Ordnung, aber lass es mich nicht wissen.‘ Das ist typisch männlich, ich weiß, ich bin ein chauvinistischer Dreckskerl. Ich habe vermutlich die beste Frau im ganzen Musikgeschäft. Sie ist alles, was ich mir von einer Frau wünsche. Wahrscheinlich ist sie die klügere von uns beiden, und das ist gut so. Sie geht nie mit auf Tour, weil sie das nicht möchte.“
Pete, John und Kenney vermochten die emotionalen Aspekte des Rockmusikgeschäfts nicht so klar zu unterscheiden. Alle drei hatten Beziehungen mit jungen Verehrerinnen angefangen. John ließ sich von einer quirligen Amerikanerin namens Maxine sogar ständig begleiten, wenn er in den USA unterwegs war. Er hatte die hübsche Freundin, die noch nicht viel älter als zwanzig war, schon 1978 vor Keiths Tod im Prominentenlokal Rainbow Bar von Los Angeles kennen gelernt, wo sie als Kellnerin arbeitete und wo Keith die Jahre zuvor seine kalifornischen Exzesse ausgelebt hatte. Aus der Liaison war bald eine so ernsthafte Verbindung geworden, dass Alison Entwistle in der fröhlichen, dunkel gelockten Maxine eine ernste Bedrohung erkennen musste.
Die Ehen aller drei Who-Musiker gerieten gegen Jahresende immer stärker unter Druck. Auf Tournee wie Götter von dienstbaren Mädchen umschwärmt, die ihnen jeden erfüllbaren Wunsch von den Augen ablasen, mussten sie sich zu Hause gleichberechtigten Partnerinnen stellen, die ihnen Vorhaltungen wegen ihrer schlechten Gewohnheiten und ihrer langen Abwesenheit machten. Und alle mussten feststellen, dass ihre Kinder sie kaum mehr erkannten – eine Erfahrung, die Pete schon einmal zur Umkehr bewogen hatte. Dieses Mal genügte sie jedoch nicht, wie Pete in seinem schon erwähnten Traktat über Alkoholismus schrieb:
„Karen sagte mir: ‚Deine Trinkerei beginnt unsere Familie zu bedrohen. Ich möchte das nicht.‘ Ich antwortete: ‚Karen, ich kann nicht aufhören zu trinken, ich schaffe es nicht. Vor allem nicht, wenn ich arbeite.‘ Darauf sagte sie: ‚Gut, dann bleib weg, solange du arbeitest.‘ Das klang vernünftig, also hielt ich mich daran. Wenn ich Aufnahmen machte, mietete ich mich in einem Hotel ein, arbeitete etwas oder flog für ein paar Wochen in die USA (meist nach Kalifornien ins Warner-Plattenstudio). Dann kam ich heim und machte einen völligen Entzug durch, höchstens mal ein Glas Wein zum Sonntagsbraten. Dann ging ich wieder für ganze Monate fort, arbeitete und kam zurück … Schließlich entfremdeten wir uns, und ich begann anderswo Trost zu suchen. Ich stieß ziemlich viele alte Freunde vor den Kopf und fand ein paar neue Freunde. Ich begann lose Beziehungen mit Teilzeitfreundinnen. Ich konnte in jeden Nachtklub von London gehen, und jeder wusste, wer ich war. Ich verbrachte sehr wenig Zeit zu Hause. Damit begann alles. Karen und ich entschieden, dass es am besten wäre, wenn ich meine Probleme dauerhaft woanders hinbrachte.“
Pete bezog ein eigenes Apartment über einem Schuhgeschäft an der King’s Road und lebte, wenn er genug vom Stadtluxus hatte, in seinem Landhaus in Berkshire, wo er auch sein Studio eingerichtet hatte. Aus dem verantwortungsbewussten Rockstar-Familienvater wurde Schritt für Schritt ein heftig trinkender Partylöwe mit wechselnden Damenbekanntschaften. An die Stelle echter Beziehungen zu alten Freunden traten oberflächliche Bekanntschaften aus der Londoner Schickeria. Zeitungsfotos zeigen ihn oft sturzbetrunken am Arm einer namenlosen Blondine aus einem Nachtklub torkeln, und nach Konzerten war die Situation häufig noch chaotischer:
„Oft wachte ich in einem Raum voller Mädchen auf, die ich noch nie gesehen hatte, einfach weil ich die Nacht zuvor so betrunken gewesen war, dass ich sie nicht hinausgeworfen oder sie nicht höflich darum gebeten hatte zu gehen, oder was auch immer das richtige Verhalten gewesen wäre. Ich lebte damals gegen die meisten Prinzipien, die ich durch Baba kennen gelernt und als bereichernd empfunden hatte. Meher Baba wandte sich sehr eindeutig gegen Drogen. Und weil ich mich nicht an diese Prinzipien hielt, verbannte ich ihn für einige Zeit aus meinem Leben.“
Richard Barnes berichtet, dass er mit Pete noch während der USA-Tournee einen Besuch im Baba-Zentrum Myrtle Beach machen wollte. Sie mieteten sogar einen eigenen Learjet, um dorthin zu fliegen, doch „Pete setzte nie einen Fuß ins Zentrum. Er verbrachte die ganze Zeit damit, etwa eine Meile vom Baba-Zentrum entfernt im Hilton Hotel etwas Schlaf zu finden. Pete war damals extrem unglücklich. Ich erinnere mich, dass ich ihn schon in der ersten Nacht während der Tournee, in New York, halb betrunken auf dem Boden liegend fand, sein Ohr gegen einen Kassenrekorder gepresst, aus dem mit voller Lautstärke ‚Private Life‘ vom noch unveröffentlichten Album der Pretenders plärrte.“
Die seltsame Szene könnte allerdings auch einen anderen Hintergrund gehabt haben. Pete suchte einen Produzenten für sein Soloalbum, und er hatte Chris Thomas dafür ins Auge gefasst, der bereits erfolgreich mit den Pretenders und den Sex Pistols gearbeitet hatte. In diese Richtung wollte auch Pete seinen musikalischen Stil entwickeln, mit Tempo, draufgängerisch, mutig nach vorn. Inhaltlich beschäftigte er sich vor allem mit dem, was in seinem Leben zu kurz kam: mit Spiritualität und Tiefe. Der Titel des Albums, Empty Glass, geht deswegen laut Pete nicht etwa auf seine kompromisslosen Trinkgewohnheiten zurück, jedenfalls nicht auf so eindeutige Weise, wie das naheliegend erscheint, sondern auf eine Parabel des Sufi-Dichters Hafiz, der im 14. Jahrhundert gelebt hatte:
„Er verglich die Liebe Gottes mit Wein, und dass wir danach schmachten, von Gift befreit zu werden; dass das Herz wie eine leere Tasse ist. Du hältst Gott dein Herz hin, und die Hoffnung, die Gottes Gnade ist, wird diese Tasse füllen. Du stehst in der Kneipe, eine nutzlose Seele, die darauf wartet, dass dir der Barmann einen Drink bringt – und der Barkeeper ist Gott. Auch Baba hat das Herz oft mit einem Glas verglichen, das Gott allerdings nicht mit seiner Liebe füllen kann, sofern es mit Eigenliebe gefüllt ist. Spiritualität bedeutet für mich, dass man sich mit Fragen beschäftigt, nicht mit Antworten. Ich halte es nach wie vor für eine sehr romantische Vorstellung, sein Glas hinzuhalten und zu sagen: ‚Gott, wenn du da bist, mach es voll!‘ Das Glas ist leer, weil du es geleert hast. Dein Ich war darin. Deswegen meinst du, dass du nichts wert bist, dass alles sinnlos ist – doch in Wahrheit schaffst du nur Raum für Gott. Du gibst ihm die Möglichkeit, das Glas neu zu füllen; also tritt beiseite, geh aus dem Weg. Bitte um Führung.“
So gewagt und rätselhaft diese Sätze klingen: Es war ein sehr gefährlicher Weg, den Pete einschlug. Ein Mensch, der mit solcher Konsequenz die mystischen Pfade der Erkenntnis beschreitet, benötigt normalerweise einen erfahrenen spirituellen Lehrer an seiner Seite, einen lebendigen, leibhaftigen Lehrer wohlgemerkt, der den Adepten persönlich auffangen kann, wenn es notwendig ist, um die Kontrolle über sein Alltagsleben zurückzugewinnen. Doch Meher Baba war seit zehn Jahren tot, und Pete hatte ihn nie persönlich kennen gelernt. Wer konnte Pete helfen, wenn die dunkle Nacht kam, die jeder nach Erkenntnis Suchende zu durchstehen hat?
Seine wichtigsten persönlichen Beziehungen waren fast alle gestört, seit er von seinem Zuhause ausgezogen war, und Pete experimentierte überdies zu jener Zeit wieder mit harten Drogen, zum ersten Mal wieder seit seiner beängstigenden LSD-Erfahrung während des Heimflugs vom Monterey-Festival zehn Jahre vorher. Pete nahm vor allem die Jetset-Droge Kokain, wie er unumwunden eingesteht:
„Anfang 1980 beging ich den Fehler, Kokain zu konsumieren. Ich wurde sofort davon abhängig, weil ich mich so wohl dabei fühlte. Ich lasse mich sehr gern stimulieren. Die Klarheit half mir durch den Nebel der Trunkenheit. Man ernüchtert augenblicklich, sobald man sich eine Linie reinzieht; dann trinkt man wieder, nimmt eine weiteres Tütchen, wird nüchtern … und wiederholt diesen Zyklus, bis man am Ende des Tages nicht mehr kann.“
Es heißt, dass sich Pete durch seine unglückliche, da einseitige Liebesbeziehung zu einer jungen Schauspielerin zum Kokain verführen ließ. Ihr Name: Theresa Russell. Pete hatte die attraktive und erfolgreiche Amerikanerin über den britischen Regisseur Nicolas Roeg kennen gelernt, ohne zu wissen, dass die beiden seit Roegs Film Blackout – Anatomie einer Leidenschaft (1979), in dem Theresa Russell an der Seite von Art Garfunkel spielte, ein Paar waren. „Ich kannte Nic als sehr glücklichen älteren Familienvater, der gelegentlich glamouröse Schauspielerinnen an seiner Seite hatte“ erzählt Pete.
Pete wollte seinen in Kalifornien lebenden Landsmann, der spätestens seit dem Klassiker Wenn die Gondeln Trauer tragen (1973) als Regisseur von Weltruhm galt, für die Verfilmung seines Lifehouse-Drehbuchs gewinnen, und die erst dreiundzwanzigjährige Theresa Russell war von Petes Skript begeistert:
„Sie setzte Nic regelrecht unter Druck. Was ich nicht wusste, war, dass sie ihn zu heiraten gedachte. Eines Tages rief ich in seinem Apartment an, wohl wissend, dass Nic gerade wegen einer Beerdigung nach London geflogen war. Seine Freundin nahm ab und sagte: ‚Oh, Pete, tut mir so leid, Nic ist gerade nach London unterwegs.‘ Und ich sagte: ‚Mist, so ein Pech, ich bin gerade auf dem Weg in die andere Richtung und wollte ihn treffen. Aber egal, wenn ich ankomme, rufe ich noch mal an.‘ Dann flog ich schnell über den Atlantik, besessen von der Idee, dass ich sofort handeln musste, da sie offensichtlich schon zusammen lebten. Ich wollte nur sie sehen und herausfinden, was da los war. Wir gingen gemeinsam mit einigen Freunden aus und schauten uns The Wall an und betranken uns. Bei dieser Gelegenheit nahm ich das erste Mal in meinem Leben Kokain; sie kokste ein bisschen. Ich verliebte mich hoffnungslos in sie, teilweise wohl auch wegen des Kokains, ohne dass sie mich irgendwie ermutigt hätte. Es war Valentinstag, und ich hüpfte in ein Auto und kaufte ihr Tequila und massenhaft Blumen, aber sie ließ mich nicht mal rein, sie wollte mich nicht sehen. Ich brach völlig zusammen. Ich hatte den spektakulärsten Gefühlsausbruch und wurde ein regelmäßiger Drogenkonsument. Ich trug bis zu diesem Zeitpunkt bereits eine Menge emotionalen Ballast mit mir herum, Cincinnati, Keiths Tod und dazu mein Alkoholproblem, ich trank, trank, trank; aber diese Sache ließ die Angelegenheit vollends umkippen.“
Hier wird klar, dass Pete kein Vergnügungsjunkie war, der aus Langeweile trank und kokste, sondern er dass er eine ernsthafte Lebenskrise durchlitt, aus der er keinen anderen Ausweg sah, als seine Gefühle mit Alkohol und Kokain zu regulieren. Er arbeitete hart, um seine Verpflichtungen gegenüber der Band, sich selbst und den Plattenfirmen zu erfüllen, und auch hier setzte er Drogen und Alkohol gezielt ein, um seine Produktivität zu steigern. Er hatte nie etwas anderes gelernt. Seit er achtzehn war, verband er seinen Beruf, die Musik, das Schreiben, die Auftritte vor Publikum, mit Alkohol und anderen Drogen. Sie halfen ihm, seine Frustrationen zu betäuben und den Druck auszuhalten, den er sich größtenteils immer wieder selbst auferlegte.
Anfang 1980 folgten The Who ihrem Vordenker Townshend zur neuen Plattenfirma Warner Brothers. Offenbar hatte MCA (wozu auch die Universal-Filmstudios gehörten, aus deren Requisitenfundus sich Keith Moon regelmäßig bedient hatte) die Forderungen der Band bei der anstehenden Vertragsverlängerung für zu hoch befunden. Dabei hatten Branchenkenner erwartet, dass die Band bei MCA oder bei der britischen Polydor unterschreiben würde, die die Rechte an den Who-Songs außerhalb der USA besaß. Warner bezahlte angeblich zwölf Millionen Dollar für die Veröffentlichungsrechte an den nächsten fünf Who-Alben in den USA und in Kanada. Polydor behielt die Rechte für den Rest der Welt. „Das hieß, ich sollte in fünf Jahren acht Alben produzieren“, sagt Pete: drei Soloplatten und fünf Who-Alben. „Alle Songs schreiben, aufnehmen, touren, Öffentlichkeitsarbeit machen, aufnehmen – völlig unmöglich, das zu schaffen.“
Und mal abgesehen von der Unmöglichkeit, all diese Verpflichtungen terminlich überhaupt auf die Reihe zu kriegen: Die zeitgleichen Produktionen brachten seine und die Interessen der Band spürbar durcheinander. Pete musste sich sozusagen in zwei synchron agierende Komponistenpersönlichkeiten aufspalten, deren eine für die Who schrieb und deren andere für Pete Townshend; denn er konnte neben seiner Solokarriere die Gruppe unmöglich vernachlässigen. Dafür sorgte schon der neue Plattenvertrag der Band, den er mit eingefädelt hatte. „1980, als ich nie nüchtern war, schrieb ich Songs, die einfach nicht zu den Who passten“, erinnert er sich. „Sie waren sehr persönlich und spiegelten meine spezielle Entwicklung wider, die ich gerade durchmachte. Die meisten Lieder, die ich geschrieben habe, handeln davon, dass es Erlösung und einen Erlöser gibt. Ich würde zwar nie direkt seinen Namen in einem Songtext nennen, aber ich denke, die meisten meiner Songs handeln von Jesus.“
Mit dieser Aussage wollte Pete natürlich unterstreichen, wie fern sich seine Kompositionen vom gewöhnlichen Who-Liedgut befanden. Doch für einen Rocksong sind Texte und Inhalte oft erschreckend unwichtig; man könnte sogar behaupten: je vieldeutiger oder belangloser die Texte sind, desto erfolgreicher können die Songs werden. „Genau besehen macht Pete sowieso bessere Who-Platten als die Who selbst“, beschreibt Keith Richards das Dilemma Townshends etwas überspitzt. „Er ging üblicherweise mit einem fertigen Who-Album ins Studio, und die Jungs legten bloß ein paar Overdubs drüber. Sein erster Entwurf war aber zehnmal besser als das fertige Produkt. Sie imitierten bloß, was Pete ursprünglich hingelegt hatte.“
Darüber kann man streiten; vor allem John hat eindeutig zum Ausdruck gebracht, was er von dieser Einschätzung hält: „Das ist es, was mich an Keith Richards schon immer irritierte: seine Vorstellung, dass Pete irgendwas anbrachte und dass wir es bloß kopierten. Völliger Blödsinn. Man muss sich einmal klar machen, dass Keith Moon und ich, jeder von uns beiden, als Musiker zu den besten auf unserem Instrument gehörten. Undenkbar, dass wir etwas einfach nur nachgespielt hätten. Tatsächlich war es so, dass Pete später all diese Neubearbeitungen und Raritäten herausbrachte; er nahm seine alten Demos und verbesserte sie so, dass sie klangen, als ob er uns kopieren wollte.“
Johns Aussage bezieht sich vor allem auf die Scoop-Alben, Petes später erschienene Sammlung von Outtakes; sein Ärger über Petes Alleingänge und die öffentliche Wahrnehmung der Rollenverteilung bei The Who klingt unverhohlen durch. Vermutlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Pete legte etwas vor, was die anderen auf ihre spezielle und unnachahmliche Weise bearbeiteten; Pete als Komponist fand Gefallen an manchen Eingriffen seiner Kollegen, an manchen auch nicht, und daraus entwickelten sich weitere Versionen seines Songs. Fakt ist, dass einige Titel von Petes Soloalben verdächtig wie Who-Produktionen klingen. Das gilt besonders für die Zeit von 1980 bis 1982, als Petes Alben Empty Glass und All The Best Cowboys Have Chinese Eyes mit den beiden Who-Produktionen Face Dances und It’s Hard konkurrierten.
An „Empty Glass“, dem Titelstück von Petes Soloalbum, und an „Rough Boys“, seiner ersten Solosingle in den Charts, die angeblich nur deswegen kein Who-Song wurde, weil Roger die Tonlage zu hoch war und er kein Lied über Schwule singen wollte, lässt sich die Ambivalenz, in der sich The Who und ihr Komponist bewegten, gut verdeutlichen. Roger erklärte 1994 im legendären „Goldmine-Interview“, er besitze noch immer das Originaldemo und einen Brief, in dem Pete zugab, er habe „Rough Boys“ für Roger geschrieben. Unbestreitbar wurde „Empty Glass“ schon 1978 geschrieben und von den Who mit Keith am Schlagzeug aufgenommen, wie 1996 durch die erweiterte Neuauflage des Albums Who Are You überraschend bekannt wurde, als Pete sich gegen Rogers Vorwürfe zur Wehr setzte, er habe in den achtziger Jahren die besten Stücke für sich genommen und der Band nur den Ausschuss gelassen.
1980 nahm Pete die beiden umstrittenen Songs abermals auf – mit verschiedenen Schlagzeugern. „Rough Boys“ spielte er mit Kenney Jones ein, „Empty Glass“ mit Simon Phillips, einem technisch außerordentlich versierten Drummer, der neun Jahre später als Zweiter den Versuch wagen sollte, Keith Moons Stuhl bei The Who zu übernehmen. „Wir trafen uns das erste Mal in den Wessex Studios“, erzählt der 1957 geborene Brite vom Beginn einer zwanzigjährigen Zusammenarbeit. „Petes Manager hatte mich angerufen und für die Aufnahmen von Empty Glass gebucht.“
Pete und Simon Phillips verband eine biografische Gemeinsamkeit: Auch Simons Vater war ein bekannter Musiker gewesen, und die beiden hatten sich sogar gekannt. „Mein Vater hat Klarinette gespielt und seine eigene Dixieland-Tanzband gegründet, die Sid Phillips Band“, sagt Simon Phillips. „Ich war dort Schlagzeuger von 1969 bis 1973, bis mein Vater starb. Mein Vater kannte Cliff Townshend gut, und ich wusste, wer Petes Vater war.“
Simon interpretierte Petes Songs schon aufgrund seiner eher jazzigen Grundausbildung völlig anders als Kenney. Er war auch ein ganz anderer Drummer als Keith, weniger instinktiv und viel weniger schlampig vor allem, aber ebenfalls sehr dramatisch und vielschichtig. Darum gebeten, sich über Keith zu äußern, meinte er:
„Ich habe Keith nie persönlich kennen gelernt, aber nachdem ich mit Pete, Roger und John auf Tournee war, bekam ich das Gefühl, ihn trotzdem ein bisschen zu kennen. Er war ein sehr flüssiger Schlagzeuger, bewegte sich viel und spielte immer innerhalb der Musik. Er war kein fundierter, geerdeter Drummer – er hatte einen völlig anderen Stil als ich. In gewisser Weise war er das Rockgegenstück zu Tony Williams, der als einflussreicher Jazzdrummer vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Miles Davis berühmt geworden war.“
Simon Phillips spielte gleichwohl ähnlich variabel, aber auf präzise Weise unvorhersehbar. Oft begannen seine Wirbel auf dem zweiten Schlag und endeten zum ersten oder dritten Schlag des Folgetakts. Für Pete, der sämtliche Spielarten der Unterhaltungsmusik in seine Kompositionen einbezog, war Phillips eigentlich der ideale Drummer (nach Keith Moon natürlich). Das glaubt auch Simon:
„Petes Songs repräsentieren meinen Stil wahrscheinlich am besten. Bei manchen Stücken braucht man eine Weile, bis man heraus hat, wie man sie am besten angeht, andere spielen sich sozusagen wie von allein. Das liegt eindeutig an Petes Art und Weise, Songs zu schreiben. Ich erinnere mich daran, dass ich mir seine Demos anhörte und sagte: ‚Und? Was soll ich da noch machen? Hört sich für mich schon ziemlich fertig an.‘ Er freute sich über mein Kompliment, war fast verlegen, wollte aber auf jeden Fall, dass ich alles auf meine Weise einspielte. Wir spielten es live ein, mit Rabbit am Klavier, Tony Butler am Bass und Pete an der Gitarre – traumhaft!“
Pete spielte nicht nur Gitarre und Keyboards und programmierte die Synthesizer, während Rabbit die eher traditionelle Tastenarbeit am Klavier übernahm – er sang auch alle Titel selbst, was für ihn keine Selbstverständlichkeit war: „Ich hatte zwar immer eine ganz nette Stimme“, meint er selbstkritisch, „aber ich bildete mir wenig darauf ein, bis Chris Thomas, der Produzent meines ersten Soloalbums, fragte: ‚Warum singst du nicht einfach drauflos?‘ Ich antwortete: ‚Weil ich wie Andy Williams klinge‘, ein populärer amerikanischer Entertainer. Chris meinte bloß: ‚Na und?‘ Und so klinge ich eben wie Andy Williams – er hat eine wunderschöne Stimme.“
Wer sich das fertige Album unvoreingenommen anhört, muss konstatieren, dass einige Songs von Empty Glass in der Tat einen merklich stärkeren Eindruck hinterlassen als Who-Songs der gleichen Ära. Sie sind komplexer, experimentierfreudiger, mutiger und engagierter, und zwar nicht nur in Bezug auf das Arrangement und die Komposition an sich, sondern auch, weil sie schlichtweg hervorragend eingespielt wurden, mit Musikern, die sich Pete nach seinen Wünschen aussuchte.
Roger, der sich Empty Glass ebenfalls kritisch anhörte, dürfte besonders hinter den Namen Simon Phillips ein dickes rotes Kreuz vermerkt haben. Dieser Tausendsassa machte nicht bloß „bumm-tschick-bumm-tschick“ wie Kenney Jones, den Pete ja unbedingt als Who-Drummer in der Band haben wollte, sondern er spielte komplex wie Keith und versiert wie Ginger Baker. Für Roger stellte sich deswegen die Frage, warum Pete für sein Soloalbum offensichtlich den besseren Schlagzeuger verpflichtet hatte, während er für The Who auf einer zweitklassigen Lösung beharrte.
Pete ärgerte sich über diesen Vorwurf. Er ärgerte sich noch mehr, als er erfuhr, dass die Who-Filmgesellschaft nach der Produktion von Rogers McVicar kein Geld mehr übrig hatte, um seinen geplanten Lifehouse-Film in Angriff zu nehmen, der schätzungsweise zwölf bis fünfzehn Millionen Pfund verschlungen hätte. Regisseur Nicolas Roeg war allerdings sowieso empört über Petes Annäherungsversuche an seine künftige Braut ausgestiegen und wollte mit Lifehouse nichts mehr zu schaffen haben.
Bis zum Frühjahr hatte Pete – inzwischen wieder bartlos, so dass ihn seine Kinder kaum mehr erkannten – Empty Glass abgeschlossen. Absurderweise widmete er das Album seiner Frau, jenem Menschen, mit dem er sich über die Arbeit an diesem Werk doch entfremdet hatte. Eine weitere seltsame Wiedergutmachung war die Widmung für die erste Singleauskopplung „Rough Boys“: Sie ging nicht an Roger, der das Stück abgelehnt hatte, sondern an Petes zwei Töchter und an die Sex Pistols.
Für The Who begannen die wenig Glück bringenden achtziger Jahre offiziell erst am 27. März 1980 mit einem Konzert in der Essener Grugahalle. Christian Suchatzki, unverändert ein begeisterter Who-Fan, war aus München angereist und natürlich live dabei:
„Den Fans schien mit Keiths Tod erst bewusst geworden, dass ein Who-Konzert etwas Einmaliges, Unwiederbringliches darstellt. Man wusste ja nicht, ob sie noch mal in der gleichen Besetzung auftraten oder gar nicht mehr. Es klingt paradox, aber mit Keiths Ableben erlangten Who-Konzerte einen höheren Stellenwert. Die Halle konnte deswegen mit zehntausend Plätzen mühelos ausverkauft werden, und die Fans verhielten sich dermaßen fanatisch, als würden sie dem letzten Konzert ihres Lebens beiwohnen. Von überall wurde ununterbrochen gedrückt und geschoben, so dass man fürchten musste, erbarmungslos zerquetscht zu werden.“
Die Tragödie von Cincinnati, die kein halbes Jahr zurück lag, schien sich in Deutschland noch nicht herumgesprochen zu haben. In Frankfurt musste die Polizei vier Tage nach dem Auftritt in Essen massiv eingreifen, als nach der Verhaftung von GIs, die Drogen verkauften, eine Massenschlägerei ausbrach. In München wirkten The Who bei ihrem ersten Auftritt nach der Winterpause noch ein wenig betriebskalt, wie Augenzeuge Christian Suchatzki schildert:
„Man spürte den Wandel sehr deutlich, gegenüber dem Konzert 1975 zum Beispiel. Sie spielten überwiegend dieselben Songs wie früher, aber sie waren nicht mehr die gleichen. Mit Kenney Jones am Schlagzeug und ihrem leicht veränderten Erscheinungsbild, mit Rogers kurzen Haaren und seiner dem Zeitgeist entsprechenden Kleidung verkörperten sie ein Bühnenimage, an das sich langjährige Fans erst noch gewöhnen mussten. Andererseits gewannen sie dadurch ein neues, jüngeres Publikum hinzu.“
Gleich am folgenden Tag stand das Who-Gastspiel in Zürich auf dem Plan. Vor dem Hallenstadion warteten in schönster deutsch-schweizerischer Beharrlichkeit die beiden Who-Argonauten Werni Grieder und Matthias Haß: „Es wurde Mittag, und noch kein Truck war zu sehen“, berichtet Matthias, als wäre es für loyale Who-Fans die selbstverständlichste Sache der Welt, schon die Ankunft der Roadcrew zu bejubeln. Doch dem Tross wiederfuhr, was jeder deutsche Autofahrer fürchtet: „The Who wurden vom Schweizer Zoll aufgehalten. Aber dann waren sie endlich da. Die englischen Roadies arbeiteten mit einer einmaligen Perfektion; man konnte schon ahnen, was für eine riesige Anlage da aufgebaut wurde.“ Matthias Haß bestätigt auch im wesentlichen Christian Suchatzkis Eindrücke vom Vortag:
„Pete fegte wie gewohnt über die Bühne, während John alles mit stoischer Ruhe aus der linken Ecke betrachtete. Roger wirbelte sein Mikro durch die Luft, dass einem angst und bange wurde. Zum ersten Mal sah ich Kenney Jones am Schlagzeug, er benutzte zwei Bassdrums und einen chinesischen Gong wie Keith. Keith zu ersetzen, gelang Kenney aber bei weitem nicht. Rabbit unterstützte die Band vor allem im zweiten Teil, als sie drei Stücke aus Who Are You spielten. Zusätzlich verfeinerte eine Bläsergruppe den Sound. Als Zugabe begannen sie mit einem Song, der seit 1972 nichts an Kraft und Dynamik verloren hatte: ‚Relay‘, gefolgt von ‚The Real Me‘ aus Quadrophenia.“
Nach ihrem Abstecher auf den Kontinent legten The Who eine zweiwöchige Atempause ein. Erst dann ging es zum dritten Tourneeabschnitt mit der erneuerten Besetzung nach Nordamerika. Für das Auftaktkonzert in Vancouver, Kanada, lagen nach Presseberichten unfassbare achthunderttausend Anfragen mit mehr als drei Millionen Ticketwünschen vor. Diese Zahlen wurden später im Guinness Buch der Rekorde veröffentlicht, so dass man sie glauben muss. Die sechzehntausend Glücklichen, die eine Karte bekommen hatten, feierten die Musiker wie gottgleiche Helden, und der 14. April 1980 wurde zum „Who Day“ von Vancouver verklärt.
In diesem Sinne ging die Reise weiter. The Who querten den amerikanischen Kontinent von Nordost nach Südwest, von Kanada nach Kalifornien, wo allein die drei Shows in Oakland fast eine halbe Million Dollar Gage einspielten. Bei einem dieser Auftritte in Oakland machte Annie Leibovitz ihr berühmtes Foto von Petes blutiger Gitarristenhand für den Rolling Stone. Von der Westküste zog der Tross weiter nach Salt Lake City in Utah, nach Denver in Colorado, nach Kansas City, St. Louis (Missouri), Ames (Iowa), Saint Paul (Minnesota), Chicago (Illinois) und wieder über die Grenze nach Toronto und Montreal. Hier endete der Triumphzug am 7. Mai. Die Band kehrte nach London zurück und verdaute die Erlebnisse.
Die vielleicht wichtigste Erfahrung dieser Tournee betraf wieder einmal Pete. Fast zeitgleich mit dem Auftakt in Vancouver war sein Soloalbum erschienen, und Atlantic hatte „Rough Boys“ (mit Kenney Jones am Schlagzeug) als Single veröffentlicht. Die Kritiker waren begeistert. Hier präsentierte sich ein außergewöhnlich sensibler, ernsthafter Künstler, der über die Entdeckung seiner eigenen Unzulänglichkeit reflektierte und dabei eine erstaunliche Kraft und Tiefe an den Tag legte. Das Album stieg innerhalb kürzester Zeit in den Charts bis auf Rang fünf und wurde das künstlerisch und kommerziell erfolgreichste Soloprojekt, das je ein Who-Mitglied verwirklicht hat.
Fragen nach einer eigenen Tour mit bezahlten Musikern irritierten Pete erkennbar. Noch aber distanzierte er sich ausdrücklich von jeder Anregung, mit eigenem Material und einer eigenen Band auf Konzertreise zu gehen. Wie sollte er auch? Vor der Who-Tournee hatte er schon begonnen, die Demos fürs nächste Who-Album aufzunehmen; die Bandkollegen und die Plattenfirma warteten begierig auf erste Ergebnisse.
Die ersten Reaktionen von Roger, John, Kenney und Rabbit auf die neuen Songs fielen allerdings sehr verhalten aus, wie Pete berichtet: „Als ich ihnen die Demos vorspielte, sagte keiner ein Wort, nichts, gar nicht. Schließlich meinte Rabbit: ‚Ich mag diesen und jenen Song, und da gibt es ein paar gute Abschnitte.‘ Er versuchte positiv zu sein, weil er die unheilschwangere Stille bemerkte. Ich nahm bloß das Tonband und ging raus.“ In einem anderen Interview, mit dem Magazin Q im Jahr 1996, beschrieb er die Szene ein wenig anders, aber ebenso ernüchternd:
„Ich kam direkt aus L. A. und marschierte sofort ins Studio zu einer Who-Session. Ich ging nicht mal vorher heim, um meinen Mädchen guten Tag zu sagen. Ich ließ das Tonband laufen und hörte schon bald das Geflüster: ‚Es ist okay, aber nicht gerade großartig.‘ Und Kenney, der neu in der Band war, sagte als erstes: ‚Du hast das beste Material für dein Soloalbum verwendet.‘ Innerlich kochte ich und dachte, wer glaubst du, dass du bist?! Du bist bloß in dieser Scheißband, weil ich dich drin haben wollte! Egal. Ich therapierte mich, indem ich mich zu Bobby Pridden umdrehte und sagte: ‚Kannst du mir schnell etwas Koks kaufen gehen?‘ Der meinte verblüfft: ‚Aber du hast doch nie Koks genommen?‘ Ich sagte: ‚Jetzt tu ich es, also geh raus und besorg mir welches.‘ Das tat er dann. Er besorgte mir das grauenhafteste Kokain, das mit LSD versetzt war …“
Die chemische Frustbewältigung hielt nicht lange vor. Das Problem war, dass die meisten Kritiker und Fans, obwohl des Lobes voll für Petes Soloalbum, auf denselben naheliegenden Gedanken kamen wie seine Who-Kollegen. Pete mochte noch so sehr betonen, dass Empty Glass viel zu experimentell und zu persönlich sei, um als Who-Album durchzugehen – das unvoreingenommene menschliche Gehör legte den gegenteiligen Schluss nahe. Schon „Rough Boys“, der schnelle Aufmacher, klang zweifellos wie die Who, wenngleich ohne Rogers tiefere Stimme und ohne Johns typischen Basssound. Auch „Let My Love Open The Door“, das ein Top-Ten-Hit in den USA wurde, sowie die dritte Singleauskopplung „Little Is Enough“, ebenfalls ein ordentlicher Charterfolg, hätten von den Who eingespielt werden können. Dazu kamen „Jools And Jim“, ein maschinengewehrartiger Überfall im zeitgemäßen New-Wave-Uptempo, und das fetzige Stück „Cat’s In The Cupboard“ mit seiner lebhaften britischen Metaphorik (die Katze im Schrank), mit Simon Phillips furiosen Drums und mit kräftigen Mundharmonikasoli, die nicht Roger blies, sondern Peter Hope-Evans. Diese Songs hätten hervorragend ins Who-Repertoire gepasst. Auch „Gonna Get Ya“, eine fast funkige Übertragung von für die frühen Who typischem Rhythm & Blues auf den schnörkelloseren, synthetischeren Sound der achtziger Jahre, wäre für Roger mit Sicherheit eine willkommene Herausforderung geworden.
Die Stimmung im Who-Lager war infolgedessen recht angespannt, als die Band zur letzten Konzertreise des Jahres aufbrach, zu einer vierwöchigen Mammuttournee mitten im Sommer. Die Auftrittserie begann diesmal gleich in Kalifornien. Schon der erste Gig in San Diego bewies, wie brüchig die Gemeinschaft und der innere Zusammenhalt der Musiker trotz des riesigen Zuschauerzuspruchs, der eine weitere finanzielle Segnung in Millionenhöhe mit sich brachte, geworden war.
„Petes Kokain- und Alkoholkonsum hatten ziemliche Auswirkungen auf die Vorstellung“, erzählt Augenzeuge Richard Barnes. Und hinter der Bühne drosch Pete aus „schierem Übermut“, wie er später meinte (alle anderen meinten: benebelt von Koks und Cognac), seine Hand gegen die Betonwand. Er brach sich dabei mehrere Knochen. Für den Rest der Tournee spielte er deshalb mit einer Gipsmanschette, die ihn allerdings weniger behinderte als die durch Drogen und Alkohol induzierte und zugleich wieder verdrängte mentale Erschöpfung. Barnes erinnert sich:
„Er nahm jede Menge Aufputschmittel, um die Tour durchzustehen. Gelegentlich spielte er brillant; aber öfter war Pete auf der Bühne so daneben, dass er nur für sich selbst spielte, einfach weitermachte, wenn die anderen schon aufgehört hatten. Viele seiner Gitarrensoli am Ende eines Songs klangen deswegen mehr als merkwürdig, sie brachten Roger ziemlich aus der Fassung, weil er mitten auf der Bühne stand und nicht wusste, was als nächstes geschehen würde. Einmal dachte ich, Pete machte das, um Roger zu ärgern, aber er spielte meist nur selbstbezogen vor sich hin, ohne die anderen zu beachten. Nach den Shows von Amphetaminen wach gehalten, redete er ohne Unterlass. Er verließ immer als letzter den Auftrittsort und war backstage oder im Hotel immer das Zentrum der Aufmerksamkeit. In einer Nacht faselte er stundenlang mit einigen Fans, die ihr Glück kaum fassen konnten, Pete Townshend gestellt zu haben. Bisweilen war er sehr witzig, aber wenn er mit Drogen vollgepumpt und betrunken war, stolperte er herum und lallte und verschüttete Drinks und wirkte überhaupt nicht mehr pfiffig oder klug. Niemand wagte ihm das zu sagen – dass er einen Narren aus sich machte. Schließlich versuchte ich ihm klar zu machen, was er sich antat. Doch er meinte, er könne damit umgehen und habe die Situation im Griff. ‚Ich will kein beschissener Schwächling sein‘, verkündete er. ‚Keith schaffte es auch. Warum soll er die ganzen Lorbeeren ernten?‘ Und jede Nacht, wenn er zu ‚Drowned‘ improvisierte, sang er: ‚Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich habe keine Angst davor, aber ich will einfach nicht sterben.‘“
Für Außenstehende war Petes Drama völlig unbegreiflich. Er war einer der erfolgreichsten Künstler der Rockelite, reich, gesund, klug, berühmt, geliebt, verheiratet mit einer schönen, liebenswerten und verständnisvollen Frau, Vater zweier reizender begabter Töchter, umgeben von Kollegen, die ihn bewunderten und verehrten, gestützt von der reifen Philosophie eines Erleuchteten und dessen Jüngern – wie war es nur möglich, dass dieser Günstling der Götter, ein von den Musen geküsster Erwählter, so den Boden unter den Füßen verlor? Pete selbst scheint sich seinen Absturz auch nicht recht erklären zu können:
„Bevor Keith starb, war ich davon überzeugt, dass alle meine persönlichen Probleme, egal ob es meine Sauferei war oder Schwierigkeiten mit der Familie, einzig daher rührten, dass ich mit The Who auf Tour war. Daraufhin verbrachte ich zweieinhalb Jahre zu Hause, blieb weg von der Tournee, obwohl mich die Band ständig bedrängte. Aber dann stellte ich fest, dass sich meine Probleme mitnichten verbessert hatten. Manche waren sogar schlimmer geworden.“
Geister und Dämonen schienen über seinem Haupt zu schweben. Waren es die Toten von Cincinnati? Oder ein hingeschiedener Trommelanarchist, dessen Apartment am Curzon Place immer noch Pete gehörte, da er Keith das Geld dafür geliehen hatte? Vermutlich wirkten die Geister beider Fraktionen mit unglücklichen Folgen zusammen. „Ich hasste das Gefühl, Mitglied einer absteigenden Band zu sein, die für den Tod von elf Menschen in Cincinnati verantwortlich war“, sagt Pete. „Wir waren eine Band, die ihre eigenen Anhänger auslöschte. Wir waren dick im Geschäft, und jeder, der sich uns in den Weg stellte, wurde ausgeschaltet. Das schien niemanden zu stören. Ich aber konnte spüren, wie es mich allmählich umbrachte.“
In dieser Situation rächte es sich, dass Pete den Tod seines kongenialen musikalischen Partners Keith so vorschnell ins Positive umzubiegen versucht hatte. Auch die Fans nahmen ihm die merkwürdigen Distanzierungen (und einige Aussagen zu Cincinnati) kaum ein Jahr, nachdem er eilig Keiths Nachfolger installiert hatte, ein wenig krumm. In Wahrheit war Keiths Tod das Schlimmste, was Pete als Who-Songwriter passieren konnte. Denn Moon war nicht nur am Schlagzeug unersetzlich. Er war ohne Zweifel Petes heimliche Quelle der Inspiration gewesen, die Matrix, auf der er seine kreativen Ideen erproben konnte, das leibhaftige Abziehbild von The Who und von Rock’n’Roll, oder was die meisten darunter verstanden. Und Keith war immer auch Pete Townshends größter Bewunderer gewesen, einer, mit dem er immer losziehen konnte, ein irrwitziger Seelenverwandter, dessen Loyalität keine Grenzen kannte und der doch ganz anders auftrat als alle anderen Bewunderer, die der reife, oft gesetzt und distanziert wirkende Popintellektuelle Townshend anzog.
Keith Moon, diese eminent wichtige Kontrastfigur, war für den Who-Komponisten sogar so unersetzlich, dass er dessen Lebensstil und die autodestruktive innere Haltung zwanghaft zu adaptieren begann. Der Ungeist von Keiths Untergang übernahm immer stärker Gewalt über Petes Persönlichkeit, wie Tourneebegleiter Richard Barnes berichtete:
„Petes Verhalten erreichte seinen negativen Höhepunkt während des Heimflugs. An Bord der Concorde war eine attraktive blonde Stewardess. Jedes Mal, wenn sie vorbei ging, sprang Pete betrunken von seinem Fensterplatz auf und versuchte, nach ihr zu grabschen. Ebenso oft erhob er sich und setzte zu Brandreden an, mit denen er nicht selten seine Mitreisenden attackierte. Dann fand er Gefallen an meinem Essen, schob sich eine Handvoll Hummer in den Mund, kaute alles durch und spuckte die Reste über uns aus. Bill Curbishley und seine Frau saßen auf der anderen Seite des Gangs und ignorierten Petes Ausfälle genauso wie mein Flehen um Beistand. Die hübsche blonde Stewardess erhielt einen neuen Arbeitsplatz hinter dem Vorhang, und unsere Platznachbarn wurden umgesetzt. Alle Stewards lächelten und taten so, als wäre alles völlig normal, selbst als ich Pete fast in den Schwitzkasten nehmen musste. Der Chefsteward wollte für den Piloten ein Autogramm. Pete setzte mit wackliger Hand an, holte zu einem Schnörkel aus und kritzelte etwa fünf Minuten lang Kreise, bis große Spiralen das Papier bedeckten. Der Steward war beeindruckt, welche Mühe Pete auf seine Signatur verwandte. Einige Kids hatten Pete bei der Abschlussparty in Toronto ein Päckchen Kokain hingestreckt, und Pete hatte sich das Pulver in die Nase und über den Kopf gestreut. Die Mitreisenden dachten vermutlich, er habe Talkumpuder im Gesicht und in den Haaren, ohne zu wissen, dass dieser Staub wenigstens hundert Dollar wert war. Roger und ich waren sehr besorgt und wollten nicht, dass Pete so zu seiner Familie zurückkehrte, über und über mit Wein, Brandy, Kokain und Essensresten besudelt. Roger fand ein sauberes T-Shirt in seiner Tasche, das ich mitnahm, damit Pete sich umziehen konnte. Leider warf er das Shirt aus dem Autofenster, als wir den Flughafen verließen.“
Wer diese Szenen auf sich wirken lässt, fühlt sich unweigerlich an Keiths Tollheiten erinnert. Seinerzeit war besonders Pete immer froh und dankbar gewesen, wenn die Tournee vorüber war und er dem Wahnsinn, den der unberechenbare Drummer ständig verbreitete, für einige Zeit den Rücken kehren durfte. Diesmal waren die anderen erleichtert, als sie Pete daheim ablieferten – in einem Zuhause, das beinahe ebenso zerrüttet war wie früher Keiths Familienleben.
Roger, John und Kenney taten sich aber auch aus einem anderen Grund mit dieser Tournee schwer. Kenney sprach es gegenüber Richard Barnes offen aus: dass er nämlich keine Lust auf eine Who-Tournee habe, nur damit Petes Soloalbum den Markt eroberte. Und auch John und Roger fanden den Gedanken wenig erbaulich, mit ihrer Arbeit auf der Bühne für Empty Glass den Boden zu bereiten. Denn viele Fans kamen ganz offensichtlich nur wegen Petes Solowerk zu Who-Konzerten, was der ebenfalls bemerkte:
„Da gab es jede Menge Mädchen, die bis hinter die Bühne drangen und fragten: ‚Wer von euch hat ‚Let My Love Open The Door‘ geschrieben?‘ Diese Mädchen waren ganz anders als die Frauen sonst bei Who-Konzerten. Normalerweise hatten wir ungefähr fünf Prozent weibliche Zuschauer, die ich The-Who-Rottweiler nannte, weil sie ziemlich hart im Nehmen und im Austeilen waren, um im Getümmel der ersten Reihe zu bestehen. Diesmal kam mir das Publikum viel gemischter vor. Ich erhielt Briefe von schwulen jungen Männern, die von ‚Rough Boys‘ entzückt waren. Sie hielten den Song für mein Coming-out und waren deswegen im Publikum.“
Verständlich, dass sich seine Who-Kollegen und besonders der virile Roger bei dem Gedanken unwohl fühlten, für Petes homosexuelle Privatfans, für dessen Soloambitionen und seine neurotischen Dreistigkeiten den Kopf hinzuhalten.
Rogers Heimkehr nach London wurde dafür durch die Premiere seines Films McVicar im Sommer 1980 versüßt. Der Streifen bekam durchweg gute Kritiken und gab Roger die Gelegenheit, sich als ernstzunehmenden Schauspieler zu präsentieren, der sich nicht nur auf Musikrollen festlegen ließ. Als auch der Soundtrack von McVicar in den US-Charts unter die ersten Zwanzig kam und gleich drei Singles die Charts enterten, konnte Roger seine Position gegenüber dem Universalgenie Pete abermals als gestärkt betrachten.
Die Filmmusik von McVicar gilt offiziell als viertes Soloalbum von Roger Daltrey. Tatsächlich lässt sie sich aber auch als nahezu unbekannte Who-Produktion anhören, da alle damaligen Who-Mitglieder daran mitgewirkt haben – zusammen mit einigen hervorragenden Studiomusikern wie dem britischen Drummer Stuart Elliot und dem Keyboarder Billy Nicholls, der auch die meisten Songs geschrieben hatte. Das macht vielleicht sogar den Reiz des Albums aus: dass The Who hier die Stücke eines fremden Komponisten einspielten.
Der interessanteste Titel ist allerdings weniger unter den eingängigen Balladen zu suchen, die Roger gekonnt und mit viel Gefühl interpretierte; sondern ist ein ungewöhnlich breit instrumentiertes Stück ohne Gesang mit dem Titel „Escape Part One“. Über die Produktion dieses Tracks wurde so wenig bekannt, dass die Vermutung naheliegt, dass sich hier vor allem die Studiomusiker austoben durften.
Für die Who-Fans bot der Sommer 1980 trotz aller Querelen hinter den Kulissen einen vielversprechenden Ausblick auf die kommenden Monate. Petes Empty Glass und Rogers McVicar hatten unbestreitbar Appetit gemacht auf ein echtes Who-Album, dessen Veröffentlichung auch kurz nach der USA-Tournee mit viel Tamtam angekündigt wurde. Es sollten sogar zwei Alben kurz hintereinander folgen. Manchem Fan war das jedoch am Ende dann gar nicht mehr recht, nachdem er die beiden Werke gehört hatte. Es soll sogar Who-Anhänger geben, die lieber ganz ohne Who-Musik aus den Achtzigern direkt ins nächste Jahrtausend übergewechselt wären, als jene zähe Agonie mitzuerleben, die nach den beiden folgenden Studioalben die Band für vierundzwanzig Jahre befiel.
Wir werden sehen, ob solche Enttäuschung begründet ist. Das Liebäugeln mit Fahnenflucht lässt sich jedenfalls in gewisser Weise nachvollziehen, denn über den Niedergang seiner Idole zu lesen, ist für jeden Who-Fan schlimm. Darüber zu schreiben, ist freilich noch viel schlimmer.
Und doch muss es sein.