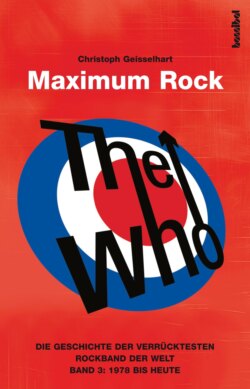Читать книгу The Who - Maximum Rock III - Christoph Geisselhart - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.: „Dance It Away“: Cincinnati oder der Anfang vom vorläufigen Ende
„Es war ein symbolischer Moment und wir hätten richtig damit umgehen können, aber das taten wir nicht.“
Pete über die Tragödie von Cincinnati, bei der elf Fans zu Tode getrampelt wurden
„Ich spürte, dass ich auf jemandem stand.“
Ein Augenzeuge im Bericht der offiziellen Untersuchungskommission
„Es waren viel zu viele Leute auf zu engem Raum, die nur vorwärts gehen konnten.“
Ein Augenzeuge im Rolling Stone
„Das ist das Ende.“
Rogers erste Reaktion, als er nach dem Konzert über das Ausmaß der Katastrophe informierte wurde
Während der Filmfestspiele in Cannes, die zu einer Hommage an Keith Moon gerieten, war es auch zu einer nostalgischen Begegnung zwischen den Who und ihrem Ex-Manager Kit Lambert gekommen.
Es lässt sich nicht ganz rekonstruieren, weshalb der schwer drogenabhängige Lambert plötzlich in Südfrankreich auftauchte, und vor allem, wie er die kostspielige Reise dorthin finanzieren konnte, wo doch das Vormundschaftsgericht seine Eingaben zur Wiederherstellung seiner Geschäftsfähigkeit regelmäßig ablehnte. Wir erinnern uns: Um den vollständigen Verlust seiner Güter und Rechte an die Banken abzuwenden, hatte sich der einst geniale homosexuelle Exzentriker, der The Who groß gemacht hatte wie Manager Brian Epstein die Beatles, im Herbst 1976 vom Court of Protection als unmündig erklären lassen (siehe Band zwei). Lambert focht seitdem einen verzweifelten, aber hoffnungslosen Kampf um Glaubwürdigkeit. Zu groß waren seine Schulden, zu hartnäckig die Gläubiger in England, Italien und den USA, und zu schwer wog seine Sucht, der Alkoholismus und seine nachgewiesene Unseriosität, um das Vormundschaftsgericht überzeugen zu können. Wer sich einmal diesem Kuratorium unterstellt hatte, musste sehr gute Argumente vorbringen können, wenn er aus der Vormundschaft wieder entlassen werden wollte. Und diese Argumente hatte Lambert offenkundig nicht.
Nach dem zweiten Konzert im römischen Amphitheater traf der gebeutelte Ex-Manager seine früheren Mündel – vermutlich mit dem Vorsatz, sich der Band erneut anzudienen. „Kit hat mir gerade in fünfzehn Minuten erklärt, was mit den Who nicht stimmt“, berichtete Pete nach dem Wiedersehen. „Und er hat recht.“
Dieses Statement wirft ein bezeichnendes Licht auf den Zustand der beiden Gesprächspartner. Kit hätte sich eher damit beschäftigen sollen, was mit ihm selbst nicht in Ordnung war, und auch Petes Konfusion muss beachtlich gewesen sein, wenn er sich allen Ernstes eine Analyse der Bandsituation zu eigen machte, die von einem gefallenen Lebemann kam, der zum unrettbaren Trinker, Junkie, Habenichts geworden war.
Lambert jedoch zog aus Petes Äußerung die vage Hoffnung, die Who würden ihn wieder als Manager akzeptieren. Er wusste, dass der aktuelle Geschäftsführer Bill Curbishley Rogers Mann war, und er versuchte Pete klar zu machen, dass diese Konstellation auf Dauer zu seinem Nachteil gereichen würde. Außerdem benötigte Lambert dringend Geld. Von seinen Reichtümern war ihm nichts mehr geblieben, nachdem das Gericht erst einmal die Forderungen der Gläubiger befriedigt hatte. Die private Treuhänderin Daria Shuvalloff, Kits Jugendfreundin, hatte ihre Aufgabe inzwischen weitgehend an einen amtlichen Konkursverwalter übergeben, der bei einem Besuch in Lamberts venezianischem Dogenpalast umgehend den Verkauf des Hauses angeordnet hatte.
Der Palazzo Dario war in einem erbärmlichen Zustand. Kaum noch möbliert, da regelmäßige Auktionen das kostbare Interieur zur Deckung der Kredite und Forderungen fast völlig ausgebeint hatten, inzwischen dreimal ausgeraubt und durch einen Brand beschädigt, nachdem die in einem Seitenflügel hausende Vertraute Lamberts, Anya Butler, vergessen hatte, die Heizung abzustellen, fand das ehedem märchenhafte Haus am Canale Grande zunächst keinen Käufer. Sotheby’s versteigerte im Sommer 1979 den Rest der Einrichtung – darunter die wertvollen Kristallkronleuchter, die Bibliothek, Gemälde und persönliche Gegenstände Lamberts – für vierunddreißigtausend Pfund. Das Haus selbst kam erst im November 1979 unter den Hammer und fand für dreihundertsechzigtausend Pfund einen Käufer, woraufhin Daria Shuvalloff ihre Pflicht als erfüllt betrachtete und von ihrem Amt als Treuhänderin zurücktrat.
Lambert zeigte sich über die Schuldentilgung wenig erfreut, vielmehr bezichtigte er alle daran Beteiligten, sie hätten sich persönlich an seinem Leid bereichert. Er lebte inzwischen nicht mehr bei seiner Mutter, sondern hatte bei einem kinderlosen Ehepaar Unterschlupf gefunden, das sich allerdings bald nach seinem Einzug trennte. Abermals obdachlos geworden, erinnerte er sich an eine alte Bekannte, Louise Fitzgerald, die einst in der Werbeabteilung eines Schallplattenvertriebs gearbeitet hatte. „Eines Tages stand er plötzlich vor der Tür meines Apartments“, erzählt sie, „mit zwei Papiertüten unter dem Arm. Es war schockierend, dass er wohl nur noch die Möglichkeit hatte, eine ferne Bekannte wie mich aufzusuchen. Er sah aus wie ein Landstreicher, und als ich ihm das sagte, meinte er nur: ‚Geld brennt dir Löcher in die Hosentasche.‘ Ich sagte ihm, dass er drei Monate bleiben dürfe, und dass die Hausregel vorschrieb: ,Keine Jungs!‘“
Louise Fitzgerald war nicht die erste und auch nicht die letzte weibliche Rettungsstation, die Kit Lambert in seiner Not aufsuchte. Seine Motive waren relativ durchsichtig und nachvollziehbar. Was die alleinstehenden Damen allerdings bewog, ihn aufzunehmen, nächtelang seinen Monologen zu lauschen, seine Launen und Klagen, die Paranoia und die Drogensucht zu ertragen, ihn durchzufüttern und zu bemuttern, wenn er die wöchentliche gerichtliche Auszahlung schon am ersten Tag verspielt, in Koks oder Heroin umgesetzt hatte, das alles gehört in den Bereich der freudianischen Spekulation.
Fakt ist, dass Lambert deutlich länger als drei Monate in Louise Fitzgeralds Wohnung lebte. Während dieses Aufenthalts, so bestätigt seine Versorgerin, suchte er mindestens noch ein weiteres Mal Bill Curbishley auf, um seine Wiedereinsetzung als Who-Manager zu bewerkstelligen. Logischerweise ließ sich der gradlinige und professionell denkende Curbishley auf keinerlei Zusagen ein. Keiner in der Who-Entourage, außer dem mitfühlenden und selbst in ein Psychodrama gleitenden Pete vielleicht, hätte Kit Lambert noch ernstlich zugetraut, dass er einer geordneten Arbeit nachgehen könnte. Zumal die Analyse, die Lambert in Cannes aufgestellt hatte, keineswegs zutraf: Die Geschäfte des Who-Konzerns liefen nämlich mit weltweit zwei Filmen in den Kinos und einer gleichzeitig anstehenden Tournee wie geschmiert.
Zehn Tage nach dem Konzert in Nürnberg startete der erste Teil der USA-Rundreise, ein zweiwöchiger Trip an die Ostküste mit Auftritten in New Jersey und im Mekka der kommerziellen Unterhaltungsindustrie, im Madison Square Garden von New York City. Über hunderttausend Menschen sahen dort sieben spektakuläre Aufführungen. The Who hatten zusätzlich eine dreiköpfige Bläsergruppe engagiert, um ihr musikalisches Spektrum auf der Bühne zu erweitern, und sie nutzten die Freiheiten, die ihnen die größere Besetzung gab, weidlich aus. Ihr ohnehin sehr anspruchsvolles Best-of-Set reichte von „Boris The Spider“ bis „Trick Of The Light“ mit Johns sensationellem Powerspiel am achtsaitigen Bass, zu dem Pete den regulären Basspart übernahm; es reichte von „I Cant’t Explain“ bis „Long Live Rock“, von „Substitute“ bis „Won’t Get Fooled Again“, von „My Generation“ bis „Magic Bus“ und von „Pinball Wizard“ bis „5:15“ – und zu diesem traumhaften Medley aus den erfolgreichen Who-Alben Tommy, Who’s Next, Quadrophenia und Who Are You kamen noch die Sechzigerjahrehits, die sie souverän herunterrotzten und je nach Lust und Laune abwandelten.
Außerdem gab es noch völlig neue Klänge. Schon am zweiten Abend in New Jersey fiel die Band scheinbar wie aus dem Nichts in „All Right Now“ von Free ein, wohl um Rabbits frühere Verdienste zu würdigen; dazu kamen das lange nicht mehr auf der Bühne gehörte Stück „Road Runner“, „Pictures Of Lily“ und „Big Boss Man“ von Willie Dixon – eine Premiere wie der zwei Tage später in New York aus dem Songkatalog gezauberte neue Titel „Cats In The Cupboard“, der im Jahr danach auf Petes Soloalbum Empty Glass erscheinen sollte.
Weitere Auszüge aus Petes eigenem Schaffenszyklus folgten am 16. September im Madison Square Garden. Hier vernahm man mit „Dance It Away“ ein Stück, das Pete auf seinem übernächsten Soloalbum, All The Cowboys Have Chinese Eyes, veröffentlichen sollte; zwei Tage später gab es eine erste Kostprobe von „I’m An Animal“, das sich ebenfalls 1980 auf Empty Glass wiederfand. Der Komponist dokumentierte damit nicht nur seine Souveränität, sondern auch ein Stück weit seine Unsicherheit und Wankelmütigkeit. Er schien erst ausprobieren zu müssen, welche Titel er für die Who opfern sollte und welche er für sich zurückbehalten durfte.
Doch auch alte Nummern intonierte die Band munter weiter. Am liebsten bedienten sie sich der frühen Coverversionen, die sie zu gekonnten Improvisationen im Anschluss von „My Generation“ ausbauten. Am 18. September waren dies beispielsweise „Shakin’ All Over“ und „Please Don’t Touch“ von Johnny Kidd & The Pirates sowie „Sweets For My Sweet“ von den Searchers; darauf folgte die Motown-Nummer „Dancing In The Street“ (Martha And The Vandellas) aus der Feder von Marvin Gaye, die sie zuletzt 1966 in Stockholm gespielt hatten. Diese Reminiszenz konterkarierten sie schließlich knallhart mit „Pretty Vacant“ von den Sex Pistols.
Am erstaunlichsten an dieser Show mit dreißig Titeln aber war, dass Pete sich mittendrin nach einer besonders heftigen Windmühlen-Attacke bei „Who Are You“ schwer an den Schaltknöpfen seiner Gitarre verletzte und mit einer bluttriefenden Hand die Bühne verlassen musste. Backstage nähte ein Arzt die aufgeschlitzte Hand, während die verbliebenen vier Musiker unter Leitung von Roger improvisierend die Zeit überbrückten. Die Stegreifvorführung mündete im ersten Who-Schlagzeugsolo von Kenney Jones; Roger wechselte sodann von der Mundharmonika an Petes Gitarre, begann „My Generation“, und John schloss sich mit einem ausgedehnten Soloritt über den langen Hals seiner Bassgitarre an.
Bei „Magic Bus“ hatte der Arzt in den Kulissen seine Arbeit an der rechten Gitarristenhand verrichtet, und Pete stürmte zurück ins Rampenlicht. Er demonstrierte alsgleich mit „Pinball Wizard“, weshalb er in erster Linie für die Saitenarbeit bei den Who zuständig war und nicht Roger, der Petes Wunsch nach einem zweiten Gitarristen beseelt aufgegriffen hatte und nun selbst wieder gelegentlich wie in alten Detours-Zeiten die Saiten zupfte. Tags darauf stellte Pete gegen Ende der letzten Show die Dinge mit einem kleinen „Saitenhieb“ endgültig klar: „Letzte Nacht wurden alle, die dabei waren, mit einem ungewöhnlichen Anblick belohnt. Roger Daltrey spielte Gitarre, während ich meine Hand richten ließ. Also halte ich eine kleine Aufmerksamkeit für angemessen. Herausrollen, bitte!“ Und auf Petes Geheiß schob ein Roadie eine billige E-Gitarre und einen winzigen Verstärker auf die Bühne und schloss das wenig imposante Ensemble an den Strom an. Roger spielte einen Akkord, worauf Pete protestierte: „Viel zu laut!“ Dann ging es mit „Shakin’ All Over“ weiter, und bei „Road Runner“ wurde ein Kuchenbüffet auf die Bühne gekarrt, das groß genug war, um ein Männerwohnheim zu verköstigen und infolgedessen ausreichend Munition für die abschließende Tortenschlacht lieferte.
Das Time Magazine widmete „der triumphalen Rückkehr der Who“ einen ausführlichen Bericht, wobei es besonderes Augenmerk auf die offenbar sehr speziellen Fans der Gruppe legte: „The Who spielen für ein Publikum, das alterslos scheint. Für diese Kids ist Rock’n’Roll weit davon entfernt, bloße Unterhaltung zu sein; eher ist es für sie eine Frage von Leben und Tod.“ Die buchstäbliche Richtigkeit dieser Feststellung sollte sich bald tragisch bewahrheiten.
Nach einer dreiwöchigen Pause in London und vier Auftritten, die dem britischen Modpublikum geschuldet waren, setzen The Who ihre USA-Tournee fort. The Kids Are Alright und Quadrophenia kamen im Herbst in Amerika in die Kinos, und so waren Eintrittskarten für die dreizehn Konzerte Mangelware, obwohl die Gruppe in Arenen spielte, die bis zu fünfzigtausend Personen Platz boten. Tourbegleiter Richard Barnes erinnert sich:
„Mir fiel auf, wie unterschiedlich die Zuschauer in den USA und in England waren. In Großbritannien herrschte trotz der Treue der Fans nicht diese schiere Begeisterung. Das Publikum in England war viel kritischer als in den Staaten, wo die Kids entschlossen wirkten, sich einfach nur gut zu amüsieren. Niemand fühlte sich wie in einer Jury, die am Ende Punkte zu vergeben hat. Zudem hatte in England die Punk-Revolution stattgefunden und bewirkt, dass etablierte Bands noch argwöhnisch beobachtet wurden. Logischerweise spiegelte sich das im Auftritt der Gruppe wider. In den USA begann ein gewaltiges Gebrüll, kaum dass der erste Akkord angeschlagen wurde, und die Energie schwappte zurück auf die Bühne, so dass selbst relativ kleine Zuschauerzahlen ausreichten, um eine überwältigende Atmosphäre zu erzeugen.“
Bereits die erste Show im eher kleinen Masonic Auditorium in Detroit wurde zu einem von Hysterie und Euphorie getragenen Rockspektakel, wie es nur ganz große Bands zelebrieren können. Überraschungssongs dieses Abends waren „I Can See For Miles“, „Young Man Blues“ und „Dancing In The Street“, das mit Petes Stück „Dance It Away“ kombiniert wurde. „Ihr – oder eure Eltern – habt damals unserer ersten Platte in Detroit zum Durchbruch verholfen“, erinnerte Pete die örtlichen Fans an eine lange Beziehung, die 1965 mit „I Can’t Explain“ begonnen hatte.
Am 3. Dezember machten The Who nach einem Auftritt in Pittsburgh Station in Cincinnati im Bundesstaat Ohio. Das dortige Riverfront Coliseum, ein erst vier Jahre zuvor erbautes ovales Hallenstadion, in dem normalerweise die örtliche Eishockeymannschaft Cincinnati Stingers vor bis zu zehntausend Zuschauern ihre Heimspiele austrug, bot an diesem Abend fast neunzehntausend Personen Platz. Auch die Karten für dieses Who-Konzert waren innerhalb kürzester Zeit verkauft gewesen. Fast alle Tickets kosteten gleich viel, etwa zehn Dollar, und garantierten dem Inhaber nicht mehr, als dass er in die Halle passte.
Für US-Rockkonzerte war das damals die gängige Praxis. Man nannte diese Platzverteilung Festival Seating. In der Praxis bedeutete dieser hübsch klingende Begriff: Wer zuerst kommt, kriegt die besten Plätze. Demzufolge bildeten sich bereits am Mittag lange Schlangen vor dem auf Betonstützen errichteten Coliseum, das auf der einen Seite durch die Autobahn, auf der anderen durch den Ohio River begrenzt wird. Der Stauraum für die Wartenden wurde bedrohlich eng, als die Menge auf rund achttausend Menschen angewachsen war. Das war gegen achtzehn Uhr dreißig. Die Band erschien ohne Roger Daltrey zu einem späten Soundcheck, was den ungeduldigen Fans vor den Glastüren Anlass zur Vermutung gab, das Konzert würde bereits beginnen.
Von hinten drängten Tausende nach vorn. Dort standen eine Handvoll Ordner, die zwei noch geschlossene Glastüren bewachten – offizielle Quellen sprechen von vier besetzten Eingängen, viele Augenzeugen nur von einer Schiebetür. Einige Menschen kamen im Gedränge zu Fall. Andere warfen die Glasscheiben ein und versuchten durch die aufgesplitterten Lücken ins Innere des Coliseums zu schlüpfen. Gerade einmal fünfundzwanzig Polizisten waren zu diesem Einsatz abkommandiert; sie griffen nicht ein, obwohl viele Menschen um Hilfe riefen.
Nun wurden die Eingänge endlich geöffnet. Das Coliseum hat sechzehn Glastüren, die man alle sofort hätte öffnen müssen, doch die überforderten Ordner befolgten pedantisch die Anweisungen des Veranstalters und quetschten die völlig außer Kontrolle geratene Menschenmenge durch die wenigen vorgesehenen Schleusen, wobei jede Tür nach jedem Besucher geschlossen wurde, damit die Kartenabreißer akribisch die Tickets kontrollieren konnten. Panik brach aus. Einige Fans kletterten über die Wartenden, wodurch weitere Menschen zu Boden fielen, niedergedrückt und zertrampelt wurden. Ihre Schreie gingen im Chaos unter. Wer zwischen die Strömungen der Nachdrängenden und der Zurückgeworfenen geriet, befand sich in höchster Not. Ron Duristch, der zwischen vielen tausend Who-Fans vor dem Coliseum eingeschlossen wurde, berichtet auf der Webseite der Institution Crowdsafe, die nach der Tragödie gegründet wurde, von seiner beklemmenden Erfahrung:
„Eine Welle schob mich nach links, und als ich wieder Halt gefunden hatte, fühlte ich, dass ich auf jemandem stand. Vor lauter Hilflosigkeit schwappte Panik in mir hoch. Ich schrie aus Leibeskräften, dass ich auf jemandem stand. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nur schreien. Eine weitere Welle erfasste mich und spülte mich nach links, auf den Eingang zu. Ich fühlte, wie mein Bein nach rechts gestoßen wurde. Die Menge bewegte sich wieder, und ich langte nach unten an mein Bein, wo ich einen Arm zu fassen bekam. Ich kämpfte eine Weile, und schließlich zerrte ich ein junges Mädchen hoch, an deren Glieder sich noch ein Junge klammerte. Die beiden waren nahezu bewusstlos, und ihre Gesichter waren tränenüberströmt.“
Schon jetzt war klar, dass es viele Verletzte geben würde, doch das kümmerte die wenigsten der enthemmten Menschen vor und im Coliseum. Diejenigen, die endlich Einlass in die Halle gefunden hatten, stürmten wie besessen auf die besten Plätze; sie hatten es überstanden und freuten sich auf das Konzert. Richard Barnes, der den Aufbruch zum Soundscheck verschlafen hatte, erreichte das Coliseum kurz nach zwanzig Uhr:
„Als die Limousine zum Backstagebereich einbog, standen da ein großer Feuerwehrtransporter und einige Krankenwagen. Der Polizist winkte uns fort. Wir wendeten, und beim nächsten Versuch wurden wir eingelassen. Ich hielt das Feuerwehrauto für eine Vorsichtsmaßnahme der amerikanischen Städte bei großen Rockkonzerten. Hinter der Bühne traf ich einen alten Bekannten, und gemeinsam beschlossen wir, die Show vom Auditorium aus anzuschauen. Als wir durch die Korridore gingen, sah ich mehrere Feuerwehrleute hinter den Kids hereinhasten. Ich vermutete, dass es irgendwo einen kleinen Brand gegeben hatte, konnte aber nirgends Rauch entdecken. Nach einiger Zeit sah ich weitere Polizisten und Sanitäter, sowohl innen als auch außerhalb der Glastüren. Ich fragte eine Platz-anweiserin, ob es einen Brand gegeben habe. Sie entdeckte meinen Who-Tourpass und meinte: ‚Wisst ihr denn nicht, was passiert ist? Fünfzehn Leute sind umgekommen!‘ Aus irgendeinem Grund glaubte ich ihr nicht. Ich dachte, es habe vielleicht Herzinfarkte gegeben oder Opfer von Drogenüberdosis, und die Frau habe die Sache nur aufgebauscht. Wir erspähten noch mehr Uniformierte, die sehr besorgt dreinblickten und die Örtlichkeiten inspizierten, und allmählich begriffen wir, dass etwas wirklich ernsthaft schief gelaufen war. Ich fragte einen zweiten Ordner, der mir erklärte, dass es elf Tote gegeben habe. Ein älterer Mann kam dazu und verkündete beinahe stolz: ‚Wussten Sie das nicht? Hier wurde heute Abend Geschichte geschrieben. Die ganze Welt wird es morgen erfahren.‘“
The Who standen indessen auf der Bühne und spielten ein begeisterndes Konzert vor Zuschauern, die ebenfalls keine Ahnung hatten, was einige Meter hinter ihnen geschehen war. In der Halle herrschte eine völlig andere Stimmung als in den Gängen und vor dem Coliseum, wo man die ersten Toten nach einer halben Stunde entdeckt hatte und Dutzende von Verletzten ärztlich versorgte. Der alarmierte Richard Barnes eilte zurück in den abgeschotteten Bereich hinter den Kulissen:
„Bill Curbishley stand hinter der Bühne an der Verstärkerwand. Ich sagte ihm: ‚Ich habe gerade gehört, was passiert ist.‘ Er erklärte, die Gruppe wisse von nichts, und wir sollten so wenigen Leuten wie möglich davon erzählen. Er hatte es erst nach der fünften oder sechsten Nummer erfahren; der Promotor hatte ihm mitgeteilt, dass es zwei Tote gegeben habe. Kurz darauf waren es vier Tote, die angeblich an einer Überdosis Drogen gestorben waren. ‚Erst mit dem Fortgang der Show bekam ich mit, was wirklich geschehen ist‘, sagte Bill. Jemand schlug vor, das Konzert abzubrechen; aber Bill meinte, das sei das Schlechteste, was die Verantwortlichen tun konnten: ‚Wenn Sie neunzehntausend Jugendlichen erklären, dass einige von ihnen da draußen tot liegen, werden Sie keine Möglichkeit mehr haben, den Platz in Ordnung zu bringen, und hier drinnen bricht Gewalt aus.‘ Der Leiter der Feuerwehr war der gleichen Ansicht. In der kurzen Pause vor der Zugabe versammelte Bill die Band im kleinen Aufwärmraum und sagte: ‚Es ist etwas sehr Ernstes geschehen. Ich möchte, dass ihr jetzt rausgeht und eure Zugabe spielt und dann geradewegs wieder hierher kommt. Ich werde euch alles erklären.‘ Bill wies sie an, mit niemandem zu sprechen, sondern sofort zurück hinter die Bühne zu kommen. Pete stieß ein kurzes nervöses Lachen aus und zündete sich eine Zigarette an. Dann besprachen sie, welche Stücke sie spielen wollten, und gingen zurück auf die Bühne.“
Wenn es bei einer Vergnügungsveranstaltung zu einem Unglück kommt, was angesichts von vielen Menschen am selben Ort gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie es den trügerischen Anschein hat (tatsächlich wächst ja die statistische Gefahr eines Unfalls mit der Zahl der Menschen, ungeachtet ihrer Fröhlichkeit), stellt sich immer die gleiche Frage: Soll man die Veranstaltung abbrechen oder weitermachen? In den meisten Fällen heißt es: „The show must go on!“ Auch in Cincinnati waren die besseren Argumente wohl auf der Seite der Befürworter dieser Strategie, die darauf zielt, die Menschen nicht zusätzlich in Unruhe zu bringen, sondern die Situation zu kontrollieren. Der Schock wirkt allerdings umso heftiger, wenn die Wahrheit verzögert ans Licht kommt. Die Überlebenden fühlen sich nicht nur bedrückt und traurig, was die natürliche Reaktion auf das Unglück anderer ist, sondern noch dazu schuldig und hintergangen. „Wir haben uns vergnügt, während andere qualvoll sterben mussten – weshalb hat uns niemand etwas davon gesagt?“ The Who teilten diese schmerzhafte Erfahrung mit ihren Fans; jedenfalls an diesem einen Tag, in dieser Nacht, bevor sie weiterzogen. Richard Barnes berichtet von den Reaktionen, nachdem der Manager seiner Band in der Garderobe reinen Wein eingeschenkt hatte:
„Die Stimmung war verständlicherweise sehr niedergeschlagen und angespannt. Das Büffet wurde kaum angerührt, und es kamen keine Gäste in dieser Nacht. Einige standen in Gruppen zusammen und sprachen leise über das Geschehen. Die meisten waren sprachlos und schwiegen. Wir kannten immer noch nicht die genauen Fakten. Bill wusste von zehn Toten, ich hatte von elf oder fünfzehn gehört. Die Band stand unter Schock. Roger war besonders emotional und den Tränen nahe. Er verkündete das Ende der Tournee, später sogar das Ende von The Who. Die Gespräche drehten sich im Kreis, jeder suchte nach Erklärungen, keiner fand eine. Stunden vergingen auf diese Weise. Alle waren erschöpft und leer, als wir nach draußen geführt wurden und in Autos einstiegen, die uns zum Hotel brachten. Der Veranstalter wollte, dass die Band die Stadt noch in der Nacht verließ. Vor dem Hotel warteten schon Reporter und Fernsehkameras, wir hasteten vorbei auf unsere Zimmer. Vor der Suite, die ich mit Pete teilte, standen zwei Wachmänner, um die Presse fernzuhalten; innen wanderten wir ruhelos umher und versuchten rauszukriegen, wer wo untergebracht war. Nach einiger Zeit telefonierte John alle zusammen, und wir trafen uns in seiner Suite. In einem solchen Moment will keiner allein sein. Einige standen immer noch unter Schock und hockten bloß stumm da, andere hatte sich schon alles von der Seele geredet und fühlten sich nun müde und leer. Die Tragödie selbst wurde kaum mehr besprochen. Der Fernseher lief, daraus bezogen wir unsere Informationen. Dank John, der erkannt hatte, dass keiner schlafen konnte und sich jeder in seinem Zimmer eingesperrt fühlte, kamen wir allmählich zur Ruhe, indem wir einfach nur zusammenblieben und jemanden zum Reden hatten. Am nächsten Morgen erwachte ich gegen sechs Uhr dreißig und schaltete den Fernseher ein. Namen, Anschriften und Alter der Opfer flimmerten über den Bildschirm. Ich lag im Bett und fing an zu heulen. Das Hotel war voller Presseleute und Kamerateams. Auf dem Weg zum Frühstück lief ich drei Reportern vom Time Magazine in die Arme. Vor Bills Zimmer stauten sich an die dreißig Journalisten, drinnen gab die Band eine kurze Erklärung ab. Dann wollten wir gehen und begaben uns zum Aufzug. Irgendwie war Kenney vergessen worden, also lief ich zurück, holte ihn und bugsierte ihn durch die Presseleute hindurch in den Aufzug. Es war eine bizarre Situation. Pete, Roger, John, Kenney, Rabbit, Bill und noch ein paar andere standen im Lift und warteten, dass der sich in Gang setzte, und uns gegenüber standen wenigstens sechs Reporter, ein Kameramann und die Fotografen, die unentwegt filmten, knipsten und fragten. Die Band war geschockt und rührte sich nicht. Endlich sagte Bill: ,Würden die Herren von der Presse jetzt bitte zurücktreten?‘ Nach einer Reihe weiterer Fragen gingen die Reporter endlich, und der Aufzug fuhr ins Erdgeschoss. Umgeben von Wachleuten wurden wir vom Hotelmanager an verdutzten Köchen und Mülltonnen vorbei durch Wäschezimmer und Küche in den Hinterhof zu einigen wartenden Autos geschleust. Wir rasten davon und ließen die meisten Presseleute zurück. Ein Fernsehteam folgte uns bis ins Flugzeug, das wir für den Flug zum nächsten Auftritt in Buffalo gebucht hatten. Die Fluggesellschaft verweigerte aber die Erlaubnis für Interviews an Bord. Bei der Ankunft warteten schon wieder Kamerateams, aber die Gruppe verließ die Maschine über eine eigene Treppe, die direkt zu den vorgefahrenen Autos führte.“
Richard Barnes’ Schilderungen spiegeln nachvollziehbar wider, weshalb die Schuldgefühle bei der Band immer größer wurden. Verfolgt und getrieben von den bohrenden Fragen der Journalisten – ein Veranstalter wollte sogar, dass sie die Stadt bei Nacht und Nebel wie Verbrecher verließen – gewannen Pete, Roger und John den Eindruck, dass sie persönlich am Tod von elf Menschen Anteil trugen. Je mehr über die Opfer bekannt wurde, desto stärker wurden ihre Schuldgefühle: Jacqueline Eckerle und Karen Morrison, fünfzehnjährige Freundinnen, waren gemeinsam zum Who-Konzert gegangen; sie kamen nicht mehr nach Hause. Brian Wagner, siebzehn, starb, sein Bruder überlebte. Connie Sue Burns, einundzwanzig und Mutter von zwei kleinen Kindern, war mit ihrem Ehemann unterwegs gewesen. Eine weitere junge Mutter hinterließ zwei kleine Kinder. Die elf Toten waren zwischen fünfzehn und siebenundzwanzig Jahre alt geworden – sieben Teenager, vier Erwachsene; sieben männlich, vier weiblich: „Ein repräsentativer Querschnitt der Who-Fans“, wie Dave Marsh in seiner Biografie kühl vorrechnet.
Man kann es auch taktvoller ausdrücken: dass nämlich ein Teil von The Who in dieser Tragödie, der furchtbarsten in der Geschichte US-amerikanischer Rockkonzerte, zweifellos mit den Opfern starb.
Um es klar zu sagen: The Who trugen keinerlei messbare Schuld. In den umfangreichen Untersuchungen, die auf das Unglück folgten, wurde nie ein Fehlverhalten der Band oder ihrer Manager erwähnt. In der abschließenden neunzigseitigen Dokumentation, an der eine zur Vermeidung ähnlicher Katastrophen einberufene Kommission in Cincinnati zwei Jahre gearbeitet hatte, tauche die Gruppe nicht einmal namentlich auf. Doch das änderte nichts daran, dass die Toten das Gewissen der Musiker nachhaltig bedrückten.
„So etwas kann bei einem Fußballspiel passieren oder bei einer Universitätsfeier“, erkannte Pete. „Es war mehr ein Zeichen für die Jugendlichen, die zu Rockkonzerten gingen, sich betranken und wahllos Drogen einnahmen. Aber das bedeutete nicht, dass wir uns nicht schuldig fühlten. Es war ein symbolischer Augenblick, und wir hätten ihn entsprechend würdigen sollen. Leider taten wir das nicht. Ich trank damals so viel, dass mir nicht bewusst war, was ich sagte. Ich sagte einige dumme Sachen, was die Familien der Opfer verletzte. Ich sagte zum Beispiel: ‚Alle wollen anscheinend, dass wir uns eine theatralische Träne aus dem Auge wischen, während wir aber nichts anderes tun können, als weiterzumachen.‘ Das ist nicht richtig. Wir hätten durchaus anhalten können. Wir hätten in Cincinnati bleiben müssen. Wir hätten den Familien beistehen können. Ich weiß auch nicht genau, warum wir das nicht taten. Wahrscheinlich weil so viel Geld hinter der Tour steckte. Es hätte ein riesiges rechtliches Durcheinander gegeben, wenn wir die weiteren Auftritte abgesagt hätten. Unsere Vorstellung war: Wir fahren nach Buffalo, und wir tun das für die gestorbenen Jugendlichen. Das war natürlich Blödsinn. Unsere Berater, unsere Anwälte lagen komplett falsch. Die Plattenfirma, die Manager, mein Anwalt, die Fans, alle. Und über allen thronte ich selbst als König der Dummheit. Das Erstaunliche für uns war, dass wir für einen kurzen Moment, als man uns nach dem Konzert mitteilte, dass elf Kids gestorben waren, unseren Schutzschild aufgaben. Nur für eine Sekunde. Dann war sie wieder da, unsere ‚Tour-Rüstung‘. Wir sagten uns: Scheiß drauf, durch so eine Sache lassen wir uns nicht aufhalten.‘ Wir mussten das Geschehen vor uns selbst klein reden, denn wenn wir uns seine wahre Bedeutung eingestanden hätten – nicht im Sinn von ,so ist Rock’n’Roll‘, sondern: ,Die Tragödie geschah bei einem unserer Konzerte, und deswegen betrifft sie uns‘ – wenn wir uns das eingestanden hätten, dann hätten wir nicht weitermachen können. Aber das mussten wir. Wir waren eine Rock’n’ Roll-Band. Wenn du auf Tour gehst, wirfst du dich in eine Rüstung und agierst wie in Trance.“
Wie Pete angedeutet hat, gibt es in der Geschichte der Rockmusik andere Beispiele für das Verhalten nach Katastrophen. Beim Roskilde-Festival 2002 wurden während des Auftritts von Pearl Jam, die zweifellos zu den besten Livebands der neunziger Jahre gehörten, neun Menschen erdrückt. Das Festival galt als einer der sichersten Konzertorte Europas; entsprechend groß waren der Schock und das Gefühl von Hilflosigkeit. Das Festival wurde zwar ebenfalls nicht unterbrochen, um ein Chaos zu verhindern, aber die neunzigtausend Besucher und die teilnehmenden Musiker erhielten die Möglichkeit, die Tragödie in einer gemeinsamen Zeremonie aufzuarbeiten. Pearl Jam sagten den Rest der Tournee ab und erklärten, sie würden nie wieder auf einem Festival auftreten. Heute erinnern neun Birken und eine Gedenktafel mit der Aufschrift „So zerbrechlich sind wir“ an das Unglück.
Das Riverfront Coliseum gehört inzwischen einem großen amerikanischen Kreditunternehmen und trägt keine Gedenktafel. Es durchlebte nach 1979 eine wechselvolle Geschichte. Die Stadt Cincinnati hatte es zunächst schwer, neue Veranstaltungen für die Halle zu buchen, obwohl die Verwaltung sofort ein wegweisendes Verbot für das folgenschwere Festival-Seating erließ. 1980 gastierten im Coliseum die unerschrockenen Südstaatenrocker von ZZ Top, ein Jahr später Black Sabbath – und jedes Mal waren alle sechzehn Eingangstüren durchgehend geöffnet. Die Halle blieb Bestandteil eines Sportkomplexes, der im Dezember 2002, fast genau dreiundzwanzig Jahre nach dem tragischen Who-Konzert, abermals für Schlagzeilen sorgte, als das angeschlossene Baseballstadion unter dramatischen Umständen einstürzte. The Who hatten damals (im Herbst 2002) gerade ihre erste Tournee nach dem plötzlichen Tod von John Entwistle abgeschlossen. In der Berichterstattung wurde der Bassist, der einst auf der Bühne mit seinem makabren Skelettlederanzug für Aufsehen gesorgt hatte, zwar meist schmerzlich vermisst, aber es hieß auch: „The Who, die schon 1982 ihr angeblich letztes Konzert gegeben hatten, kamen zurück – mit zwei Stunden und fünfzehn Minuten leidenschaftlicher, lauter und zumeist erregender Musik.“
Der Tod hat diese Band anscheinend schon immer eher inspiriert als abgeschreckt. Immer weiter zu spielen, das war ihre große Stärke, auch wenn es unter menschlich-moralischen Gesichtspunkten manchmal fragwürdig wirkte. Aber das waren Kriterien, die für gewöhnliche Sterbliche gelten mochten; für Unsterbliche wie The Who galten sie nicht.