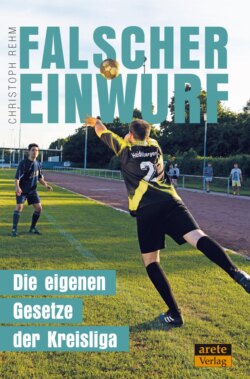Читать книгу Falscher Einwurf - Christoph Rehm - Страница 8
ОглавлениеLass dich nicht!
Einfach mal so auf dem Sportplatz ein paar Sprüche klopfen? Das geht selten gut. Wer mit seinen Mitspielern angemessen kommunizieren möchte, sollte sich zumindest mit den Grundlagen der Kreisligasprache vertraut machen.
Dass Interviews mit Fußballspielern in der Regel nicht als Bewerbung für den Pulitzer-Preis taugen, ist bekanntlich nichts Neues. So mancher Kicker, der dampfend und keuchend kurz nach Abpfiff dem Reporter am Spielfeldrand nur ein paar harmlose Floskeln in das Mikrophon hecheln will, hat sich dabei nicht selten schon um Kopf und Kragen gestammelt. Rhetorische Glanzlichter wie beispielsweise von Andreas Möller, der unbedingt nach Italien wechseln wollte – sei es nun nach Mailand oder eben Madrid – haben mittlerweile ihren Weg in unzählige, mehr oder weniger liebevoll zusammengestellte Zitatesammlungen gefunden. Kaum Beachtung findet allerdings jene, für Fußballer in allen Ligen typische Terminologie, die zumeist so absurd schwachsinnig ist, dass sie eigentlich schon niemandem mehr weiter auffällt. Kombiniert mit regionalen Dialekten, falscher Grammatik und bizarren Wortschöpfungen kommt so auf den Sportplätzen – landauf, landab – ein derartiges Kauderwelsch zur Anwendung, dass jeder auch nur mittelmäßig motivierte Deutschlehrer nach 90 Minuten in Embryonalstellung unter der Dusche sitzt.
„Lass dich nicht!“ gehört beispielsweise zu jener Art von Instruktionen, die zwar ohne Verb, dafür aber mit jeder Menge sozialem Sprengstoff daherkommen. Soll sich ein Spieler nicht „lassen“ lassen, wird das Gewinnen des folgenden Defensivzweikampfes quasi vorausgesetzt – schließlich hat man als Trainer, Zuschauer oder Mitspieler alles Menschenerdenkliche dafür getan, den Verteidiger auf die prekäre Situation vorzubereiten. Wird der anschließende Zweikampf trotz dieser umfassenden Hilfestellung dennoch verloren, gerät der Spieler spätestens in der Halbzeitpause in Erklärungsnot. „Er hat sich lassen!“ weist der Co-Trainer dabei seinen Chef noch einmal auf das Versagen des Schützlings hin. Die Analyse wird mit einem fachmännischen Nicken quittiert. Es ist eine charmante Vorstellung, dass Unterredungen von Trainern bei Champions-League-Duellen ähnlich ablaufen.
Grammatikalisch vertretbar, dafür semantisch fragwürdig, ist hingegen die Formulierung „Leck mich am Arsch“ – die wohl am häufigsten verwendete Phrase auf einem Sportplatz. Eigentlich wird nahezu jeder halbwegs vollständige Satz mit dieser Floskel eingeleitet: „Leck mich am Arsch, der Pass war gar nicht schlecht“, „Leck mich am Arsch, heute spielen wir im 4-4-2“ oder „Leck mich am Arsch, hat noch jemand eine Stück Banane?“. Selbstverständlich ist das alles keine Unmutsbekundung, eher Ausdruck einer bestimmten Höflichkeitsform, eine Art Kreisliga-Knigge. Eine Konferenz beginnt man ja auch nicht damit, dass man seinen Geschäftspartnern eine Handvoll Verträge auf den Tisch knallt und mit dem Hinweis „Unterschreiben, dann Sektempfang!“ versieht.
Außergewöhnliche Leistungen ziehen eine außergewöhnliche Anerkennung nach sich. Ist man von dem Verhalten eines Mitspielers in besonderer Form angetan, kann die Formulierung Berlichingen’scher Prägung auch gerne mehrmals in einem Satz verwendet werden, zum Beispiel als Eingangs- und Ausgangsfloskel: „Leck mich am Arsch, der Kevin kommt heute pünktlich zum Treffpunkt, leck mich am Arsch!“. Problematischer wird das Ganze dann lediglich, wenn ein frustrierter Spieler tatsächlich zu dem Schluss kommt, jemand solle ihn in aller Konsequenz möglichst am Arsch lecken. In der verstärkten Version führt dies zu einem etwas inflationären Gebrauch der rektalen Aufforderung: „Leck mich am Arsch, du kannst mich mal am Arsch lecken! Leck mich am Arsch!“.
Eine besondere Begrifflichkeit, die ihren Weg in den Alltagssprachgebrauch vieler Spieler gefunden hat, ist wiederum das so genannte „Jambalaya“. Der/die/das Jambalaya ist streng genommen ein kreolisches Reisgericht, hat seinen fußballerischen Ursprung allerdings im Aufwärmprogramm vieler Fußballmannschaften. Tatsächlich ist der Anwendungsbereich mittlerweile wesentlich vielfältiger – Jambalaya hat sich längst in der alltäglichen Sprache vieler Fußballer etabliert: „Achtung, der gegnerische Libero spielt im Mittelfeld oft Jambalaya!“, „Jungs, nach dem Spiel fahren wir in die Stadt und machen Jambalaya!“ oder auch als Spitzname für besonders verspielte Teamkameraden wie Marc „Jambalaya“ Müller. Absurd: Inzwischen werden sogar wieder Kochgerichte ohne irgendeinen Bezug zur kreolischen Küche als „Jambalaya“ bezeichnet. „Männer, ich muss heim! Meine Frau steht in der Küche und macht den Jambalaya!“.
Gelegentlich wird Jambalaya von Trainern und Spielführern auch als Drohungsszenario verwendet. „Wenn du meinst, du kannst da draußen den Jambalaya machen, nehme ich dich sofort wieder raus!“ gab mir mein Jugendtrainer gerne noch als zusätzliche Motivationsspritze vor versammelter Mannschaft mit auf den Weg. Als halbwüchsiger Zwerg hatte ich selbstverständlich keinerlei Ahnung von der kreolischen Küche. Wer oder was dieses Jambalaya war, erschloss sich mir auch nicht wirklich aus dem Zusammenhang. Warum sollte ich „da draußen“ während des Spiels irgendeine Aufwärmübung fabrizieren? Klar war jedoch: Jambalaya machte mir unheimlich Angst. Diesem Jambalaya wollte ich möglichst aus dem Weg gehen. Um Himmels Willen, ja, ich wollte auf keinen Fall mit diesem Jambalaya in Verbindung gebracht werden!
In der Konsequenz spielte ich daher möglichst konzentriert, versuchte keine Fehler zu machen und schlichtweg nicht sonderlich aufzufallen. Das hat meistens geklappt und der Trainer war zufrieden mit mir: „Saubere Arbeit, Christoph! Klare Bälle, sauberes Passspiel, weiter so!“. Voller Stolz radelte ich nach Hause, erzählte ausgiebig von meinen Heldentaten, und schaute vor dem nächtlichen Schlafengehen noch einmal kurz unters Bett – auf dass sich dort ja kein Jambalaya versteckte.