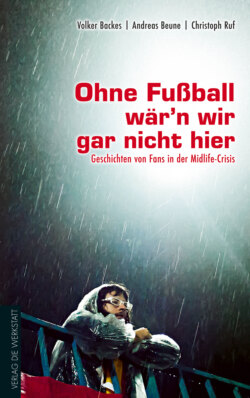Читать книгу Ohne Fußball wär'n wir gar nicht hier - Christoph Ruf - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[Andreas Beune] Wie ich ein bemitleidenswerter Fan einer noch bemitleidenswerteren Fußballmannschaft wurde Erste Kontaktaufnahme mit Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig und schuhwerfenden Schmuddelkindern. Später folgen Stadion-Hymne und Stadion-Crepes.
ОглавлениеMein Vater war kein Fußballfan. Er ging nicht wie viele andere seiner Generation ins Stadion und schmetterte nach zwei gespielten Minuten dem Linienrichter ein „Boaaah, du Sauuu“ entgegen, weil der eine vermeintlich falsche Einwurfentscheidung getroffen hatte. Mein Vater verfolgte nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft vor dem Fernseher. „Und, wie haben sie gespielt?“, fragte nachher meine Mutter. „4:0 gewonnen“, knurrte mein Vater, „aber das, was die sich in den letzten drei Minuten zusammengespielt haben, war einfach nur schlecht. Die können gar nix. Das nächste Mal schaue ich mir das Elend nicht mehr an.“ Überflüssig zu erwähnen, dass er es natürlich trotzdem tat.
Ich verstand davon nichts. Nur so viel: Fußballgucken macht unglücklich. Eines Tages sollte ich meine Einstellung ändern. Es geschah im Spätsommer 1981. Samstags fuhren wir mit der Familie zum Schwimmen ins Hallenbad nach Halle/Westfalen. Planschen im Wasser war kein Quell des Vergnügens. Das Chlorwasser war nicht nur nass, sondern schmeckte fürchterlich. Zudem hatte ich Höhenangst, wenn ich auf einem 1-Meter-Brett stand. Andere Kinder, die auch samstags mit der Familie schwimmen mussten, protestierten auf ihre Art: Sie pinkelten ins Becken, und ein ganz Mutiger hat einmal sogar im Schwimmerbecken sein großes Geschäft verrichtet. So was traute ich mich nicht. Also bemühte ich mich und zog langsam wie eine pensionsberechtigte Schildkröte meine Bahnen.
An diesem Samstag aber lenkte mich etwas ab. Am Ende der Schwimmbahn war ein Café, in dem Männer mit prächtigen Wänsten saßen. Wahrscheinlich Väter, die ihre Kinder in der Umkleidekabine eingeschlossen hatten, um endlich einmal in Ruhe hier zu sitzen und schweigsam dem Radio zu lauschen. Bis plötzlich eine Stimme aus dem Gerät brüllte: „Elfmeter in Bielefeld! Sackewitz läuft an und Tor! Das 1:1 gegen den 1. FC Köln!“ Die Männer jubelten. Nickten sich gütig und verschwörerisch zu. Rieben sich die Bäuche. Sie sahen anders aus als mein Vater vorm Fernseher. Irgendwie glücklich und mit sich im Reinen. Und etwas, das Arminia Bielefeld hieß und offenbar eine Fußballmannschaft war, hatte sie dazu animiert. Ich beschloss, dass genau so was meinem Leben fehlte. Eine Ausrede, nicht mehr zum Schwimmen zu fahren. Und ein Spender von Glückseligkeit und Frohsinn.
Ich hätte es besser wissen können. Meine neue Freundin entpuppte sich bereits auf dem Heimweg als überaus zickig und unfähig. Als die Schlusskonferenz im Radio beendet war, hatte Arminia das Heimspiel 2:5 verloren. Vielleicht war das eine Warnung. Eine Warnung vor einer falschen Gefährtin, deren größtes Hobby das Bereiten von Enttäuschungen ist. Existieren Fußballmannschaften nicht eigentlich aus dem Grund, Titel und Trophäen zu sammeln oder zumindest in ihre Nähe zu kommen? Sollten Fußballmannschaften nicht im Laufe eines über 100-jährigen Bestehens mehr erreicht haben, als Rekorde im Auf- und Absteigen aufzustellen? Arminia Bielefeld ist eine Schlange. Nur dass sie sich samt Apfelbaum niemals im Paradies aufgehalten hat.
Arminia trug ihre Heimspiele auf der „Alm“ aus. Für mich ein mythischer, geheimnisvoller Ort. Bis zu jenem Kindergeburtstag eines Freundes, der durch den Besuch des Bundesligaspiels Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig seine eigentliche Würze verliehen bekommen sollte. Die Eltern des Geburtstagskindes meinten es gut mit uns. Aber wie das so oft ist: Zwischen gut gemeint und gut gemacht prangt mitunter eine große Lücke. Die Karten waren für den Gästeblock. Das merkten wir aber erst, als die Erwachsenen uns im Stadion mit den Worten ablieferten: „Wir holen euch hier nach dem Spiel wieder ab.“ Da standen wir nun. Mit Schals und Pulsarmbändern, die uns eindeutig als Bielefelder Fans identifizierten. Ich trug ein viel zu enges Trikot, das einen Bauch umspannte, der schon in jungen Jahren beeindruckende Ausmaße angenommen hatte, um der Fußballfankost der kommenden Jahre Bier und Bratwurst ein kuscheliges Zuhause zu bereiten. Dadurch war allerdings auch der Schriftzug „Seidensticker“ noch besser zu lesen. Als die Braunschweiger Fans erkannten, dass direkt neben ihnen acht einsame kleine Bielefelder standen, leiteten sie umgehend pädagogische Maßnahmen ein. Mich ließen sie in Ruhe, weil eine Person mit XL-Maßen und Kleidung in XS-Größe sogar bei zahnlosen Rowdies Mitleid hervorruft. Auch raubten sie weder unsere Fan-Devotionalien, noch überschütteten sie uns mit Getränken, nein, sie schnappten sich einen von uns, zogen ihm einen Schuh aus und warfen diesen aufs Spielfeld. Kein Ordner, kein Polizist weit und breit, der hätte eingreifen können.
Zum Glück hatte die Partie noch nicht begonnen. Die Braunschweiger Mannschaft lief sich vor unseren Augen warm und die Spieler staunten nicht schlecht, als ein fliegender Schuh auf sie niederging. Der Torhüter der damalige Nationalspieler Bernd Franke begutachtete das Fluggeschoss, blickte etwas überrascht in den Fanblock und erspähte einen kleinen Jungen mit hochrotem Kopf, der schüchtern winkte. Franke schlurfte zum Zaun und unser Freund humpelte unbeholfen die Stufen hinunter. Der Torhüter gab den Schuh zurück.
Wir überlegten uns in der Zwischenzeit, ob man durch das Ausschneiden und das geschickte Vertauschen von Buchstaben, die auf unseren Trikots und Hemden klebten, nicht aus dem Wort „Bielefeld“ das Wort „Braunschweig“ bilden könnte. Wir konnten es nicht. Folglich blieb uns nichts anderes übrig, als uns so weit wie möglich von diesen Hünen mit ihren Jeansjacken und den Aufnähern mit nackten Frauen zu entfernen. Zuhause hatten meine Eltern eine Langspielplatte von Franz Josef Degenhardt. Die hieß: „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.“ Das hier waren Schmuddelkinder. Und sie wollten mit uns spielen. In den folgenden Stunden achteten wir vor allem auf unsere Stehplatznachbarn, die komische Lieder von „brennenden Reichsbahnen“ sangen und lauthals einen kollektiven Besuch eines einschlägigen Etablissements in Barcelona ankündigten. Erfreulicherweise schienen die Arminen-Spieler von unserer Gefahrensituation unterrichtet worden zu sein, auf jeden Fall weigerten sie sich standhaft, den Strafraum des Gegners aufzusuchen. Und da die Braunschweiger offensichtlich Angst hatten, bei einem Torversuch ihrerseits von den Bielefelder Fans mit Schuhen beworfen zu werden, stand es nach 90 trostlosen Minuten 0:0.
Als uns die Eltern des Geburtstagskindes abholten und fragten: „Na wie war’s?“, antworteten wir ebenso bleich wie glücklich, mit dem Leben davongekommen zu sein: „Super!“ Das war natürlich gelogen. Und diese Lüge, dieses coole Mackertum und das Nicht-Eingestehen-Wollen von Angst und Schwäche hat sich bitter gerächt. Den größten Speianfall meines Lebens bekam ich an jenem Tag, als ich Knäckebrot mit Teewurst und einer remouladenartigen Soße aß und meine Mutter fragte, was das denn Leckeres sei. Doch sie antwortete nur: „Das ist Braunschweiger mit …“ Den Rest bekam ich nicht mehr mit, dafür aber der Küchenfußboden. Noch heute, wenn mich meine Frau nach einem Alptraum weckt, beruhigt sie mich mit den Worten: „Ruhig, Andreas, die Braunschweiger sind nicht einmarschiert.“
Keine Frage: So konnte es nicht weitergehen. Ich musste etwas tun. Irgendetwas Psychologisches. Und wie alle Väter kam ich zu dem Schluss, dass es das Beste sei, wenn ich meine Träume und Alpträume auf meinen Sohn übertrage.
Als der drei Jahre alt war, versuchte ich ihm behutsam die elementaren Dinge des Fußballspiels zu vermitteln. Irgendwas musste ich dabei falsch gemacht haben. Denn immer, wenn er damals eine Fußballpartie im Fernsehen verfolgte, brüllte er „Foul“, wenn der Reporter „Foul“ rief, und riss danach jubelnd die Arme hoch. Fiel aber irgendwo ein Tor, interessierte ihn das so sehr wie der abendliche Zahnputz-Appell.
Aber vielleicht ist dieses Verhalten ja keineswegs so absonderlich. Schließlich scheint der Fußball die Fantasie anzuregen, wie ein Blick in die Bekenntnisliteratur von Toni Schumacher über Lothar Matthäus bis hin zu Bodo Illgner nahelegt. Um meinen Sohn nun mit dem wirklichen Fußballleben in Kontakt zu bringen, köderte ich ihn mit der Aussicht auf Pommes und Crepes, und tatsächlich wollte er im Alter von fünf Jahren sein erstes Arminia-Spiel im Stadion sehen.
Seine erste Saison war die schlechteste Saison Arminias aller Zeiten. Und das will bei der Vereinsgeschichte wahrlich etwas heißen. Was tat ich ihm da an? Welche pädagogisch wertvollen Erkenntnisse konnte der Besuch eines Spiels von Arminia Bielefeld in den Jahren 2010 und 2011 liefern? Immerhin handelt es sich um einen Verein, der fast pleite gegangen ist und dann nicht etwa, wie bei anderen Vereinen üblich, von Fanspenden oder reichen Gönnern gerettet wird, sondern von geliehenem Geld eines Freundes eines Sponsors, der zugleich öffentlich betont, dass Arminia ihm vollkommen egal ist und er nur seinem alten Unternehmerkumpel einen Gefallen getan hat und er auch schon gleich mehrere erboste Anrufe von anderen Unternehmerkumpeln erhalten hätte, die ihn davor gewarnt hätten, Geld in dieses Fass ohne Boden zu investieren. Wir sprechen von einem Verein, der vor seinen Heimspielen eine sogenannte Fan-Hymne durch die Stadionboxen jagt, in der ein Schlagerbarde in Art der Hans-Hartz-Taubenbeschwörung ohne jeden Anflug von Ironie Textzeilen hinauspresst, die in der Aussage kulminieren: „Arminia, Arminia, wir sind die besten Fans der Welt.“
Jetzt habe ich den Salat. Seit dem ersten Stadionbesuch ist mein Sohn begeisterter Arminia-Fan. Die Arminia-Hymne ertönt täglich aus dem Kinderzimmer, er singt auch andere Lieder, die sich darum drehen, dass Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken, und er fragt vorm Schlafengehen, wie dieser Spruch mit Schalke 04 und dem Klopapier noch mal ginge.
Ich könnte mich jetzt damit herausreden, dass ihn seine Arminia-Besuche mit einer wichtigen Erkenntnis aus der Schule des Lebens versorgen würden: Dass man auch das Verlieren lernen muss. Das Problem nur ist, dass ihn der Fußballsport an sich überhaupt nicht interessiert. Er mag die Lieder der Fans, die Pommes mit Mayo, die Crêpes mit Schokoladencreme, die großen Stadionanzeigentafeln und wenn der Schiedsrichter Gelbe Karten verteilt. Vielleicht sollte ich mir mal an ihm ein Beispiel nehmen nicht nur, wenn Arminia mal wieder gegen Braunschweig spielt.