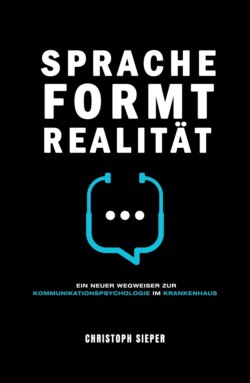Читать книгу Sprache formt Realität - Christoph Sieper - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 www.konflikte.de
„Um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
Warum empfindet man inneren Widerstand bei Formulierungen, die Zwang implizieren? Woher kommt das und welche weiteren Implikationen ergeben sich daraus für den Umgang mit Patienten und Angehörigen? In diesem Kapitel werden die psychologischen Prozesse erläutert, die dazu führen, dass Patienten allergisch darauf reagieren, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Darüber hinaus wird deutlich, welche Rolle die Selbstbestimmung von Patienten, sowohl bei Vermeidung als auch bei der Bearbeitung von Konflikten, spielt.
4.1 Let`s get ready to Rumble! – Patient versus Mediziner
Für Patienten ist ein Krankenhausaufenthalt eine Ausnahmesituation. Sie werden aus ihrem Alltag herausgerissen und kommen aufgrund gesundheitlicher Beschwerden als hilfsbedürftiger Mensch in eine für sie ungewohnte Umgebung. Losgelöst von der Krankheit stellt sich die Frage, mit welchen weiteren Gefühlen und Empfindungen sie während eines Klinikaufenthaltes zu kämpfen haben?
Patienten (und auch ihre Angehörigen) sind häufig ängstlich, verunsichert und hilflos. Darüber hinaus fühlen sie sich alleingelassen, entmündigt und ausgeliefert.24 Bei der Suche nach einem Überbegriff bzw. Synonym für diese Gefühlszustände kann man sagen, dass sie sich klein fühlen. Die Gründe für dieses Gefühl der Unterlegenheit sind vielfältig. Die Beziehung zwischen Medizinern und Patienten ist in vielerlei Hinsicht asymmetrisch:
1. Patienten betreten in einem Krankenhaus unbekanntes Terrain. Mediziner hingegen sind sowohl mit den Abläufen als auch den räumlichen Gegebenheiten bestens vertraut. Sie wissen in der Regel, welche Untersuchungen wann, wie und aus welchen Gründen durchgeführt werden. Es existiert ein Informationsdefizit auf Seiten des Patienten.25 Er weiß in der Regel nicht, was im Einzelnen auf ihn zukommt.
2. Mediziner sind Experten auf ihrem Gebiet. Sie verfügen über eine Expertise, die den meisten Patienten vorenthalten bleibt. Sie haben Fachwissen und kennen die Bedeutung unzähliger Fachbegriffe.
3. Für Patienten ist ihre Erkrankung von hoher subjektiver Relevanz, je nachdem sogar von existentieller Bedrohung. Für Mediziner handelt es sich hingegen zumeist um berufliche Routine.
4. Mediziner haben ein Heimspiel. Sie bestimmen die Regeln in ihrem Haus. Patienten hingegen befinden sich in einer für sie ungewohnten Umgebung mit ganz eigenen, unbekannten und häufig nicht nachvollziehbaren Regeln. Sie sind als Gast bei einem Auswärtsspiel und dazu angehalten, sich diesen Regeln unterzuordnen.
5. Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis – der Patient benötigt die Hilfe des Mediziners. Menschen, die ihr Leben in der Regel selbstständig meistern, geraten in eine Situation, in der sie plötzlich stark abhängig von Fachexperten sind. Selbst einfachste Verrichtungen wie Essen, Trinken oder der Gang zur Toilette können teilweise kaum noch autonom oder gar nicht mehr alleine durchgeführt werden.
6. In der Regel sind die Angestellten einer Klinik in großer Anzahl vertreten, wohingegen Patienten (zumindest außerhalb der Besuchszeiten) alleine sind.
7. Außerdem trägt das Klinikpersonal zumeist eine „Uniform“ in Form eines Kasacks bzw. Kittels.
Aufgrund dieses Ungleichgewichts in Bezug auf Wissen, Betroffenheit, Rolle und Verletzlichkeit besteht eine Machtasymmetrie zwischen Medizinern und Patienten. Hierdurch ergibt sich folgendes Problem: Wenn wir mit anderen Menschen interagieren, möchten wir das immer auf „Augenhöhe“ tun. In dem Schaubild auf der vorherigen Seite wird jedoch deutlich, dass Patienten sich nicht auf Augenhöhe mit Medizinern befinden. Aus diesem Grund ist auch ein Satz wie „Sie dürfen jetzt zum Röntgen“ als Alternative zu „Sie müssen zum Röntgen“ eher ungeeignet. Diese Formulierung suggeriert, dass wir unser Einverständnis dazu geben, dass der Patient etwas Bestimmtes tun darf. Folglich wird das Ungleichgewicht durch diese Aussage zusätzlich untermauert. Insofern verwundert es kaum, wenn eine Reaktion auf diesen gut gemeinten Satz lediglich in einer flapsigen Bemerkung resultiert: „Das ist aber nett von Ihnen, dass ich das darf.“
Doch was kann der „Kleine“ (Patient) tun, um mit dem anderen (Mediziner) auf Augenhöhe zu gelangen? Was könnte man in die Abbildung einzeichnen, um dieses Ungleichgewicht wieder aufzuheben? Ein Fünfjähriger weiß die Antwort sofort: Er stellt sich auf eine Kiste:
4.2 Statuskisten – „Ich bin aber Privatpatient!“
Haben Sie schon einmal mit Menschen zu tun gehabt, die sich größer machen als sie sind?
Typische Beispiele hierfür lauten:
- „Ich bin übrigens Privatpatient.“
Eine lustige, wenn auch wenig konstruktive Antwort lautet:
„Macht ja nichts, wir helfen Ihnen trotzdem gerne!“
- „Ich kenne Ihren Chef.“
Antwort: „Ich auch. Wahrscheinlich sogar besser als Sie.“
Es handelt sich bei der eingezeichneten Kiste um eine sog. Statuskiste. Weitere Beispiele für Statuskisten lauten:
- „Mein Bruder ist übrigens Rechtsanwalt.“
- „Mein Schwager arbeitet bei der Zeitung.“
- „Sprechen Sie mich gefälligst mit Doktortitel an.
Ich habe promoviert!“
- „Letztes Jahr war ich auf einer Reha in Sylt. Ich weiß, was man in der Pflege leisten kann, wenn man sich ein bisschen anstrengen würde.“
- „Sie wissen aber schon, dass ich Ehrenbürger der Stadt bin?!“
Ob persönliche Beziehungen, Statussymbole (Autos, teurer Schmuck etc.) oder der Bildungshintergrund – Menschen (die sich klein fühlen) benutzen diese vermeintlichen Argumente, um sich bildlich gesprochen größer zu machen. In diesem Kontext wird insbesondere der Umgang mit Privatpatienten häufig als schwierig empfunden. Privatpatienten seien extrem anspruchsvoll und nur schwer zugänglich. An dieser Stelle folgt ein kurzer Exkurs zu dem Verhalten von Privatpatienten, wobei gesetzlich versicherte Patienten sicherlich mindestens genauso „schwierig “26 sein können.
Das Verhalten von Privatpatienten, was manchmal etwas abstrus oder sonderbar erscheinen mag, hat in der Regel nichts mit der Versicherungsform zu tun. Stattdessen ist der Blick auf einen anderen Umstand lohnenswert. Sehr viele (nicht alle) Privatpatienten sind Freiberufler. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Menschen in einer Festanstellung und einem Freiberufler? Freiberufler haben in der Regel keinen Vorgesetzten. Daraus resultiert deutlich mehr Selbstbestimmung im Berufsleben. Ich selbst bin ebenfalls Freiberufler und somit mein eigener Chef. Wenn mein Wecker an einem seminarfreien Montagmorgen um sieben Uhr klingelt und ich keinen Drang zum Aufstehen verspüre, besteht für mich durchaus die Möglichkeit, den Wecker einfach auszuschalten und mich noch einmal umzudrehen. Im Anschluss stehe ich mit folgender Überlegung auf: „Was mache ich denn heute so?“ Ich könnte ein neues Buch zum Thema Konfliktpsychologie lesen. In diesem Fall koche ich mir eine Tasse Kaffee, setze mich auf die Couch und lese anschließend den ganzen Tag dieses Buch. Auf Dauer ist dieses Szenario sicherlich mit finanziellen Konsequenzen verbunden, aber theoretisch kann ich es genau so, also vollkommen selbstbestimmt, machen. Bei Menschen in einer Festanstellung sieht der gleiche Montagmorgen vollkommen anders aus. Normalerweise gibt es eine klare Vorgabe hinsichtlich des Dienstbeginns (bei Gleitzeit etwas flexibler), ein eng definiertes Aufgabenfeld und zudem einen Vorgesetzten, der weisungsbefugt ist und vorgeben kann, in welcher Reihenfolge man seine Aufgaben zu erledigen hat. In diesem Fall ist der Grad der Selbstbestimmung deutlich geringer. Bei Betrachtung der Abbildung auf Seite 52 wird jedoch deutlich, dass Menschen infantilisiert werden, sobald sie in ein Krankenhaus kommen. Plötzlich heißt es dann: „Um sechs Uhr wird aufgestanden, um sieben Uhr gibt es Frühstück, danach kommt der Arzt zur Visite und um elf müssen Sie zum Röntgen!“ Patienten geben ihre Selbstbestimmung am Eingang ab bzw. bekommen diese fast vollständig „weggenommen“. Die Anpassung an diese Situation ist insbesondere für Menschen schwierig, die von Berufswegen her mehr Selbstbestimmung gewohnt sind.
Ein Trainerkollege hat mir in diesem Zusammenhang einen interessanten Denkanstoß gegeben. Er erzählte davon, vor einigen Jahren für ein Bundeswehrkrankenhaus tätig gewesen zu sein. Eine große Besonderheit in diesem Krankenhaus bestand darin, dass alle Patienten den Status als Privatpatient innehatten. Dennoch berichteten die Angestellten dieses Krankenhauses, es gäbe bestimmte Patienten, die Statuskisten deutlich öfter „benutzten“ als andere. Ich stellte mir sofort die Frage, wer das bei der Armee gewesen sein mochte. Vor dem Hintergrund der Selbstbestimmung konnte ich mir die Frage selbst beantworten. Die Antwort lag auf der Hand: die ranghöheren Offiziere. Lassen Sie doch einmal Ihrer Phantasie freien Lauf. Was würde passieren, wenn wir einem altgedienten General vorgeben, wann er morgens Frühstuck zu essen hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde er uns den Vogel zeigen. Diese Vermutung wurde von den Pflegekräften vor Ort bestätigt. Patienten, die in der Befehlskette weiter unten stehen (rangniedrigere Offiziere), konnten sich relativ schnell an die Ausnahmesituation im Krankenhaus gewöhnen. Patienten mit höherem Dienstgrad und somit deutlich mehr Selbstbestimmung taten sich damit hingegen sehr viel schwerer. Es handelt sich hierbei nicht um einen ganzheitlichen, aber dennoch interessanten und nachvollziehbaren Erklärungsansatz.
Das Gefühl des Kontrollverlusts plagt viele Patienten und Angehörige, losgelöst von ihrem Versicherungsstatus. Der Verlust von einmal besessenen Freiheiten ist etwas, womit sich Menschen nur schwer arrangieren können. Der Psychologe Jack Brehm geht bei seinem Erklärungsansatz zu den menschlichen Reaktionen auf die Einengung ihrer persönlichen Kontrollmöglichkeiten sogar davon aus, dass das Bedürfnis nach Erhaltung unserer Freiheiten verstärkt wird, wenn zuvor eine Einschränkung oder Gefährdung unserer Wahlfreiheit stattgefunden hat.27 Dieses Kernelement der sog. Reaktanztheorie hat im Krankenhauskontext eine ganz besondere Brisanz.
4.2.1 Spielzeug und Waschpulver: Der Romeo & Julia-Effekt
Mithilfe einer Vielzahl von Studien kann ein breites Spektrum von Verhalten als Ausdruck von Reaktanz erklärt werden. Viele Eltern erleben ihre Kinder im dritten Lebensjahr als besonders widerspenstig; gibt man ihnen ein Spielzeug, wollen sie garantiert ein anderes; nimmt man sie auf den Arm, wollen sie wieder runtergelassen werden usw.
Bei einem Experiment in den 70er Jahren wurden zweijährige Kinder in einen Raum mit zwei Spielzeugen gebracht. Das Spielzeug war so angeordnet, dass ein Spielzeug neben einer durchsichtigen Barriere aus Plexiglas stand und das andere jeweils dahinter. Bei einigen Kindern stellte die Scheibe kein Hindernis dar, da sie lediglich 30 Zentimeter hoch war und die Kinder problemlos darüber greifen konnten. Bei den anderen Kindern war sie hingegen 60 Zentimeter hoch und somit unüberwindbar. Sie kamen folglich nur an das Spielzeug, wenn sie um das Plexiglas herumgingen. Ziel des Experiments war es zu beobachten, wie schnell die Kinder Kontakt zu dem Spielzeug aufnahmen. Die Ergebnisse hierzu waren eindeutig und im Einklang zur Reaktanztheorie.
Wenn das Plexiglas zu niedrig war, um den Zugang zu dem dahinterliegenden Spielzeug zu versperren, zeigten die Kinder keine Präferenz für ein bestimmtes Spielzeug. Bei der hohen Barriere, also einem echten Hindernis, entschieden sich die Kinder hingegen viel eher für das weniger leicht erreichbare Spielzeug. Sie berührten es dreimal schneller als das leicht erreichbare.28 Die Kinder reagierten damit so, wie Zweijährige eben auf eine Beschränkung ihrer Freiheit reagieren: mit Trotz!
Kinderpsychologen erklären dieses Phänomen dadurch, dass Kinder in diesem Alter anfangen, sich als Individuum zu betrachten. Sie fangen an, sich als einzigartiges und eigenständiges Wesen zu begreifen. Dieses sich entwickelnde Autonomiekonzept19 führt zu einem anderen Konzept, nämlich dem der Freiheit. Ein unabhängiges Wesen kann eigene Entscheidungen treffen und will seine Optionen kennenlernen.
Die Tendenz, Beschränkungen der eigenen Freiheit anzugehen, bleibt das ganze Leben lang bestehen und findet in allen Bereichen unserer sozialen Umgebung weitere Beispiele für seine Geltung, sogar in der einschlägigen Weltliteratur. Romeo und Julia begehen in Shakespeares Drama als Reaktion auf die Versuche ihrer Eltern, sie voneinander fernzuhalten, einen tragischen Doppelsuizid. So demonstrieren sie ihren freien Willen, für alle Zeit vereint zu sein. Entgegen einem Romantiker würden Sozialwissenschaftler dieses Verhalten nicht mit der unendlichen Liebe, die beide füreinander empfinden, erklären, sondern stattdessen auf die Rolle der elterlichen Störmanöver und die dadurch hervorgerufene Reaktanz verweisen. Interessanterweise untermauern Studien mit tatsächlich verliebten Teenager-Paaren genau diesen Effekt. Hier zeigte sich, dass die kritische Einmischung der Eltern in die Beziehung dazu führte, dass die Paare stärker füreinander empfanden und der Wunsch zu heiraten stärker war. Die Zunahme der Einmischungsversuche intensivierte die Liebe des Paares.30
Losgelöst von Kleinkindern und Teenagern in der Pubertät lässt sich Reaktanz in nahezu allen Lebensbereichen beobachten. Das Verbot von phosphathaltigem Waschmittel in der Großstadt Miami in den USA führte dazu, dass mehr Phosphatmittel in den Nachbarregionen der Stadt gekauft wurde. Darüber hinaus hielten die Bürger von Miami phosphathaltige Waschpulver plötzlich sogar für bessere Produkte als zuvor.31 Diese Reaktion ist typisch für Personen, die eine vorherige Freiheit eingebüßt haben. Die Corona-Krise führte 2020 unter anderem zu einem Kontaktverbot, der Absage von Konzerten und Sportveranstaltungen sowie der Schließung von Museen, Restaurants und Schulen. Neben einer Vielzahl weiterer Einflussfaktoren war der Umgang mit diesen Verboten und Einschränkungen mitunter auch deshalb für viele Menschen so schwierig, da diese Situation eine starke Form von Reaktanz ausgelöst hat. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Krise noch nicht überwunden, jedoch kann vermutet werden, dass wir alle zu einem hoffentlich nicht zu weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt mit einer noch nie dagewesenen Freude das erste Konzert, die erste Reise oder das erste Fußballspiel besuchen werden – da wir eine uns abhanden gekommene Freiheit zurückerlangen.32
Doch welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen Ausführungen und dem Umgang mit Patienten in einem Krankenhaus?
4.2.2 Die „Qual“ der Wahl – Das Prinzip der Mitwirkung
„Die Würde des Menschen besteht in der Wahl.“
(Max Frisch)
Wir neigen nachgewiesenermaßen dazu, mit Trotz und Gegenwehr zu reagieren, wenn uns eine einmal gewonnene Freiheit wieder weggenommen wird. Genau das lässt sich in vielen Situationen im Krankenhausalltag beobachten. Mündige, erwachsene Menschen erhalten plötzlich Anordnungen, wann sie was, wie und wo genau zu tun haben. Die Besuchs-, Schlaf- und Essenszeiten sind vorgegeben, sie müssen zu Untersuchungen kommen und sich auf Anweisung sogar ausziehen. Das führt zu einem subjektiv empfundenen Ungleichgewicht und einem damit (stärker als sonst) einhergehenden Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung. Mithilfe der richtigen Wortwahl bzw. durch einen einfachen Trick kann es jedoch gelingen, dieses Ungleichgewicht (der „Kleine“ versus der „Große“) ein Stück weit aufzuheben und dem anderen das Gefühl zu vermitteln, sich auf Augenhöhe zu befinden. „Menschen sind eher geneigt, eine Entscheidung zu akzeptieren und stärker motiviert, sie auszuführen, wenn sie am Entscheidungsprozess mitgewirkt haben.“33 Für Prozesse, die wir aktiv mitgestalten, übernehmen wir ganz anders Verantwortung und engagieren uns mehr, als wenn wir uns selbst nur als Ausführenden erleben. Wir wollen selbst entscheiden, was wir wie machen möchten. Dieses Prinzip der Mitwirkung können Sie mithilfe einer einfachen Kommunikationstechnik bestärken. Betonen Sie Patienten und Angehörigen gegenüber nach Möglichkeit immer wieder, dass sie stets die freie Wahl haben:
„Es ist IHRE Entscheidung, ob wir das so machen oder nicht.“
„Wenn SIE möchten, dann …“
„Ist es für SIE in Ordnung, dass jetzt …“
Wir können möglichen Widerstand dadurch vermeiden, dass wir unserem Gesprächspartner seine Entscheidungsfreiheit bzw. Selbstbestimmung vor Augen führen. Mithilfe dieser Sätze verdeutlichen wir dem anderen, dass er die Zügel selbst in der Hand hat und frei bestimmen kann. Jeder Mensch möchte schließlich sein eigenes Schicksal lenken können. Zwang durch andere erzeugt hingegen Ressentiment und Widerstand.
Dieser Ansatz hat dahingehend seine Grenzen, als dass das Prinzip der Förderung zur Selbstbestimmung nicht das Prinzip der Fürsorge außer Kraft setzen darf. Wie bereits beschrieben, ist die Beziehung zwischen Patienten und Medizinern durch Abhängigkeit und ein asymmetrisches Informationsverhältnis geprägt. Patienten sind aufgrund ihrer Erkrankung auf professionelle Hilfe und Expertenwissen angewiesen. Eine vollständig unabhängige Entscheidung im Sinne eines souveränen Patienten ist dementsprechend beispielsweise bei der Wahl der richtigen Behandlungsmethode nicht immer möglich. Es ist sicherlich wenig zielführend, einen Patienten mit akuten Herzbeschwerden nach seinen Behandlungsansichten zu befragen. Wenn es allerdings um Alternativen geht, die als gleich vielversprechend gelten, kann die Entscheidung durchaus bei demjenigen liegen, der es auch auszubaden hat. Hier stellt sich vielmehr die Frage, ob der Patient tatsächlich so kundig und informiert ist, dass er entscheiden kann und auch möchte. Denn nur wer die möglichen Behandlungsalternativen versteht, kann auch wirklich mitentscheiden (siehe Kapitel 9).
Bei unserem Röntgenbeispiel ist eine Wahlmöglichkeit wenig sinnvoll, da keine besteht. In diesem Fall ist, wie bereits beschrieben, eine höfliche und dennoch klare Aufforderung zum Mitkommen das bessere Mittel der Wahl („Bitte kommen Sie jetzt mit zum Röntgen, dann sind Sie für heute bereits fertig“). Es existiert jedoch eine Vielzahl von Situationen, in denen das Prinzip der Mitwirkung gut eingesetzt werden kann. Hierdurch lassen sich unnötige Konflikte und Diskussionen vermeiden. Ein Beispiel aus dem vorherigen Kapitel veranschaulicht die Wirkungsweise des Kontrollgewinns durch Selbstbestimmung. Erinnern Sie sich an die Sekretärin mit ihrer Aussage:
„Sie müssen noch einen Moment Platz nehmen.“
Lassen Sie die nachfolgende Aussage zunächst auf sich wirken:
„Wenn SIE möchten, können Sie noch einen Moment Platz nehmen.“
In diesem Fall lässt sie mir die freie Wahl zum Platznehmen. Es ist stark zu bezweifeln, dass ich aufgrund dieser Aussage ein Problem damit gehabt hätte, mich für ein paar Minuten hinzusetzen. Ich kann selbst entscheiden und fühle mich nicht in meiner Autonomie beschnitten. Hier noch zwei weitere Beispiele zur Vermeidung unnötiger Diskussionen. Entscheiden Sie selbst, welche Formulierung besser ist:
| Variante 1: | „Die Hälfte müssen Sie zahlen.“ |
| Variante 2: | „Die Kasse zahlt die Hälfte, die andere Hälfte wird vom Patienten getragen. Sie entscheiden, ob Sie das machen möchten oder nicht.“ |
Beim Blutabnehmen können Sie Patienten ebenfalls die Möglichkeit zur Mitgestaltung einräumen:
„Möchten Sie sitzen oder liegen?“
Ist Ihnen dabei der rechte oder der linke Arm lieber?“
Zur weiteren Verdeutlichung dieses Prinzips möchte ich Sie zu folgendem Gedankenexperiment einladen:
Szenario 1
Sie kommen als Angehöriger zur Mittagszeit auf die Station, um ihre Mutter zu besuchen. Beim Betreten des Zimmers stellen Sie fest, dass Ihre Mutter beim Trinken das Kopfkissen bekleckert hat, weil ihr niemand den Umgang mit der Schnabeltasse gezeigt hat. Infolgedessen begeben Sie sich auf die Suche nach einer Pflegekraft um sich zu beschweren. Da Sie jedoch auf Anhieb niemanden finden können, gehen Sie zum Schwesternzimmer. Dort erzählen Sie, das Kopfkissen Ihrer Mutter sei nass und ein frischer Bezug dringend erforderlich. Daraufhin erklärt Ihnen eine der Pflegekräfte, dass derzeit die Übergabe stattfinde. Diese dauere noch 40 Minuten. Anschließend werde man sich umgehend um den Bezug des Kopfkissens kümmern. Da Ihnen 40 Minuten zu lang erscheinen, fragen Sie die Pflegekraft, ob Sie einfach selbst die Bezüge austauschen könnten. Dies wird allerdings vehement verneint, da der Wechsel der Kopfkissenbezüge schließlich eine Aufgabe der Pflege und nicht Aufgabe der Angehörigen sei. Sie bleiben jedoch hartnäckig und fragen erneut nach. Wenn man Ihnen kurz zeigen würde, wo sich frische Bezüge befänden, stelle dies kein Problem dar. Man könne „die Kirche ruhig im Dorf lassen“. Schließlich sei der Vorgang dann erledigt und alle hätten ihre Ruhe.
Szenario 2
Die Situation ist zunächst einmal identisch. Sie kommen zur Mittagszeit als Angehöriger auf die Station, um ihre Mutter zu besuchen. Beim Betreten des Zimmers stellen Sie fest, dass ihre Mutter beim Trinken das Kopfkissen bekleckert hat, weil ihr niemand den Umgang mit der Schnabeltasse gezeigt hat. Infolgedessen begeben Sie sich auf die Suche nach einer Pflegekraft um sich zu beschweren. Da Sie jedoch auf Anhieb niemanden finden können, gehen Sie zum Schwesternzimmer. Dort erklären Sie, das Kopfkissen Ihrer Mutter sei nass und ein frischer Bezug dringend erforderlich. Daraufhin erklärt Ihnen eine der Pflegekräfte, dass derzeit die Übergabe stattfinde. Diese dauere noch 40 Minuten. Unvermittelt schlägt sie daher vor:
„Wissen Sie was, beziehen Sie das Bett doch am besten eben selbst!
Da hinten rechts im Schrank sind die Bezüge.“
Wie würden Sie in dieser Situation reagieren?
Wahrscheinlich geht Ihnen gerade genau das Gleiche durch den Kopf wie den meisten anderen auch?! Die Antwort der Pflegekraft in Szenario zwei ist eine absolute Frechheit und zieht mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Streit über die Zuständigkeiten in dem Krankenhaus nach sich. Doch worin besteht der Unterschied zu Szenario eins? In dem ersten Beispiel kommt die Idee, das Kopfkissen selbst zu wechseln, nicht von der Pflegekraft, sondern von dem Angehörigen. Dieser Vorschlag ist leichter annehmbar, da man nicht fremdbestimmt wird. Hier wird der Effekt deutlich, wenn wir frei entscheiden können was wir tun – das Prinzip der Mitwirkung.
In den meisten Fällen kommen Patienten und Angehörige jedoch nicht von selbst auf eine derartige Idee. Es besteht dennoch die Möglichkeit, mithilfe einer gezielten Frage diesen Denkprozess anzukurbeln und das Gefühl zu vermitteln, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Es empfiehlt sich bei Konflikten, Beschwerden und anderen schwierigen Situationen immer, zunächst den Gesprächspartner zu fragen, wie er sich eine Lösung vorstellt („Es tut mir leid. Was können wir denn jetzt tun?“ – siehe Kapitel 13). Wenn eine gut umsetzbare Idee als Antwort kommt, können wir diese aufgreifen. Das Gegenüber nimmt einen eigenen Lösungsvorschlag deutlich besser an, als wenn die gleiche Idee von einem Dritten kommt. Den Beteiligten nach einer Lösung zu fragen und mit einzubeziehen, klappt oft viel besser als man denkt.
Sozialwissenschaftler und Psychologen wissen bereits seit langem um die Vorteile der Mitbestimmung. Menschen hören auf, sich gegenüber einer vernünftigen Verfahrensweise passiv und abwehrend zu verhalten, wenn sie an der Festlegung dieser Verfahrensweise mitgewirkt haben.34 Diese Teilnahme an Entscheidungsprozessen hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Beziehung zwischen Patienten und Medizinern.35 Patienten möchten die Verantwortung für ihr Leben und die Behandlung mitübernehmen. Mediziner, die diese Einstellung unterstützen, können Patienten dadurch helfen, schneller gesund zu werden. Das Prinzip der Mitwirkung bzw. Selbstbestimmung lässt sich gut mit der Technik der Begründungen kombinieren (siehe Kapitel 3.3). Insbesondere dann, wenn es darum geht, Patienten von etwas zu überzeugen. Bei der Einnahme eines Medikamentes kann man beispielsweise wie folgt vorgehen:
„Herr Fröhlich, Sie haben mehrere Möglichkeiten: Variante 1 besteht darin, dass Sie das Medikament regelmäßig nach dem Abendessen einnehmen. Es lindert die Schmerzen und Sie können wahrscheinlich etwas ruhiger schlafen. (Begründung als Geschenk) Variante 2 besteht darin, dass Sie auf das Medikament verzichten. In diesem Fall kann es allerdings sein, dass die Schmerzen Ihren Schlaf beeinträchtigen. Unter Umständen verlängert sich dadurch der Heilungsprozess. (Nachteil des Verhaltens transparent kommunizieren) SIE bestimmen, welche Variante es sein soll.“ (Selbstbestimmung)
Sie nennen die Alternativen mit ihrem jeweiligen Vor- bzw. Nachteil und betonen, dass die Entscheidung bei Ihrem Gegenüber liegt (ggf. geben Sie vorher eine persönliche Empfehlung ab). Es erscheint plausibel, dass die meisten Patienten die erste Variante bevorzugen werden.
Diese Gesprächstechnik lässt sich auch auf den Umgang mit Schülern, Kollegen und die eigenen Kinder übertragen. Wenn Kinder beispielsweise bei der Festlegung von Regeln und Grenzen ein Mitspracherecht erhalten, sind sie eher bereit, sich daran zu halten, als wenn die Regeln von den Eltern alleine kommen.36 Unser Sohn befindet sich derzeit in der bereits beschriebenen Autonomiephase. Er ist vor kurzem drei Jahre alt geworden und daher noch nicht in der Lage, Regeln mit uns auf Dauer zu vereinbaren. Dennoch können meine Frau und ich auch in diesem Entwicklungsstadium unseres Sohnes mithilfe des Prinzips der Mitwirkung einige schwierige Situationen vermeiden. Ein im Rahmen dieser Altersstufe immer wieder auftretendes Problem besteht im Zähneputzen vor dem Schlafengehen. Hierfür hat meine Frau eine, wie ich finde, sehr clevere Strategie entwickelt. Nach unzähligen Diskussionen geht sie mittlerweile nur noch mit der bereits vorbereiteten Zahnbürste zu unserem Sohn und sagt sinngemäß:
„Die Zahnbürste ist fertig.
Entweder putzt du selbst die Zähne
oder Papa übernimmt das. Du bestimmst!“
Es war zu Beginn überaus verblüffend, dass diese Form der Kommunikation so gut funktionierte. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings klar, welche Wirkungsmechanismen hier greifen. Meine Frau lässt unserem Sohn in einem gewissen Rahmen selbst bestimmen, d.h. Mitwirkung zur Vermeidung von Reaktanz. Gleichzeitig gibt sie Moritz lediglich zwei Möglichkeiten vor (selbst putzen oder Papa). Auf diese Weise kommt es nur noch sehr selten zu einer Debatte darüber, ob das Ausfallen des Zähneputzens überhaupt eine weitere Option darstellt.
Im Umgang mit Patienten kann dieses Prinzip auf sehr subtile Weise vermittelt werden, um Passivität und Widerstand im Verhalten abzubauen. Eine Pflegekraft, die dafür verantwortlich ist, dass ein Patient regelmäßig einen Spaziergang macht, kann fragen, was er bei diesen Spaziergängen am liebsten anziehen möchte – Hausschuhe oder feste Schuhe, einen Schlafanzug oder einen Bademantel. Wo und zu welcher Zeit würde er gerne spazieren gehen? Wie sehr möchte er gestützt werden?
Menschen im Endstadium einer Krankheit neigen tendenziell zu Überabhängigkeit. Das lässt sich merklich reduzieren, wenn sie an den vielen, täglich zu treffenden Entscheidungen mitwirken können, die bei der Pflege in solchen Situationen anfallen.37 In diesem begrenzten Rahmen können sie dazu ermutigt werden, mitzubestimmen, was sie essen wollen, wann sie Besuch haben möchten oder wann sie gerne ins Bett gehen.
Praxistransfer
Selbstbestimmung statt Kontrollverlust
Status und Aggression sind Ausdruck von Hilflosigkeit und dem Gefühl des Kontrollverlustes.
Geben Sie Ihrem Gegenüber die Kontrolle zurück, indem Sie ihn nach Möglichkeit in Entscheidungsprozesse einbeziehen bzw. eine Wahl lassen.
„Wäre es für Sie in Ordnung, wenn …“
„Wenn Sie möchten, dann … “
„Ich kann Ihnen folgendes anbieten: … Es ist Ihre Entscheiduns.“
4.3 Aggression
„Unsre Lanzen sind nur Stroh, gleich schwach wir selbst, schwach wie ein hilflos Kind.“
(William Shakespeare)
Im Krankenhaus kommt es auch immer wieder zu Begegnungen mit Patienten und Angehörigen, die keine Statuskisten haben. Sie sind kein Privatpatient, fahren weder einen Porsche, noch sind sie der Golfpartner von dem Geschäftsführer des Klinikums. Bezogen auf unser Schaubild von Seite 52 ergibt sich die Frage, was Menschen in diesen Fällen tun, um mit ihrem Gesprächspartner auf Augenhöhe zu kommen? Was ist die Alternative dazu, wenn ich mich selbst nicht größer machen kann?
Ich mache den Anderen kleiner! Hier werden Menschen laut und aggressiv. Sie sprechen dem Anderen seine Kompetenz ab. Der sprichwörtliche Hammer38 wird ausgepackt. Dieser Hammer steht sinnbildlich für Aggression.
- „Das ist echt typisch blond!“
- „Du junger Hüpfer hast doch sowieso keine Ahnung!“
- „Von Ihnen kann man eh nicht allzu viel erwarten!“
Bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass Status und Aggression ausschließlich von dem Kleinen „verwendet“ werden. Mediziner kommunizieren auf Augenhöhe. Patienten und Angehörige hingegen empfinden sich gegenüber dem Klinikpersonal als klein und unterlegen. Dieses Gefühl der Unterlegenheit bezieht sich nicht auf Mediziner als Privatpersonen, sondern auf sie als Repräsentanten der Institution Krankenhaus. Wenn wir diesen Gedankengang fortsetzen, erkennt man, dass Status und Aggression immer Ausdruck der Sorge um das eigene Defizit sind (siehe Kapitel 4.1).
4.3.1 Von Strebern und Bonzen
Vergleichbare Szenarien begegnen uns bereits in der Schule. Ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen in der Schule einen Klassenkameraden hatte, der immer die besten Noten geschrieben hat? (Es sei denn, Sie sind das selbst gewesen.) Wie haben Sie diesen Klassenkameraden genannt? Den meisten von uns kommt direkt der Begriff des Strebers in den Sinn. Auch hier wird ein Hammer verwendet, indem der Andere mit dem negativ behafteten Begriff des Strebers kleingemacht wird. Um geschlechtsneutral zu bleiben, kann ebenso das Beispiel der Klassenkameradin herangezogen werden, die immer mit dem neuesten Spielzeug und den teuersten Klamotten in die Schule gekommen ist. Die im Rheinland dafür typischen Begriffe lauten Bonze oder Tussi. Hier wird das Defizit in Bezug auf Geld und Kleidung umgedeutet und dazu missbraucht, den anderen kleiner zu machen. Wenn wir diesen Gedankengang nochmals fortführen, kann man festhalten, dass Status und Aggression niemals Ausdruck von Stärke sind, oder? Würden Sie das so unterschreiben? Ich erzähle Ihnen hierzu eine kurze Geschichte aus meiner Kindheit.
4.3.2 Wladimir Klitschko und die heilige Mittagsruhe
Ich bin in Bliesheim groß geworden, einer 3.000 Seelen-Gemeinde in der Nähe von Köln. Bliesheim ist ein typisches Dorf für die Region. Jeder kennt hier jeden, es gibt regelmäßig ein Schützenfest, die Menschen sind streng katholisch und eher konservativ. Folglich gibt es sonntags zwischen 12 Uhr und 15 Uhr die heilige Mittagsruhe. In dieser Zeit kann man den Wind pfeifen hören.
Meine Eltern sind der Meinung, dass ich im Alter zwischen sechs und 16 Jahren ein relativ schwieriges Kind war. Ich sehe das natürlich anders! Ich war angeblich sehr laut und zudem ein unheimlich schlechter Verlierer (Letzteres birgt zumindest einen Funken Wahrheit). Diese Kombination hat unter anderem dazu geführt, dass ich bei Brettspielen wie Mensch ärgere dich nicht regelmäßig die Beherrschung verloren und das Brett vom Tisch geschleudert habe, um anschließend schreiend die Spielrunde in Richtung meines abgeschiedenen Zimmers zu verlassen. Und jetzt raten Sie einmal, welches bezaubernde Kind an einem Sonntagmittag um 13 Uhr im Garten seiner Eltern Tennis spielt und verliert? Moi. Ich verliere einen Punkt oder ein Aufschlagspiel und fange an, wie von der Tarantel gestochen zu schreien. In diesem Moment passiert Folgendes: Die Wohnzimmertür zum Garten öffnet sich und mein Vater (1,96 Meter, 105 Kilogramm) kommt in den Garten gestürmt. Ich selbst bin damals übrigens 12 Jahre alt, 1,60 Meter groß und wiege circa 60 Kilogramm. Er reißt mir den Tennisschläger aus der Hand und prügelt damit mehrfach auf meinen Allerwertesten ein.39 Wie passt dieses Verhalten zu unserem Schaubild?
Mein Vater ist mir gegenüber in dieser Situation doch eindeutig überlegen, oder etwa nicht? Schließlich ist er der Hausherr und bestimmt die Regeln. Er ist gebildeter als ich und hat somit einen riesengroßen Wissensvorsprung. Zuletzt ist er auch deutlich größer und stärker als ich. Somit scheint er in allen Belangen auf der rechten Seite des Bildes zu stehen. Und dennoch verhält er sich aggressiv (Sie erinnern sich: der Hammer). Warum? Wie kommt das zustande?
Ein zunächst naheliegender Gedanke bestünde darin zu überlegen: „Was sollen denn bloß die Nachbarn denken?!“ Vor 100 Jahren hätten unsere Nachbarn vermutlich applaudierend am Zaun gestanden und gedacht, dass diese Form der Bestrafung für mein ungehöriges Verhalten das Mindeste sei. Meine Geschichte datiert jedoch aus der Mitte der 90er Jahre. Zu dieser Zeit befanden wir uns schon längst im Zeitalter der antiautoritären Erziehung.40 Ich bin daher der festen Überzeugung, dass unsere Nachbarn wahrscheinlich die Polizei gerufen hätten, wenn sie Augenzeugen davon geworden wären. Insofern ist es fraglich, ob das „Bild nach außen“ tatsächlich der Antrieb für das Verhalten meines Vaters war.
Angenommen, Sie haben einen zwölfjährigen Sohn. Es ist Dienstagnachmittag und Sie kommen von der Arbeit nach Hause. Sie betreten das Zimmer Ihres zwölfjährigen Sohnes und stellen fest, dass es dort aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Dieses Szenario scheint bei einem Zwölfjährigen zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sein. Die Besonderheit der Situation besteht darin, dass das Zimmer Ihres Sohnes vorher über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg picobello aufgeräumt war – jetzt ist die Ordnung allerdings dahin. Da Ihnen Ordnung wichtig ist, möchten Sie Ihr Kind zum Aufräumen bewegen. Was würden Sie unter der Prämisse, dass das Zimmer vorher wochenlang aufgeräumt war, spontan zu Ihrem Sohn sagen? Die häufigste Antwort auf diese Frage lautet, dass man sich zunächst einmal danach erkundigt, ob alles in Ordnung sei:
„Was ist denn hier passiert? Ist alles okay?“
Nach einem kurzen Gespräch verlassen Sie das Zimmer und haben das Ganze auch recht schnell wieder vergessen. Donnerstag abends kommen Sie jedoch ein zweites Mal an dem Zimmer Ihres Kindes vorbei und haben einen Geistesblitz. Da war ja noch die Sache mit dem Zimmer. Zwecks Ergebniskontrolle öffnen Sie die Zimmertür und was ist in der Zwischenzeit passiert? Natürlich nichts. Was sagen Sie jetzt zu Ihrem Kind?
Zumindest manche Eltern werden jetzt deutlicher, indem eine klare Aufforderung mit mehr Nachdruck folgt:
„Ich habe bereits mit dir darüber gesprochen.
Bitte räum das Zimmer bis morgen Abend auf!“
Es vergehen vier weitere Tage. Sie kommen zum dritten Mal an dem Zimmer vorbei. Beim Vorbeigehen sehen Sie jedoch aus dem Augenwinkel durch einen kleinen Türspalt, dass trotz mehrfacher Aufforderung weiterhin keine Veränderung in dem Zimmer stattgefunden hat. Was könnte unter Umständen jetzt passieren?
Bei mir persönlich besteht durchaus die Möglichkeit, dass mir je nach Gemütslage an diesem Tag der Geduldsfaden reißt. In diesem Fall bringe ich meinen Ärger durch eine erhobene Stimme zum Ausdruck (übersetzt: Ich fange an zu schreien.). Ich bediene mich also ebenfalls des Hammers. Da unser Sohn erst drei Jahre alt ist, besteht diese Problematik derzeit eher weniger. Wenn er jedoch eines Tages in das entsprechende Alter kommt, habe ich eine sehr genaue Vorstellung davon, wie eine vergleichbare Situation ablaufen würde. Ich kaufe mir einen Erziehungsratgeber! Ich schlage den Ratgeber auf und finde auf Seite eins den Tipp, man solle klare Ansagen machen. Dementsprechend gebe ich meinem Sohn einen klaren Arbeitsauftrag. Was passiert? Nichts. Ich blättere um. Auf Seite zwei wird erörtert, man solle es als Kumpel-Typ mit Humor versuchen. Ich beherzige auch diesen Ratschlag mit dem exakt gleichen Ergebnis, dass wieder nichts passiert. Ich gehe zur nächsten Seite. Dort steht geschrieben, es sei wichtig, konsequent zu sein. Folglich drohe ich meinem Sohn mit Konsequenzen in Form von Handy- oder Playstation-Verbot. Es passiert abermals nichts. Anschließend arbeite ich mich durch den gesamten Ratgeber durch und probiere alle dort beschriebenen Strategien erfolglos aus. Irgendwann komme ich jedoch zu dem Punkt, an dem ich wieder umblättere und plötzlich auf der letzten Seite angelangt bin. Hier stelle ich mit Entsetzen fest, dass dort nichts mehr geschrieben steht. Ich werde sprichwörtlich nur noch von einem leeren Blatt Papier angelächelt. Infolgedessen lege ich den Ratgeber beiseite und beginne, in meiner (virtuellen) persönlichen Werkzeugkiste zu wühlen, um zu überprüfen, welche eigenen, persönlichen Methoden bzw. Werkzeuge mir noch zur Verfügung stehen. Ich wühle tiefer und tiefer bis ich am Bodensatz meiner Werkzeugkiste ein letztes Instrument finde. Wissen Sie, um welches Werkzeug es sich dabei handelt?
Den Hammer.
Status und Aggression sind Ausdruck von Hilflosigkeit. Menschen zeigen diese Verhaltensweisen immer dann, wenn sie das Gefühl haben, auf einem anderen Weg nicht mehr weiterzukommen. Patienten und Angehörige schreien Klinikpersonal nicht an, weil sie sich Medizinern gegenüber überlegen fühlen. Im Gegenteil! Sie schreien, weil sie nicht wissen, was sie noch tun können. Genau wie mein Vater sind sie mit der Situation schlichtweg überfordert. Sie haben aus ihrer Sicht bereits alles Menschenmögliche versucht und wissen nicht mehr, was sie alternativ noch machen können. Wahre Stärke braucht niemand zu demonstrieren. Wenn beispielsweise eine Führungskraft das Gefühl hat, von ihren Mitarbeitern anerkannt zu werden, braucht sie nicht um deren Anerkennung zu kämpfen.
Ein sehr anschauliches Beispiel in diesem Zusammenhang sind die Gebrüder Klitschko aus der Ukraine. Die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko sind beide mehrfacher Boxweltmeister und haben den Boxsport über mehr als ein Jahrzehnt hinweg geprägt. Typischerweise gibt es vor jedem Boxkampf eine Pressekonferenz, in der sich die Kontrahenten gegenüberstehen, um sich einen ersten verbalen Schlagabtausch zu liefern. Die Gegner der beiden wurden im Rahmen dieser Pressekonferenzen immer sehr schnell laut, beschimpften die Klitschkos und gingen häufig verbal unter die Gürtellinie. Vor dem Kampf gegen David Haye im Jahr 2011, der passender Weise später unter dem Motto „The Talk ends now“ in die Geschichte einging, hielt David Haye sogar als Provokation in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Men's Health“ auf einer Kollage den abgetrennten Kopf von Wladimir Klitschko in den Händen. Dieses Verhalten wirkt auf den ersten Blick extrem brutal und gefährlich – psychologisch gesehen war David Haye jedoch so klein mit Hut:
Er wusste, dass er keine Chance haben würde. Die Klitschkos hingegen waren sich ihrer Fertigkeiten und Ausdauer im Ring stets bewusst. Sie fühlten sich nicht dazu veranlasst, das bereits im Vorfeld eines Kampfes demonstrieren zu müssen. Sie lehnten sich bei der entsprechenden Pressekonferenz entspannt in ihren Stuhl zurück, verschränkten die Arme und sagten lediglich: „Wir regeln das im Ring.“ Das ist wahre Stärke!
Hilflosigkeit ist eines der dominierenden Gefühle von Patienten.41 Alleine durch die Erkenntnis, dass Status und Aggression Ausdruck von Hilflosigkeit sind, eröffnet sich ein völlig neues Handlungsrepertoire. Es stellt sich dennoch die Frage, wie man mit so einem „Kleinen“ umgehen soll. Was möchte er von uns? Was geht gerade in ihm vor? Der Schwerpunkt des nächsten Kapitels liegt auf der Beantwortung dieser Fragen.
24 Vgl. Mikich (2013) Patienten sind im Krankenhaus noch ausgelieferter als bei ihrem Hausarzt. Den Hausarzt kann man (zumeist) wechseln. Das Krankenhaus kann man nicht verlassen, wenn einem nicht gefällt, wie sich der Arzt einem gegenüber verhält.
25 Lösungsansätze zur Aufhebung dieses Informationsdefizites folgen in Kapitel 10.
26 Ich benutze hier den Begriff „schwierig“, da er in vielen Schulungen von Seminarteilnehmern gebraucht wird. Ich finde das jedoch nicht ganz passend. Siehe hierzu Kapitel 11.
27 Vgl. Brehm & Brehm (1981)
28 Vgl. Brehm & Brehm (1981)
29 Vgl. Schmidt (2018)
30 Vgl. Driscoll, Davis & Lipetz (1972)
31 Vgl. Mazis (1975)
32 Die Wirkungsmechanismen auf die menschliche Psyche während der Corona-Krise sind deutlich vielschichtiger als hier beschrieben. Darüber hinaus möchte ich die Pandemie nicht mit dem Aufenthalt in einem Krankenhaus vergleichen. Mir ist jedoch während des Schreibens die Verbindung der hier beschriebenen Reaktanztheorie zu meinen persönlichen Empfindungen während der Corona-Krise aufgefallen.
33 Vgl. Gordon (1977)
34 Vgl. Allport (1945): Der Sozialpsychologe Gordon Allport hat in einer Reihe von Experimenten die Förderung von Mitbestimmung in Organisationen untersucht.
35 Vgl. Siegel (1991)
36 Vgl. Gordon & Edwards (1997)
37 Vgl. Heiland (2018)
38 Zu dem Stichwort „Hammer“ finden Sie in Kapitel 11 eine schöne Geschichte von Paul Watzlawick.
39 Das war der einzige Vorfall dieser Art. Mein Vater war ansonsten immer sehr liebevoll!
40 Vgl. Hurrelmann & Albrecht (2014), vgl. Mangelsdorf (2015)
41 Vgl. Heiland (2018), vgl. Kowarowsky (2011)