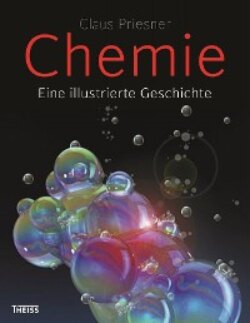Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Eisen
ОглавлениеUnzweifelhaft ist Eisen das für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation bei weitem wichtigste Metall. Obwohl die Eisenzeit im Vorderen Orient etwa um 1000 v. Chr. begann, war metallisches Eisen schon in der Steinzeit bekannt, auch in Kulturen, die gar nicht oder erst viel später die Verhüttung von Eisen beherrschten. Der Grund dafür ist gediegenes, in der Regel mit Nickel legiertes Eisen aus Meteoriten. Das chemische Elementsymbol für Eisen, Fe, leitet sich von seinem lateinischen Namen »ferrum« ab. Betrachten wir zunächst die in der Antike verfügbaren und bekannten Erze. Neben dem »Raseneisenerz«, das so heißt, weil es entweder direkt auf der Erdoberfläche oder in sehr geringer Tiefe gefunden wird, sind dies das verwandte Brauneisenerz, das Spateisenerz oder Siderit und das Roteisenerz, auch Eisenglanz oder Hämatit (Blutstein) genannt. Bis auf den Siderit, der kohlensaures Eisen ist, sind die übrigen Erze Oxide des zwei- und dreiwertigen Eisens (die Wertigkeit gibt an, welche Oxidationsstufe ein Metall besitzt, d.h. in welchem Verhältnis es sich mit Sauerstoff verbinden kann; Eisen ist entweder zwei- oder dreiwertig). Reines Eisen besitzt einen sehr hohen Schmelzpunkt, nämlich 1535 °C. Kein Lagerfeuer kann solche Temperaturen auch nur annähernd erreichen. Aber mit einem einfachen Ofen kann man schon relativ hohe Temperaturen von mehr als 800 °C erreichen, bei sachgemäßer Anwendung eines Blasebalges bis zu 1300 °C. Aus alldem folgt, dass es relativ schwierig ist, Eisenerze überhaupt zu verhütten – und dass es noch schwieriger ist, dabei ein gleichbleibendes und erwünschtes Resultat – in der Regel einen härt- und schmiedbaren Stahl – zu erzielen. Die ursprünglich nur leicht gewölbten Ofendecken wurden nach und nach in oben offene niedrige Schächte umgeformt, was den Zug der Öfen erheblich verbesserte und höhere Temperaturen erlaubte.
Bei den in einfachen Öfen erreichbaren Temperaturen ist Eisen zwar noch nicht geschmolzen, es erweicht aber und kann zu einer »Luppe« geschmiedet werden. Eine Luppe ist ein aus mehreren kleineren Eisenbrocken zusammengeschmiedetes größeres Eisenstück. Durch mehrfaches Erhitzen und Hämmern des erhitzten Eisens bildet sich daraus ein mehr oder minder taugliches Schmiedeeisen bzw. ein mehr oder minder guter Stahl. Im Gegensatz zu den anderen behandelten Metallen, die man zunächst einmal möglichst rein zu gewinnen bestrebt war, ist reines Eisen praktisch ohne Gebrauchswert und wird bis heute kaum hergestellt. Eisen besitzt aber die Fähigkeit, sich mit vielen anderen Metallen zu legieren und es kann sich auch mit dem Nichtmetall Kohlenstoff verbinden. Gerade die letztere Eigenschaft verlieh dem Eisen jene hervorragenden Eigenschaften, die es zum prägenden Metall einer Epoche machten, die vor rund 3500 Jahren in Kleinasien bei den Hethitern begann und bis heute andauert. (In Mitteleuropa begann die Eisenzeit etwa um 1000–800 v. Chr., im subsaharischen Afrika 200 bis 300 Jahre später.) Die Kelten waren recht geschickte Bergleute und Metallurgen und befassten sich schon relativ früh – in der La-Tène-Zeit (ca. 500 v. Chr.) – mit der Eisenverhüttung. Allerdings nicht immer mit erfreulichen Resultaten, wie wir weiter unten erfahren werden.
Die Verhüttung des Eisens erfolgte zunächst wie üblich mit Holzkohle. Um 1710 erfand ein gewisser Abraham Darby aus Coalbrookdale (nomen est omen) den Koks. Der Name wurde ursprünglich »coaks« geschrieben und war eine Zusammenziehung von »coal« und »cooked«, ebenso ist unser »Keks« eine Eindeutschung des englischen Plurals für Kuchen, »cakes«.) Der Prozess der Kokserzeugung entsprach vollkommen dem der Holzkohlegewinnung: Kohle wurde unter Luftabschluss erhitzt. Wie bei der Holzverkohlung üblich, verkokte auch Darby seine Kohle in einem Meiler. Bald benutzte man eiserne Röhren in sog. Retortenöfen. Bei der Verkokung entweicht der in der Kohle enthaltene Schwefel als Schwefelwasserstoffgas zusammen mit anderen flüchtigen Bestandteilen und der verbleibende Koks eignet sich ebenso wie Holzkohle sehr gut zur Verhüttung von Eisenerzen. Ohne die Erfindung Darbys wäre es nicht möglich gewesen, die für die Industrialisierung nötigen enormen Mengen an Eisen und Stahl zu fabrizieren.
Querschnitt durch einen Hochofen mit starker gemauerter Ummantelung, wie er im 19. Jh. verwendet wurde. Das »Gemäuer« sollte Wärmeverluste vermeiden.
Der Kohlenstoff dient aber nicht nur zur Reduktion der oxidischen Erze, er verbindet sich auch mit dem Eisen. In welchem Mengenverhältnis dies geschieht, ist maßgebend für die Eigenschaften des Eisens. Enthält es weniger als 1,7 % Kohlenstoff, ist es weich und formbar und wird als Stahl bezeichnet. Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,4 und 1,7 % kann durch Erhitzen auf Rotglut (ca. 800 °C) und schnelles Abkühlen gehärtet werden. Stahl, der weniger als 0,4 % Kohlenstoff enthält, nennt man Schmiedeeisen. Gusseisen enthält 2–4 % Kohlenstoff, es ist hart, spröde und nicht schmiedbar. Das Gusseisen konnte erst sehr spät genutzt werden, wie wir noch sehen werden. Sicher wurde es auch schon früher immer wieder unabsichtlich gewonnen, wenn die Temperatur in der Schmelze besonders hoch war, wegen seiner Sprödigkeit wurde es aber gleich wieder eingeschmolzen.
Die Weiterentwicklung des Ofens ist der »Hochofen«. Die Bezeichnung erscheint erstmals im 13. Jh., als die Kamine der Schachtöfen bis auf fünf Meter erhöht wurden. In England wurden solche Hochöfen im 15. Jh. eingeführt, in Nordamerika erst 1644. Die Kapazität dieser Öfen war noch recht gering. Beispielsweise hatte der 1544 in Ilsenburg bei Wernigerode im Nordharz gebaute Hochofen eine Kapazität von etwa 750 kg Eisen pro Tag. Der Hochofenprozess entspricht prinzipiell der erläuterten Reduktionsmethode, ist in der Praxis aber so kompliziert, dass ich auf eine genauere Darlegung der dabei ablaufenden Einzelphasen verzichten möchte. In einem Hochofen entsteht immer Gusseisen (Schmelzpunkt 1100–1200 °C), das hinterher auf unterschiedliche Weise »gefrischt« wird, sofern man es nicht zu Maschinenteilen oder Gebrauchsgegenständen etc. vergießen möchte. Gegen Ende des 19. Jh. hatte ein Hochofen eine Höhe von etwa 18 Metern und eine Tageskapazität von 17 Tonnen Roheisen. Moderne Hochöfen sind mit 25 Metern nicht sehr viel höher, können aber bis zu 3000 Tonnen Roheisen täglich erzeugen. Ein einmal »angefahrener« Hochofen muss permanent betrieben werden: In dem Maß, in dem unten flüssiges Eisen »abgestochen« wird, kommt oben frisches Eisenerz und Koks nach. Eine solche »Ofenreise«, also die Betriebszeit eines Hochofens, dauert ca. 10 Jahre.
Als die oberflächennahen oxidischen Erze vielerorts seltener wurden, begann man, die Erze auch aus größeren Tiefen zu fördern. Da diese meist als Sulfide vorliegen (z.B. als »Katzengold«, FeS2), lernte man, diese durch Rösten an der Luft verhüttbar zu machen. Die Nutzung phosphorhaltiger Eisenerze wurde allerdings erst im 19. Jh. möglich (»Thomas-Gilchrist-Verfahren«).
Blicken wir nochmals zurück in die Vergangenheit, wo eine Eigenschaft des Eisens entdeckt wurde, die es von allen anderen Metallen unterschied, nämlich der Magnetismus. Die physikalische Ursache des Ferromagnetismus, wie er genaugenommen heißt, wurde erst im 20. Jh. gefunden; vereinfacht kann man sich vorstellen, dass ein Stück Eisen viele winzige Magnetnadeln enthält, die »Weiss-Bezirke« (benannt nach dem französischen Physiker Pierre-Ernest Weiss). In geschmolzenem Zustand sind diese Magnetnadeln regellos angeordnet und heben sich in ihrer Wirkung gegenseitig auf. Im festen Eisen und in bestimmten Eisenerzen wie dem Magneteisenstein können sie sich aber parallel anordnen und dadurch eine merkliche magnetische Kraft ausüben. Um sich gleichmäßig anordnen zu können, ist eine äußere Kraft nötig, die entweder von einem anderen Magneten, vom Erdmagnetfeld oder einer stromdurchflossenen Spule verursacht sein kann. Nicht jedes Stück Eisen oder Stahl wird gleichermaßen magnetisiert. Am besten eignet sich dazu weiches Schmiedeeisen.
Hochofenanlage im Ruhrgebiet, 1896.