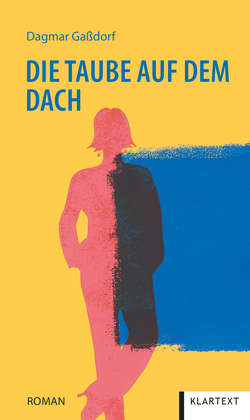Читать книгу Die Taube auf dem Dach - Dagmar Gaßdorf - Страница 11
Die eigene Wohnung
ОглавлениеJetzt bist du so oft umgezogen, wann bist du endlich mal zu Haus? Du hast uns immer angelogen: Angeblich musstest du jedes Mal raus!
Mal fehlte dir die Abendsonne, dann wurd’ dir der Verkehr zu laut, Dann fingen die Nachbarn an zu fiedeln, Es hieß, du hieltest es nicht mehr aus.
Jetzt haben sie vis-à-vis gebaut, und es lockte dich sowieso das Land, doch dort hat der Nachbar dir reingeschaut. Du sagst, er sei sehr penetrant.
Wir haben nun aufgehört zu zählen.
Es ist ja dein Geld, das du versenkst. Nur eines kannst du uns nicht erzählen: dass du dir nur so neues Leben schenkst.
Man ist und bleibt doch das alte Ich.
Man hat es an allen Orten dabei.
Als Schatten lässt es uns niemals im Stich, ob im Süden, im Norden, der Mongolei.
Du kannst es uns glauben: Selbst wenn du einst tot – du bist und bleibst derselbe Idiot!
Gelegentlich schrieb Barbara Verse, nichts Besonderes, Gelegenheitsverse – mal, um ein Geschenk interessanter zu machen, mal, weil sie einfach Freude an dem Einfall hatte, manchmal aber auch, weil Gedanken, die man in eine gefällige Form gebracht hat, zu unerwartet hilfreichen Erkenntnissen mutieren können. In diese dritte Kategorie fiel das Gedicht, das sie bei ihrem vierten Umzug nach dem Tod ihres zweiten Mannes schrieb. Aber so weit sind wir noch nicht. Der erste Umzug, den Barbara aus eigenem Entschluss absolvierte, war das Verlassen des Elternhauses gleich nach dem Abitur.
Es war ein Einser-Abitur, mit Spitzennoten selbst in Fächern, die Barbara überhaupt nicht interessierten – Mathematik zum Beispiel. Da hatte sie lediglich den Kurvendiskussionen etwas abgewinnen können; die hatten wenigstens etwas halbwegs Sinnliches. Ihr Leben lang sollte es Barbaras Vorstellungskraft übersteigen, wie jemand Lust am peniblen Rechnen haben kann, ein Steuerberater zum Beispiel oder ein Wirtschaftsprüfer. Angesichts dieses ausgeprägten Desinteresses an Zahlen grenzte es an ein Wunder, dass aus dieser merkwürdigen jungen Frau eine erfolgreiche Unternehmerin werden sollte. Möglicherweise lag es daran, dass der mangelnde Sinn für Rechenoperationen bei ihr kompensiert wurde durch ein gutes Bauchgefühl dafür, ob eine Zahl der Höhe nach und grundsätzlich stimmen konnte.
Trotz der geschilderten Behinderung, die mit Zahlen-Legasthenie übertrieben, mit geringem Talent zum Kopfrechnen aber korrekt beschrieben wäre, machte Barbara das beste Abitur ihres Jahrgangs. Es fiel ihr folglich die Aufgabe zu, die obligatorische Dankesrede zu halten: Die Schule, die Lehrer und nicht zuletzt die Eltern hatten gelobt zu werden.
Barbara tat das, wie man etwas tut, was eben getan werden muss: Müll in die Mülltonne bringen zum Beispiel. Das gehörte sich so, es wurde erwartet. Und anerkannt, geschätzt und geliebt wurde man nur, wenn man tat, was erwartet wurde. Den einzigen Protest, eigentlich eher den Hauch eines Protestes, in der Situation „erwartete Lobrede bei der Abschlussfeier des Gymnasiums“ leistete sie sich dadurch, dass sie sich ein weißes Kleid kaufte, während alle anderen Mädchen im „kleinen Schwarzen“ erschienen. Das Geld dafür hatte sie sich schließlich durch Nachhilfestunden selbst verdient; da hatte sie auch das Recht, selbst zu bestimmen, welche Farbe es hatte. Nicht, dass Geld als solches Barbara interessiert hätte; das einzige, was sie an Geld interessierte, war die Freiheit, die es einem schenkte, wenn man genügend davon hatte.
Das Abiturkleid war ärmellos und hatte eine geprägte Oberfläche: Aus dem flach gewebten Stoff erhoben sich, einem nicht auf Anhieb erkennbaren Rapport folgend, weiche, aus einem glänzenderen Garn gewirkte Rosen. Das sah kostbar aus und erinnerte an Bilder von reichen Renaissance-Bürgern, die oft Umhänge aus so ausdrucksvollen Stoffen trugen. Das kurze Jäckchen war aus demselben Material und so weiß wie das Kleid. Es war schließlich nicht einzusehen, warum man bei einem freudigen Anlass in Schwarz gehen sollte.
Neben Barbara in der ersten Reihe der für den Anlass mit Blumen geschmückten Aula, die sonst vor allem für Chor- und Orchesterproben genutzt wurde, saß der Klassenlehrer im dunkelblauen Anzug, neben diesem wiederum die Tochter eines Lehrerkollegen im obligaten kleinen Schwarzen. Neben deren Gesicht wippten Korkenzieherlöckchen, die von Annette von Droste-Hülshoff hätten sein können. Offenbar hatte die Mutter, eine in Lehrerfrauen-Kreisen gefürchtete Frau von Walküren-Statur, am Friseur für die Tochter nicht gespart.
Barbaras Frisur hatte es zum Nulltarif gegeben: Den kinnlangen Pagenschnitt verdankte sie der einzigen von Hildegard Brinkmann geduzten Nachbarin Doris. Die hatte eine Kopftopf-Technik entwickelt, die sie erfolgreich auch an der eigenen Tochter praktizierte: einfach den Topf über den Kopf stülpen und unten ringsherum schneiden. So kam es, dass Barbara auf allen Fotos von der Abiturfeier, nicht nur denen, die sie stehend am Rednerpult zeigten, aus ihrer Umgebung deutlich herausstach – wegen ihres weißen Kleides und wegen ihres scharfkantigen blonden Pagenkopfes.
Bei dem Auftritt in der Schul-Aula hatte es sich um eine eher gemäßigte Form der Revolution gehandelt. Ein deutlicheres Zeichen des Protests gegen das Erwartungsschema war der Umzug in eine eigene Wohnung unmittelbar nach dem Abitur. Ja, man hätte diesen ersten selbst gewählten Umzug womöglich für eine frühe Form grünen Protests halten können, wäre die gefundene Bleibe nicht wegen fehlenden Fließwassers und einer archaischen Toilette hinter dem Haus, vulgo „Plumpsklo“, das billigste Quartier gewesen, das man im Einzugsbereich der Ruhr-Universität finden konnte. Die Wohnung befand sich unter dem Dach einer alten Kate auf einem Höhenzug außerhalb der Stadt. Eigentümerin war eine alleinstehende, vermutlich verwitwete Frau mit dunkel funkelnden Augen und Damenbart, die jeden Schritt auf der knarzenden Treppe zum vermieteten Dachgeschoss hörte. Auch den von Ludger. Selbst einer wie er, wahrlich kein Schwergewicht, konnte Barbara nicht in ihrer Wohnung besuchen, ohne gehört zu werden.
Ludger, der Tanzstundenfreund, Abiball-Partner, Fahrradlehrer und Kompositeur der Uher-Tonbänder mit der geliebten Musik von Cat Stevens und Leonard Cohen, hatte angefangen, Chemie zu studieren. Aber er hätte jede Naturwissenschaft und jedes technische Fach studieren können, denn ihn faszinierten solche Dinge wie der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Von dem konnte er nicht genug erzählen, und bis hin zu der Erklärung, wie man ohne diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht verstehen könne, wie Ordnung und Unordnung in die Welt kommen, versuchte er alles, Barbara mit seiner Begeisterung anzustecken.
Sensible Beobachter hätten damals schon ahnen können, dass die Beziehung zwischen diesen beiden nicht gut gehen würde – lange bevor Barbara in die Werbung ging und Ludger ihr empört vorhielt: „Ihr könnt zwar Fernsehspots machen; aber ihr wisst noch nicht einmal, wie so ein Fernsehgerät funktioniert!“ Denn seine Frau, und das war Barbara zum Zeitpunkt dieser Empörung bereits, wollte das gar nicht wissen.
Vielleicht verwechselte Barbara ihre Bewunderung für die außerordentliche technische Begabung dieses jungen Mannes mit Verliebtheit; jedenfalls fiel sie ihm strahlend um den Hals, als er ihr mit Hilfe großer Untertisch-Behälter, durch Schläuche und Ventile verbunden mit einer riesigen Obertisch-Porzellanschüssel, die damals schon so elegant aussah wie die auf Holzflächen stehenden angesagten Rundbecken von heute, trotz mangelnden Fließwassers zu einem funktionierenden Inhouse-Waschtisch verholfen hatte.
Die Konstruktion war ihrer Zeit auch innenarchitektonisch weit voraus, da Barbara sie von ihrem Bett aus sehen konnte. Wenn sie später in ein luxuriöses Hotelzimmer mit einem der in Mode gekommenen, zum Schlafzimmer offenen Bäder kam, musste sie an Ludger denken, der so gut zu ihr gewesen war, und an diese ihre erste eigene Wohnung. Es kommt alles wieder, dachte sie dann, man muss nur lange genug warten. Nur eine verflossene Beziehung, die kommt nicht wieder.
Man schrieb die siebziger Jahre, und Luxus-Hotels waren für Barbara eine völlig unbekannte Welt. Noch nicht einmal an ein eigenes Auto war zu denken, und dies, obwohl die Miete für die Dachwohnung unschlagbar günstig war. Aber es gab ja eine Buslinie zur Uni, wenn auch eine mit Umsteigen. Als sie das Jahrzehnte später einem ihrer Enkel erzählte, meinte der: „Oma, das gefällt mir. Weißt du, ich will gar kein Auto.“
Weniger schön an den Busfahrten war, dass an einer Haltestelle häufig ein korpulenter Student zustieg, der Barbara immer mit hochrotem Kopf anschaute und ihr irgendwann ein Briefchen zusteckte. Es war eine Liebeserklärung. Ein winziges Format hatte der Mensch dafür gewählt, eine Inkongruenz, die lächerlich hätte wirken können, die ihn aber fast schon wieder sympathisch machte.
Denn was ist schon lächerlich? Lächerlich war dann auch, was Barbara studierte. Lehramt nämlich. Der liebe Gott mochte wissen, warum dieses Mädchen, das jeden Studiengang hätte wählen können, ausgerechnet Lehrerin werden wollte. Waren es wunderbare, große Vorbilder? Wohl kaum: Bereits die Volksschullehrerin, eine seltsam geschlechtslose Frau mit straff über die Kopfhaut gekämmten und am Ende in einem Dutt versteckten Haaren, hatte Barbara in unguter Erinnerung; es tat schon weh, wenn man die Ohren umgedreht bekam, weil man während des Unterrichts aus Langeweile gemalt hatte. Wenig gute Gefühle hatte Barbara auch beim Gedanken an ihre Geschichtslehrerin im Gymnasium, die Frau mit dem Klumpfuß, die sie immer so feindselig angeschaut hatte, weil sie alles auswendig aufsagte. Und der Lateinlehrer, der mit dem abgesägten Finger, redete dauernd in einem verschwörerischen Ton von der Ars amandi, ohne jemals genauer zu erzählen, welche erotischen Sachen sich da bei Ovid finden. Ihre Förderer schließlich, allen voran der Deutschlehrer, waren so begeistert von ihr, dass sie ihre Schwächen nicht erkannten.
Warum also Lehramt? Die Antwort war trivial: weil Barbara außer Ärzten und Lehrern aus eigener Anschauung, eigenem Erleben, keine akademischen Berufe kannte. Und Ärztin kam für sie nicht in Frage. Vor dem Abitur war sie, einem Appell des katholischen Religionslehrers folgend, jeden Sonntag ins örtliche Marienhospital gegangen, um dort den Nonnen bei der Krankenpflege zu helfen, unbezahlt natürlich. Aber während der so genannte Schweinetrog auf dem Hof des Krankenhauses, in den die Reste der Patienten-Essen zu befördern waren, sie nur ekelte, wurde ihr beim Anblick größerer Blutmengen schlecht.
Es nützte daher nichts, dass wohlmeinende Lehrer rieten, sie möge doch Medizin studieren; da könne man am meisten verdienen – was damals noch stimmte. Bei ihrem Zeugnis würde sie doch sofort genommen! Als ob die Patienten etwas von Einsern auf dem Zeugnis hätten, dachte Barbara. Die waren doch viel besser mit Ärzten bedient, die kein Problem mit solchen Sachen wie Blut und Eiter hatten.
Da Rudolf und Hildegard Brinkmann niemals einen Anwalt konsultiert hatten und auch keinen Umgang mit solchen Leuten pflegten, womit auch die Welt der Rechtsprechung für ihre Kinder eine völlig fremde war, und da das Universum der Kunst für Barbara vor allem aus Büchern und Schallplatten bestand, ohne dass sie jemals mit Künstlern in persönlichen Kontakt gekommen wäre, blieb also vermeintlich nur das Lehramt übrig.
Nein, das stimmt nicht ganz: Sie hätte auch Priester werden können; in dieser Welt kannte sie sich aus. Aber die katholische Kirche war noch nicht so weit, Frauen zuzulassen, und sie ist es, obwohl ihr die männlichen Kandidaten langsam, aber sicher völlig abhanden kommen, bis heute nicht. Nicht dass Barbara das damals schon so klar gesagt hätte; dazu war sie noch zu sehr im System gefangen. Und auch den Mut zur unverblümten Sprache sollte sie erst noch lernen.
Ludger studierte bereits an der Ruhr-Universität, als Barbara dort anfing. Wäre sie in einem großbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen, wäre sie vielleicht lieber auf eine Schauspielschule gegangen. Vielleicht auch auf eine Kunst- oder Musikhochschule. Oder auf eine Journalistenschule. Aber all das lag jenseits ihres Horizonts. Also studierte sie aus dem Fächerkanon, den die RUB zu bieten hatte, das, was sie von dem, was sie zu kennen glaubte, am meisten interessierte: Sprache und Literatur, und zwar in den Sprachen, die ihr durch die Schule vertraut waren. Auf die Uni übertragen hieß das: Germanistik, Anglistik und Romanistik.
Oft holte sie Ludger in seinem Labor ab. Da roch es manchmal unangenehm, und nicht selten stank es sogar, denn Ludger hatte sich für Organische Chemie entschieden. Es konnte sein, dass ein Kommilitone – Frauen sah Barbara da nie – gerade mit irgendeinem Kohlenwasserstoff experimentierte und ihrem Freund dann Aromen ähnlich denen einer Herrenankleide in einer alten Sporthalle noch Stunden später in den Kleidern hingen und nach dem Kleiderwechsel immer noch in den Haaren. Da war es schon angenehmer, man begab sich rein literarisch ins Labor, dachte Barbara; man konnte ja, statt sich mit Brückenkopf-Diazonium-Ionen zu beschäftigen, auch mit Goethes Faust etwas pauschaler die Frage stellen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Dass Barbara im faustischen Sinne mit heißem Bemühen studierte, um den Dingen auf den Grund zu gehen, kann man bei aller Sympathie nicht behaupten. Was die Welt im Innersten zusammenhält, interessierte sie weniger als der Umstand, wie genial diese Frage formuliert war. Wie Inhalte zu schönen Klängen werden – das war es, was sie faszinierte.
Mit großer Neugier nahm sie auch jenseits ihrer Studienfächer jede Gelegenheit wahr, Sprachwelten mit anderen Inhalten und anderen Klängen kennen zu lernen. Erst recht, wenn noch solche Anreize hinzukamen wie bei dem Portugiesisch-Lektor mit dem klassisch schönen Profil und der weichen Stimme, bei dem Lischboa nicht wie die portugiesische Hauptstadt klang, sondern wie das Versprechen einer Kuschelnacht. Gesagt hätte sie das dem Mann nie. Als Frau ergriff man nicht die Initiative.
Es scheint ohnehin so, als täten sich Ruhrgebietskinder schwer zu sagen, was sie fühlen, wonach sie sich sehnen. Selbst Barbara, die nicht unbedingt auf den Mund gefallen war und nicht ohne Grund Klassensprecherin, Schulsprecherin und dergleichen mehr gewesen war, neigte bei allem, was sie persönlich berührte, eher dazu auszudrücken, was sie nicht wollte.
So war es schon zu Schulzeiten gewesen, als sie am benachbarten Jungengymnasium an einem Russisch-Kurs teilnahm. Im Lehrerkollegium der benachbarten Schule gab es einen skurrilen alten Balten, der Knickerbocker trug, ein antikes Fahrrad fuhr und die Gabe hatte, in seinem Russisch-Kurs den Jungen und dem einen Mädchen vom Mädchengymnasium nicht nur diese merkwürdige Sprache mit ihren kyrillischen Buchstaben, sondern durch die Vermittlung von Sprichwörtern und Redensarten auch die russische Seele nahe zu bringen.
Er wählte dazu gern rhythmische Wendungen, die er mit besonderem Genuss durch seine von Kautabak gelblich verfärbten Zähne spuckte, was bei Sprüchen mit vielen Zischlauten besonders eindrucksvoll war, vor allem, wenn man im Streubereich der Spucke saß. Bei Щи да каща, пища наша, was so ähnlich klingt wie Schtschi da kaschtscha, pischtscha nascha und „Kohlsuppe und Grütze ist unsere Nahrung“ bedeutet, bekam man schon einmal etwas von dem Segen ab. Weshalb dieser Spruch Barbara unvergesslich war, auch wenn er erkenntnistheoretisch eindeutig weniger zu bieten hatte als der vom Käse, den es kostenlos nur in der Mausefalle gibt.
Angesichts der Zusammensetzung des Russisch-Kurses war es fast unvermeidlich, dass sich mindestens einer der Jungen in Barbara verliebte. Der, den es traf, hieß Wilm. Er war groß gewachsen und blond, ein richtiger Siegfried-Typ. Doch es gab aus Barbaras Sicht zwei Hindernisse. Das eine hieß Ludger, auch wenn der engste Körperkontakt, den sie bisher mit ihm gehabt hatte, der in der Tanzstunde gewesen war. Verlobt, wie das damals noch üblich war, waren sie auch nicht, denn damit wartete man, bis man volljährig war. Das andere Hindernis war Wilms Stimme. Die war nicht sonor wie Ludgers Bariton, sondern etwas zu hoch und etwas zu schleimig.
Als Wilm Barbara nicht nur zu Spaziergängen aufforderte, sondern sich zu der Frage verstieg, ob sie nicht „miteinander gehen“ könnten, sagte Barbara daher nein. Aber dieses Nein nachvollziehbar zu machen, indem sie erklärte, dass sie sich, wenn überhaupt einen „festen Freund“, dann einen mit erotischer Stimme wünschte, das brachte sie nicht fertig – wenn es ihr denn überhaupt in dieser Klarheit bewusst war.
Ein Studentenleben gab es nicht in Bochum, und schon gar keine Kneipenszene, wo man am Abend Freunde getroffen hätte. Nach dem letzten Seminar fuhr man nach Hause, jeder in seine Stadt. Hatte das damit zu tun, dass die Uni noch so jung war? Oder damit, dass nur die Allerwenigsten in der Nähe wohnten? War es typisch Ruhrgebiet, wo ja auch die Manager der großen Konzerne sich bis heute in keinem öffentlichen Lokal treffen, sondern außer in ihren privaten Zirkeln äußerstenfalls im Golfclub verkehren und gleich nach den Opernpremieren gern fluchtartig die Heimfahrt antreten? Darüber dachte Barbara damals nicht nach; aber es freute sie, dass sie demnächst an eine ganz andere, eine alte Uni wechseln durfte.