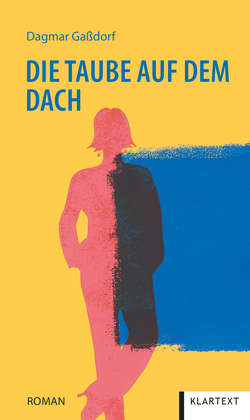Читать книгу Die Taube auf dem Dach - Dagmar Gaßdorf - Страница 12
Splendid isolation
Оглавление„It’s incredible!“, rief Suzanne, die ihr Zimmer unten in dem von Mrs. McAllister geführten Seton House hatte. Sie hatte recht: Es war wirklich unglaublich. Wann hatte eine der Studentinnen in diesem Wohnheim jemals täglich Post bekommen, und dann auch noch, wie die liebevolle Gestaltung der Umschläge vermuten ließ, von einem Verehrer! Wenn mal an einem Tag kein Brief von diesem Absender am Empfangstresen lag, konnte man darauf wetten, dass da am nächsten Tag gleich zwei liegen würden; denn dann hatte es nicht an der mangelhaften Aufmerksamkeit des Absenders, sondern an der Langsamkeit der Post gelegen. Suzanne bekam den Posteingang immer als Erste mit; sie schrieb bereits ihre Doktorarbeit und war deshalb häufiger im Hause als die anderen, die jeden Tag in die Vorlesungen und Seminare mussten.
Natürlich hatten die Bewohnerinnen alle längst gecheckt, dass der Autor der stets farbenfroh gestalteten, auffälligen Briefe Ludger hieß. Am liebsten hätten sie die Adressatin mit Fragen zu diesem scheinbar außergewöhnlichen Menschen gelöchert; aber dazu waren sie zu gut erzogen. Und Barbara hätte auch nur ungern sehr viel erzählt. Denn so sehr sie sich in dem Gefühl der Umworbenheit sonnte, so sehr verursachten ihr die Inhalte mancher der bunten Briefe doch Unbehagen. Das galt besonders für den in immer kürzeren Abständen geäußerten Wunsch nach einer baldigen Heirat, am liebsten sofort nach ihrer Rückkehr. Sie wollte doch einfach nur studieren und dann das Erlernte anwenden. Arbeiten, Geld verdienen, selbstbestimmt leben – war das etwa zu egoistisch?
Dass Barbara überhaupt im Ausland studieren konnte, war einem Stipendium zu verdanken. Zwar hatte sie immer Ferienjobs in den Semesterferien angenommen; aber für eine Universität im Ausland hätte das Geld, das sie dadurch zusammensparen konnte, nicht gereicht. Und ihre Eltern hätten zwar das letzte Hemd gegeben, um die Ambitionen ihrer Tochter zu unterstützen; aber das hätte Barbara nicht gewollt. Sie hatten ihretwegen schon auf genug verzichtet.
Nicht dass Barbara die Notwendigkeit, während der Ferien zu arbeiten, bereut hätte. Im späteren Leben jedenfalls nicht. Wie sollte man denn auch als so genannte Führungskraft wissen, wie es sich anfühlt, einfache Jobs zu machen, wenn man das nie am eigenen Leib erlebt hatte! Besonders in der Politik konnte man ja beobachten, wohin Karrieren vom Typ Hörsaal, Kreißsaal, Plenarsaal führen. Egal, was man gemacht hatte, ob Schrauben gedreht oder hinter der Ladenkasse gestanden – es war schon gut, wenn man wusste, wie es in der Arbeitswelt zuging.
Zur Arbeitnehmer-Solidarität, die besonders im Ruhrgebiet sehr hoch gehalten wird, gehörte auch die Konkordanz mit den kleinen Tricks und Absprachen, die das Leben erleichterten. War man zum Beispiel als Postbote auf seinen jungen Beinen schneller als die anderen unterwegs und wäre deshalb schon vor Zwölf mit leeren Taschen zurück im Postamt gewesen, was die Kollegen hätte alt aussehen lassen, setzte man sich besser auf einen Kaffee in das muffige Wohnzimmer einer alten Dame, die sich freute, dass sie sich ein wenig unterhalten konnte. Für diesen Sozialdienst wurde man zwar eigentlich nicht bezahlt; aber er schien Barbara eine vertretbare Nebenleistung. Der Umgang mit Hunden, die es nicht mögen, dass ein Postbote so viele verschiedene Gerüche mit sich herumträgt, war da schon schwieriger.
Deutlich schwerer tat sie sich in der Langeweile einer „Kraftfahrzeugsteuerstelle“, wo schon die Bezeichnung keinen spannenden Job verhieß. Dort teilte sie ein Büro mit einem älteren Herrn, der unter einer Art Händewaschzwang litt, aber leider jedes Mal, wenn er Wasser plätschern hörte, einen imperativen Harndrang verspürte. Der Mann sprach nicht darüber; aber immer wenn der arme Teufel sich die Hände gewaschen hatte, musste er unverzüglich zur Toilette, worauf er sich gleich wieder die Hände wusch, eine Endlosschleife der besonderen Art, die Barbara an einen zu Hause verpönten Ruhrgebietsscherz erinnerte: Wo gehsse? Im Kino. Wat gips da? Quo vadis. Wat is dat? Wo gehsse? Und so weiter von vorn.
Obwohl Lügen und Täuschen ja eigentlich verboten waren, gebot es also allein schon die Solidarität mit dem Kollegen, seinem dringenden Rat zu folgen, das Studienbuch im Schreibtisch verschwinden zu lassen und sich über eine bereit liegende Statistik zu beugen, sollte Gottvater in Gestalt des Amtsleiters hereinkommen.
Barbara hatte unbedingt nach Edinburgh gewollt. Dort unterrichtete ein Professor McKenzie, der sich mit einem Grundlagenwerk über die gerade besonders in den USA boomende Disziplin Linguistik in der akademischen Welt einen Namen gemacht hatte. Es war spannend zu sehen, wie nicht nur eine Sprache, sondern wie die Sprache grundsätzlich funktioniert und wie die Sprachen der Welt im Vergleich.
Zum Lernen war das Umfeld an der Universität Edinburgh ein ganz anderes als das zu Hause in Bochum: kleine Seminare, eigentlich waren es Klassen, jedenfalls nicht solche Zufallsansammlungen von Kommilitonen, die mal da sind und mal wieder nicht, sich erlauben, zu spät zu kommen, und niemals am selben Platz sitzen. Hier herrschte ein akademisches Bewusstsein, das allein schon durch das alte Gemäuer vermittelt wurde. Zu Semesterbeginn gab es einen Empfang der Universität, bei dem Sherry gereicht wurde. Sherry! Es war ihr erstes Glas Sherry, das Barbara da auf einem Tablett angeboten wurde, während einer der Professoren sie mit ein paar harmlos-höflichen Fragen auf ihr Where about in Germany ansprach und sie ihre erste und wichtigste Lektion in Sachen Großbritannien lernte: dass Smalltalk hier nicht als etwas Nichtssagendes, Dummes betrachtet wurde, sondern als Kunst.
Es war hier, wo sie die Lust an heiterer Konversation entwickelte und den Wunsch, eines Tages selbst Gastgeberin in einem Ambiente zu sein, in dem so etwas gepflegt werden konnte. Die Taube auf dem Dach, die man besser vergessen soll, weil es doch reicht, einen Spatz in der Hand zu haben, geriet so immer stärker ins Blickfeld dieses Ruhrgebietskindes. Was mit dem Messingschild an der Haustür angefangen hatte, sollte in den Willen münden, sich aus einer Denke zu befreien, die Träume schon deshalb nicht wahr werden lässt, weil man nicht an sie glaubt, nicht dafür zu kämpfen bereit ist und sich lieber im Durchschnitt einrichtet. „Wer Visionen hat, muss zum Arzt.“ Diesen Spruch eines späteren Bundeskanzlers hätte Barbara damals schon dumm und schädlich gefunden. Denn es war genau diese Einstellung, die ihr an sich so geliebtes Ruhrgebiet lähmte.