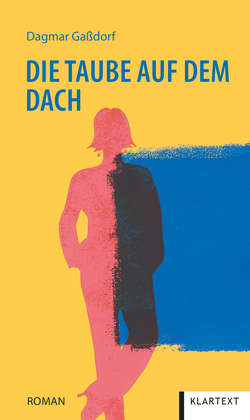Читать книгу Die Taube auf dem Dach - Dagmar Gaßdorf - Страница 8
Schillers Schule
Оглавление„A und ab, e, ex und de, cum und sine, pro und prae stehen mit dem Ablativ.“ Barbara liebte solche rhythmischen Merksprüche, die das, was sie längst intuitiv verstanden hatte, unvergesslich ins Gehirn brannten. Der Lateinlehrer, ein rothaariger Mensch mit dicker Brille, der sich mit der Kreissäge den Zeigefinger der linken Hand abgeschnitten hatte, weil er vom Heimwerken wohl weniger verstand als von Caesar und Cicero, liebte dieses Mädchen, das so frisch und frei vor den kichernden Klassenkameradinnen des Mädchengymnasiums Hexameter skandierte: Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes! Warum man die Danaer fürchten sollte, wo sie doch Geschenke brachten – das hätte man Barbara allerdings nicht fragen dürfen; die äußere Form war es, die es dieser Schülerin angetan hatte, nicht die Inhalte.
Schon im Kindergarten hatte Barbara von allem, was mit rhythmischer Sprache zu tun hatte, nicht genug bekommen können.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze Seht euch nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann! Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanze
Es war zu schön, wie man in den folgenden Strophen die Wanze kleiner und die Pausen länger werden ließ:
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanz- Seht euch nur die Wanz- an, wie die Wanz- tanz- kann! Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine Wanz-
bis man schließlich angekommen war bei:
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine W--
Seht euch nur die W-- an, wie die W-- t-- kann!
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ’ne kleine W--
Ein seltene Art von Gedächtnis machte es dieser Schülerin außerdem möglich, Vokabeln nicht pauken zu müssen, sondern die Buchseiten im Schulbus mit den Augen zu scannen und das Gewünschte dann bis zum Unterricht komplett parat zu haben, wie ein Bild. Die Geschichtslehrerin, eine promovierte ältere Dame mit Klumpfuß, geriet regelmäßig in Rage, weil es für dieses oberflächliche kleine Luder bequemer war, drei Seiten aus dem Lehrbuch auswendig aufzusagen als die Schlacht bei den Thermopylen in eigenen Worten darzustellen. „Barbara Brinkmann“, herrschte die Historikerin ihre Schülerin an, „du sollst mir nicht erzählen, was im Buch steht, sondern was passiert ist!“
Nicht dass Inhalte Barbara grundsätzlich nicht interessiert hätten. Im Gegenteil: Wenn sie im Deutsch-Unterricht ihre Reclam-Heftchen hervorholten, um mit verteilten Rollen die Jungfrau von Orléans zu lesen, dann war Barbara glücklich, wenn sie von ihrem Klassenlehrer, einem leise sprechenden, aber innerlich glühenden Liebhaber der Weimarer Klassik, die Rolle der Jeanne d’Arc zugeteilt bekam. Ach, wie sie die Aufgabe als eine Art höhere Weihe annahm und in ihr aufging! Die Klassenkameradinnen schwankten zwischen Befremden, Bewunderung und Erleichterung – Befremden, weil sie die „Brink“ für durchgeknallt hielten, Erleichterung, weil ihnen die peinlichsten Rollen auf diese Weise erspart blieben, und Bewunderung, weil sie hier Zeuge wurden, wie ein sonst eigentlich ganz normales Mädchen Schillers Sprache herunterlas, als wäre sie Alltagsdeutsch.
Barbara liebte die gebundene Sprache und ihr wurde ganz wohl, als sie entdeckte, wie unendlich viele wunderbare Wendungen der Alltagssprache allein Goethes Faust entstammten. Was für eine Fundgrube! So herrlich waren viele der Formulierungen, so treffend, so leicht über die Zunge ins Freie perlend, dass ihnen im Laufe der Jahre Flügel gewachsen waren! Eines von Barbaras Lieblingsbüchern, abgegriffen, zerlesen und mit hundert handschriftlichen Anmerkungen versehen, war deshalb Georg Büchmanns „Geflügelte Worte und Zitatenschatz“.
Auch Wörter auf Wanderschaft zwischen den Sprachen konnten sie in Entzücken versetzen. Da interessierte sie sich auf einmal auch für historische Zusammenhänge. Wenn ihre Oma zum Beispiel sagte: „Mach’ keine Fisimatenten!“ und man vermuten durfte, dass diesen Spruch kein Deutscher erfunden hatte, spürte sie pures Entdeckerglück, wenn sie auf den französischen Ursprung stieß: Es hieß, Napoleons Soldaten hätten versucht, die Mädchen im Rheinland und in Westfalen, vermutlich aber eher die munteren rheinischen, mit dem Lockruf Visitez ma tente! in ihre Zelte zu locken.
Eine fast sentimentale Hinwendung hatte Barbara zu den aussterbenden Wörtern. Sie nutzte sie, so oft es ging – so wie man mit dementen Menschen, so lange die Situation es zulässt, noch normal redet –, und sagte dann bei einer Diskussion im Deutsch-Unterricht so etwas wie „Das ist doch müßig.“ „Müßig!“ echote dann der Klassenclown, den es in weiblicher Form auch in Barbaras Klasse gab, während die Mitschülerinnen Barbara anschauten wie die Biologielehrerin ein bizarres Insekt, „müßig!“ – „Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt“, sagte darauf der Deutschlehrer, der die Liebe zu den aussterbenden Wörtern teilte.
Das Sterben war ja insgesamt ein Vorgang, der – wie alle Vorgänge, über die nicht gern gesprochen wird – eine gewisse Faszination ausübte, und er wurde besonders interessant, wenn man hörte, welche Worte sprachmächtige Menschen in ihrer letzten Stunde gesprochen hatten. Völlig begeistert stieß Barbara eines Tages auf ein Buch mit „Letzten Worten“. Ihr Liebling darin war Heinrich Heine, der auf seiner Pariser Matratzengruft gesagt haben soll: Dieu me pardonnera; c’est son métier, Gott wird mir verzeihen; das ist sein Beruf. Das war besonders schön, weil man ja, wie Barbara wusste, eigentlich spätestens in dieser Situation seine Sünden zu bereuen hatte.
Besonders liebte Barbara Gedichte. Sie mussten sich nicht unbedingt reimen. Hölderlins Zeilen „Weh mir, wo nehm’ ich, wenn es Winter wird, die Blumen“ brachten sie zum Weinen, Heine bewunderte sie für sein Fräulein am Meere, das so lang und bang seufzte, weil der Sonnenuntergang es so sehr schmerzte, Shakespeare verehrte sie für die Perfektion seiner Sonette. Sie sammelte auch Schüttelreime und Limericks und schrieb auch selbst welche. Wenn sie das Programm von WDR 3 liebte, dann auch deshalb, weil sie ihm eines der schönsten Fundstücke ihrer Schüttelreim-Sammlung verdankte:
Das Zimmer sich mit Helle füllt; die Dame sich in Felle hüllt. Und wenn dann erst die Hülle fällt, ist nichts mehr, was die Fülle hält.
Wilhelm Busch, dessen gesammelte Werke im Wohnzimmer ihrer Eltern standen, kannte Barbara auswendig. Ein Leben lang dienten seine treffsicheren, geistreichen Alltagsbeobachtungen ihr als stets verfügbarer Fundus für spontane Tischreden, wenn etwa eine Feier zu langweilig zu werden drohte – was bei Familienfeiern die Regel war. So zitierte sie bei der Konfirmation eines Patenkindes ein paar Zeilen aus der Frommen Helene:
Helene, sprach der Onkel Nolte, was ich schon immer sagen wollte: Ich warne dich als Mensch und Christ. O hüte dich vor allem Bösen!
Es macht Genuss, wenn man es ist.
Es macht Verdruss, wenn man’s gewesen.
Manchmal kopierte Barbara diese kecke Art, Verse zu schmieden. Jahre später, in der „Gesellschaft“ angekommen, liebte sie es, förmlichen Einladungen den heiligen Ernst zu nehmen, indem sie ihrem Präsent eine freche kleine Widmung beilegte. Kurios gereimt konnte man ja manches sagen, was in Prosa verletzend wäre – ähnlich wie ein Fluch im Dialekt akzeptabler war als einer auf Hochdeutsch. Über das bayerische „Ssaupreiss, japanischer!“ konnten die Leute lachen, über „Sie blödes Schlitzauge“ weniger.
Barbaras Eltern waren Mitglied im Bertelsmann-Buchclub, und das war ein Segen: Meist überließen sie es der Tochter, ein Buch aus dem neuen Katalog auszusuchen, weil man sonst das von der Redaktion vorgeschlagene zugeschickt bekam. Barbara spürte, dass die Eltern ihren Kindern zuliebe das Geld für die Mitgliedschaft im Buch- und auch im Schallplattenclub aufbrachten: Sie und ihr Bruder sollten „es einmal besser haben“, und dazu – das war den Eltern bewusst – kam es auf Bildung an.
Manchmal dachte Barbara, was wohl aus ihren Eltern geworden wäre, wenn sie zu einer anderen Zeit aufgewachsen wären, wenn sie Abitur hätten machen und studieren dürfen. Und sie war sich der Verpflichtung bewusst, die sich aus der Gnade der Geburt zu einem günstigeren Zeitpunkt ergab – nach einem verheerenden Krieg und nach den Hungerwintern, mitten in das Wirtschaftswunder hinein. Da durfte man die Eltern nicht enttäuschen.
So bescheiden die Brinkmanns auch lebten, mit Vater Rudolf als „mittlerem Beamten“, so sehr musste man die Einstellung der Familie, was die Bedeutung der Bildung anging, doch als elitär bezeichnen. Mutter Hildegard, die nur ungern verkürzt als „Hilde“ angesprochen wurde, war da so ganz anders als ihre jüngere Schwester Helga, die alles verfügbare Geld für Kleider ausgab und ihre kleine Tochter wie eine Prinzessin ausstaffierte. Hildegard dagegen nähte selbst. In der Küche – einen anderen Raum zum Nähen hatte sie nicht – stand ein schwarzes Eisengestell mit einer Art Tischplatte, in die man einen hölzernen Koffer versenken konnte. Klappte man den Koffer nach oben heraus, stand auf einmal eine Nähmaschine auf dem Tisch.
Um nähen zu können, musste man zunächst für zwei Fäden sorgen: Der Oberfaden kam aus einem Garnröllchen oben auf der Maschine und wurde um ein paar Halterungen herum nach unten geführt, um dort in eine nach unten stechende Nadel eingefädelt zu werden. Der Unterfaden kam aus einem kleinen Verlies unter dieser Nadel, in das man eine silberfarbene Hülse einer zuvor aufgespulten zweiten Garnrolle steckte. Hatte man alles richtig gemacht, sah man unter dem „Füßchen“, das der oberen Nadel Halt gab, beide Fäden liegen.
Angetrieben wurde die Nähmaschine durch ein Pedal. Das durfte man aber erst, und zwar behutsam startend, einsetzen, nachdem man das Handrad neben der Maschine als Anlasser benutzt hatte. Zu viel Kraft auf einmal, und der Faden riss oder die Fäden verhakten sich, und man konnte noch einmal von vorn anfangen.
Barbara bewunderte dieses Möbel mit seinem kreativen Innenleben – weniger wegen der Technik, sondern wegen der wertigen Optik seines schmiedeeisernen, glänzend schwarzen Gestells. Wenn Mutter daran saß und nähte und wie eine Klavierspielerin kunstvoll das Pedal bewegte, machte das dezente Surren ein betörendes Geräusch; eigentlich war es Musik. An ein richtiges Klavier war in dieser Familie nicht zu denken. Es fehlte an Platz und vor allem an Geld.
Als Barbara deshalb mit der Idee kam, dann doch bitte Geige lernen zu wollen, sagten die Eltern: In Gottes Namen! Eine Geige war nicht so platzgreifend, und kostenlos ausleihen konnte man ein solches Instrument auch. Doch die Freude war nicht von langer Dauer. „Das hält ja keiner aus“, beklagte sich Barbaras Bruder. Und selbst die Nachbarn, die noch nie ein böses Wort über Barbara gesagt hatten, beschwerten sich. Die Wohnungen, typische Nachkriegsbauten, waren in der Tat hellhörig.
Hildegard Brinkmann pflegte nicht nur die selbst genähte, sondern sämtliche Kleidung mit Hingabe. Dabei ging es ihr nicht nur um den Werterhalt. In heutigen Ohren mag das merkwürdig klingen; aber so Kräfte zehrend die monatliche „Große Wäsche“ auch war, so sehr fühlte diese für einfache Arbeiten eigentlich überqualifizierte Frau sich doch hinreichend belohnt, wenn sie sauber gewaschene Bettwäsche, Unterwäsche und Kleidung auf die Leinen hängen konnte. Richtig glücklich machte sie das im Sommer, wenn die Teile weiß und fröhlich schlagend im Wind flatterten, weniger im Winter, wenn sie mit steif gefrorenen Fingern vom Dachboden kam. So oder so aber waren dies die Tage, an denen die immer „wie aus dem Ei gepellte“ Frau, bei der man, wie ihre Schwester Helga spitz bemerkte, „vom Boden hätte essen können“, eine Frau, die sonst eher distanziert war, ihre Geselligkeit entdeckte. Denn dann saß sie mit den Nachbarinnen, die sich gegenseitig halfen, nach getaner Arbeit bei Kaffee und Kuchen und holte danach sogar noch den Likör hervor. Mit einer der Nachbarinnen war sie sogar „per du“: mit Doris.
Am beliebtesten waren der Eier- und der Kaffeelikör. Barbara, die bei solchen Gelegenheiten den Tisch deckte und auch wieder abräumte, erlebte dann eine ganz andere Mutter als die, die kühl die Katholische Frauengemeinschaft abblitzen ließ. „Ich gehe doch nicht an Haustüren betteln“, hatte Hildegard Brinkmann gesagt, als die frommen Damen sie aufforderten, bei der Adveniat-Kollekte mitzumachen. Für sie musste es reichen, wenn sie und ihr Mann selbst etwas in den „Klingelbeutel“ taten.
Auch das Bügeln schätzte die Mutter. Gleich nach dem Frühstück machte sie sich über Berge von Wäsche her, von der das eine oder andere Stück durchaus auch ohne vorherigen Kontakt mit dem Bügeleisen hätte angezogen werden können, und hörte während der dampfenden und zischenden Tätigkeit mit Vorliebe „Schulfunk“. Dafür, dass sie nur einen Volksschulabschluss hatte, war Hildegard Brinkmann erstaunlich breit gebildet. Es wunderte Barbara nicht, von einem Onkel zu hören, dass ihre Mutter – gleichauf mit einer späteren Schwägerin – die beste Schülerin ihrer Klasse gewesen war.
Aufmerksam und zuverlässig korrigierte Hildegard Brinkmann in der Sprache ihrer Kinder, deren Kontakt zu „falsch sprechenden“ Kindern sie weniger schätzte, jeden grammatikalischen Fehler. Wenn etwa der kleine Bernd das von ihm gehasste Gedicht von den zwei Schwestern aufsagte und mit anklagender Kinderstimme sprach: „Die Adelheid trank roten Wein, den Käthchen schenkt sie Wasser ein“, dann geschah das zwar zum Vergnügen aller Zuhörer, hatte aber stets die Korrektur der Mutter zur Folge: „dem Käthchen, Bernd, dem Käthchen!“
Manchmal wusste Barbara nicht, ob der kleine Teufel nicht absichtlich den falschen Akkusativ setzte. Grund genug, sich zu rächen, hatte er: Er war Linkshänder und hatte das Pech, in einer Zeit aufzuwachsen, als die Lehrer noch versuchten, Kindern solche „Eigenheiten“ auszutreiben. Da musste er dann vor der Klasse an der Tafel stehen und als unfreiwilliges Demonstrationsobjekt dafür dienen, wie viel „intelligenter“ es doch sei, die „schöne“ rechte Hand zu benutzen, weil man ja sonst beim Schreiben von links nach rechts die Kreide-Buchstaben verwische.
Auflehnen müssen hätten sich die Eltern, Partei ergreifen für den Sohn, statt sich die Lehrersicht einer defizitären Veranlagung des Kindes zu eigen zu machen, dachte Barbara später. Aber das war in einer anderen Zeit, einer Zeit, in der es sowieso egal war, ob man mit rechten oder linken Fingern auf Tasten tippte oder Felder berührte; eine Zeit aber auch, welcher der Sinn für die Stil bildende Wirkung einer schönen Schreibschrift abhanden gekommen war, einer Zeit, die nicht mehr sehen wollte und konnte, welche kreative Kraftquelle Menschen verlieren, die nur noch tippen und nicht mehr schreiben.
Barbara wuchs auf in einer Zeit der Naivität und der Poesie-Alben, welch letzteren die meisten ihrer Mitschülerinnen immerhin den einzigen freiwilligen Kontakt zu gebundener Sprache verdankten. Die meist stoff- oder lederbezogenen Bücher mit ihren gepolsterten Deckeln, die mit Gedichten und Sinnsprüchen zu füllen waren und von denen die teureren Exemplare Schlösser hatten, wurden der Reihe nach an alle gereicht, die einem nicht allzu unsympathisch waren und von denen zu vermuten war, dass sie den kostbaren Besitz weder mit Fettflecken noch mit Eselsohren verunzieren oder ihn gar verbummeln würden. Denn ein volles Poesie-Album war eine Trophäe, besonders dann, wenn auch viele Lehrer-Einträge darin standen.
Nicht dass die Beiträge der Lehrer immer besonders geistreich gewesen wären, bedienten die armen Opfer der kindlichen Sammelwut, die zum Glück ausschließlich die Mädchen erfasst hatte, sich doch gern abgegriffener Weisheiten eines Lao Tse oder sonstiger fernöstlicher, von Fall zu Fall auch antiker Denker oder bemühten, wenn die Besitzerin des Albums ihnen wenig bedeutete, den Joker-Spruch, der immer ging: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“
Immerhin waren die Lehrersprüche zu jener Zeit stets sauber und fehlerfrei geschrieben, und selbstredend waren sie meilenweit entfernt von jenem Lieblingseintrag aller mäßigen Schülerinnen, bei dem meist sämtliche i-Punkte als blutrote Herzen hervorgehoben waren und die Buchstaben, unten eckig ausgeformt, nach links kippten: „Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.“
Die herzförmigen i-Punkte, von ihren Schöpferinnen als Schmuck gedacht, waren so etwas wie in späteren Jahrzehnten die aufgeklebten Tattoos von deren Enkeln: eher Psychogramme.
Zu den Mädchen mit den blutroten Herzen, die in diesem Fall obendrein nach innen gebogene Konturen und eine schwarze Außenlinie hatten, gehörte auch Angela mit der Blümchenhaarspange, die gern erzählte, dass sie sämtliche Karl May-Bände besaß – die mit Winnetou und Old Shatterhand genauso wie die mit Hadschi Halef Omar. Ja, sie konnte sogar, obwohl sie sich sonst mit dem Lernen schwer tat, den kompletten Namen Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah auswendig sagen. Und sie ließ gnädig erkennen, dass sie die Karl May-Bücher gegebenenfalls ausleihen würde.
Bis sie wegen zu schlechter Leistungen die Schule verlassen musste, saß Angela fast ein Jahr lang in der Klasse eine Bank vor Barbara, im Sommer in geblümten Rüschenkleidern und im Winter in Angora-Pullovern. Wenn der Unterricht langweilig war, und das war er für Barbara oft, ging von diesem Material, dessen Fädchenflor sich in der Heizungsluft wie ein Gräserfeld in der Sommerbrise bewegte, der große Reiz aus, heimlich etwas davon abzuzupfen und es zu handflächengroßen, platten, weichen Lesezeichen zu verarbeiten.
Bei einem von Angelas Pullovern, gestrickt aus feinster Wolle in gemischten Farben, war die Verlockung, daraus kleine Kunstwerke aus dem Spektrum zwischen Rot und Grün zu gestalten, schlicht unüberwindlich. Da Barbara ihr im Mathe-Unterricht beim Oberstudiendirektor nachgab, bei dem sie als Klassenbeste und Klassensprecherin eine Art Malefiz-Guthaben hatte, war der rotgrüne Angora-Pullover am Ende zumindest auf Angelas für Barbara gut erreichbarer rechter Schulter schon etwas kahler als auf der linken, als der Schulleiter ihr dann doch einen missbilligenden Blick zuwarf. Eine Strafe bekam sie nicht. Endlich hatte Barbara etwas zu beichten.
Mit dem Beichten, wenn sie denn katholisch gewesen und hingegangen wären, hätten andere Mädchen es leichter gehabt. Nur kurz zur Klasse gehörte eine Schülerin, deren Eltern es aus Hannover ins Ruhrgebiet verschlagen hatte. Sie war deutlich älter als der Schnitt, weil sie angeblich früher schon einmal eine „Ehrenrunde“ gedreht hatte und nun bereits zum zweiten Mal eine Klasse wiederholte.
Sie hieß Gabriele, war groß gewachsen, sah schon recht fraulich aus und fiel dadurch auf, dass auf ihren Augen dicke schwarze Balken lagerten. Das waren Lidstriche. „Pass auf, gleich fallen dir die Klüsen zu!“, pflegte die Frau Doktor mit dem Klumpfuß zu Gabriele zu sagen, wenn die nicht schnell genug auf Fragen der Geschichtslehrerin antwortete.
Aber Gabriele hatte andere Dinge im Kopf. Sie ging mit Jungen aus, und sie hatte einen „festen Freund“. Das fanden die anderen Mädchen ungeheuerlich, auch wenn sie alle gern zu den Stehtischen mit den Oberstufenschülern vom benachbarten Jungengymnasium hinüberschielten, wenn man sich nach Schulschluss „bei Tchibo“ traf. „Guck mal“, sagte dann die Birgit mit dem frechen Igelhaarschnitt, die ihren einer nicht korrigierten Hüftgelenksluxation geschuldeten hinkenden Gang dadurch kompensierte, dass sie den Klassenclown gab, „da kommt der blöde Huxelmeier!“ Alle lachten, denn der Huxelmeier war zwar groß gewachsen, aber auch ein wenig linkisch, und man konnte ja nicht ahnen, dass er eines Tages Professor der Astrophysik und Birgits Ehemann sein würde.
Dumm war die Birgit keinesfalls, und ihre Behinderung sollte spätestens kurz vor dem Abitur durchaus auch Vorteile haben. Da war sie, nachdem auch sie einmal sitzengeblieben war, nämlich schon volljährig und hatte wegen ihrer Beschwerden beim Gehen als einzige in der Schule bereits den Führerschein und sogar ein eigenes Auto. Einen Fiat 500 zwar nur; aber wenn man keine Dicken mitnahm, passten sechs Mädchen hinein. So konnte man sich, wenn man zu Birgits Freundeskreis gehörte, zum ersten Mal im Leben erwachsen und trotz der Enge in dem kleinen Auto frei fühlen.
Birgit war auch großzügig, denn an Taschengeld mangelte es ihr nicht. „Für fünf Mark einmal volltanken“, scherzte sie gern an der Tankstelle. Und Barbara revanchierte sich durch einen großen Eisbecher bei Di Maggio, der ersten italienischen Eisdiele der Stadt. Besonders lecker, aber leider auch am teuersten von allen, war der Amarena-Becher mit den dicken, schwarzroten, bissfesten Kirschen. Doch Barbara konnte sich das leisten, denn sie hatte zwar niemals Taschengeld bezogen, aber durch ihre Lehrer eine ganze Reihe von Nachhilfe-Schülern vermittelt bekommen, denen sie – je nach Defizit – Latein-, Englisch-, Französisch- oder auch Mathe-Unterricht gab.
Das brachte gutes Geld; vor allem aber brachte es Einblicke in Barbara bis dahin unbekannte großbürgerliche Welten. Eine Schülerin, Friederike, genannt Fritzi, war die einzige Tochter des Direktors der örtlichen Gussstahlfabrik, und sie wohnte in einer weißen Gründerzeitvilla mit einem Klingelschild aus Messing. Wenn Barbara zum Nachhilfe-Unterricht zu Fritzis Haus ging und auf den glänzenden Knopf drückte, dachte sie immer, dass sie auch gern einmal ein Messingschild mit ihrem Namen hätte, bevor ihre Gedanken von einem lauten Bellen unterbrochen wurden. Es war der Hund, ein Rauhaardackel, denn Fritzis Vater war Jäger, wovon schon in der Eingangshalle ausladende Hirschgeweihe zeugten. Offensichtlich hatte der Herr des Hauses, den Barbara nie zu Gesicht bekam, all die armen Viecher auf dem Gewissen.
Fritzis Mutter dagegen bekam Barbara sehr wohl zu Gesicht. Die liebte es nämlich, bei den Latein-Sitzungen dabei zu sein. Damals gab es den Ausdruck Helikopter-Eltern noch nicht; aber diese Frau war der Inbegriff einer Helikopter-Mutter. Eigentlich hätte Barbara es sogar gemocht, dass die Frau die ganze Zeit dabei saß, denn so konnte sie demonstrieren, dass ihre Leistung wirklich jede Mark wert war. Doch war sie verunsichert wegen der zarten Porzellan-Tässchen mit den aufgemalten Röschen, in denen der Tee serviert wurde, denn die hatten recht unhandliche Griffe und ihre zierlichen gebogenen Füßchen fanden in den glatten Untertässchen keinen Halt. Barbara wusste nicht, dass das Meißner Porzellan war, denn zu Hause waren die teuersten Tassen die cremefarbenen mit dem Goldrand, die aber nur an Festtagen hervorgeholt wurden; sie ahnte aber, dass die Tassen teuer waren, und hasste es, so zu tun, als sei sie den Umgang mit solchen Kostbarkeiten gewohnt, was Fritzis Mutter selbstredend unterstellte: Wie hätte dieses Mädchen auch in der Schule so gut sein können, wenn sie nicht aus einem großbürgerlichen Elternhaus stammte!
Als Weihnachten vor der Tür stand und Fritzi es in Latein von einer Vier auf eine Drei geschafft hatte, überreichte Fritzis Mutter der erfolgreichen jungen Nachhilfe-Lehrerin neben ihrem normalen Lohn ein Geschenk. Es war klein und offensichtlich zerbrechlich. Man konnte fühlen, dass sich unter dem geprägten Lackpapier mit der dicken Seidenschleife mehrere Lagen Seidenpapier befanden. „Für dich, zum Fest“, hatte Fritzis Mutter in einem feierlichen Ton gesagt, als sie Barbara beim Abschied das Päckchen übergab. „Ich werde es erst Heiligabend auspacken“, hatte Barbara erwidert, denn sie wollte sich beim Auspacken nicht zuschauen lassen. Das war gut gewesen, denn als sie, kaum außer Sichtweite, das Päckchen neugierig öffnete, konnte man ihr die Enttäuschung ansehen.
Hervor kam ein schlichtes weißes Porzellan-Schälchen, keine zwanzig Zentimeter im Durchmesser, versehen mit zwei Griffen, die geformt waren wie Kordeln. Hilflos drehte Barbara das Ding um und sah am Boden einen verschwommenen blauen Strich. Ausschussware?, argwöhnte sie gekränkt und stellte das Schälchen zu Hause in die Vitrine zu Omas Sammeltassen.
Später, als sie anfing zu studieren und ihre erste eigene Wohnung bezog, nahm sie das Schälchen jedoch mit und füllte es, wenn sie Besuch bekam, mit Knabbereien. Einmal bewirtete sie eine frühere Lehrerin, die ihr ein Kummerkind in Sachen Französisch ans Herz legen wollte. Die Frau imponierte Barbara, denn sie fuhr ein Cabrio mit dem Schriftzug Karmann Ghia, das nicht nur bei offenem Dach eine schöne Silhouette hatte.
„Sieh an“, sagte die Ex-Lehrerin, als sie ein Plätzchen aus dem Porzellan-Schälchen naschte, „das ist ja KPM!“ Barbara tat so, als würde sie verstehen, und sagte nur trocken: „Ja, das habe ich von der Mutter einer Latein-Schülerin bekommen.“ Googeln konnte man damals noch nicht. Aber Barbara hatte inzwischen gelernt zu recherchieren und nahm die Bemerkung zum Anlass, sich mit den Signets berühmter Porzellanmanufakturen vertraut zu machen. Dies also war das Signet der „Königlichen“, die alle Teile mit dem kleinen blauen Zepter handsignierten – unter der Glasur und darum so verwaschen wirkend.
Wären die Klassenkameradinnen und die Nachhilfeschülerinnen nicht gewesen, hätte Barbara in so jungen Jahren niemals Kontakt zu einer großbürgerlichen Welt bekommen. Ihre Verwandten waren zwar alle ehrbare Leute, Handwerker und Handwerksmeister und kleine und mittlere Angestellte und Beamte; aber studiert, und zwar Medizin, hatte einzig der Bruder eines angeheirateten Onkels, der sich bei Familienfeiern immer über die „Spießer-Verwandtschaft“ lustig machte und eine Zigarette nach der anderen rauchte, bis er – noch recht jung – an Lungenkrebs starb.
Auch in Barbaras zweitem großen Umfeld, der katholischen Kirche, tummelten sich eher einfache Leute. Die wussten zwar alle, dass die Heilige Barbara die Schutzpatronin der Bergleute war; aber nach den Patronen anderer Berufe hätte man sie nicht fragen dürfen. Vielleicht gab es ja gar keine Schutzpatrone für Akademikerberufe, dachte Barbara. Und vielleicht nahm die Neigung, an die Wirkmächtigkeit solcher Gestalten zu glauben, auch mit dem Grad der Bildung ab.