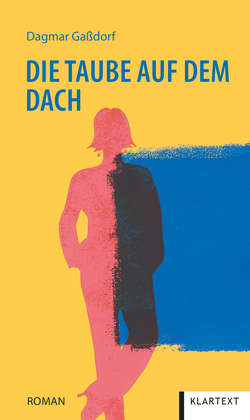Читать книгу Die Taube auf dem Dach - Dagmar Gaßdorf - Страница 7
Die Kommunion
Оглавление„Ich krieg ein Perlo-Pettiko.“ Es gibt Sätze, die lange vergangene Szenarien auf einen Schlag lebendig werden lassen. Für Barbara war dies so ein Satz. Die Erinnerung an ihn war verbunden mit der sich leicht überschlagenden Stimme von Monika, die von ihrem Kleid für ein Ereignis sprach, das sie ihre „Kommion“ nannte, das aber offiziell „Erste Heilige Kommunion“ hieß. Monika wohnte in einem der hölzernen Behelfshäuser am Weg zur gemeinsamen Volksschule. Warum die Siedlung „Bukowina“ genannt wurde, wusste Barbara nicht; aber sie freute sich über dieses erstaunlich melodische Wort für ein Ambiente, in dem ein Kamm mit Haaren auf dem Esstisch lag.
Ihr eigener Vorname gefiel Barbara nicht sonderlich. Gegen die Heilige der Bergleute konnte man zwar prinzipiell nichts haben, nachdem einer ihrer Großväter „unter Tage“ gewesen war; aber die banale Phonetik musste man nicht mögen. Wenn irgendwo auf der Welt ein Kind seine ersten Wörter brabbelt, klingt das immer wie mama oder baba oder so ähnlich. Die Bildung von Verschlusslauten mit beiden Lippen, die beim Öffnen nach dem Saugen an der Brust fast automatisch einer Art „a“ Platz machten, war vermutlich die simpelste aller Lautbildungen.
Barbara hatte einen Sinn für so etwas, und es wundert einen nicht, mit welchem Vergnügen sie später lernen sollte, dass es genau diese Lippen-Verschlusslaute sind, die in allen Sprachen der Welt vorkommen und von allen Kindern als erste gelernt werden und die allen Menschen, die ihre Sprache verlieren, als letzte verbleiben.
Der Bergbau-Opa, der in seinem Leben vermutlich am wenigsten damit gehadert hatte, wie er getauft worden war, Hinrich nämlich, war aus dem hohen Norden an die Ruhr gekommen: aus Husum. Innerhalb der westfälisch-katholischen Verwandtschaft war er vermutlich der einzige, dem die Heilige Barbara und alle anderen Heiligen und die gesamte praktizierte Frömmigkeit egal waren. Zur Kirche ging er jedenfalls nicht. Ob die Urgroßmutter, die nach den Erzählungen von Barbaras Mutter einen Hausaltar in ihrem Schlafzimmer hatte, an dem sie bei Gewitter Kerzen anzündete, den Schwiegersohn aus der grauen Stadt am grauen Meer gutgeheißen hatte? Darüber war in der Familie nie geredet worden. Das war tabu.
Ein merkwürdiges Wort, dachte Barbara. Mit seiner Betonung auf der zweiten Silbe stellte es sich quer zum Sprachfluss des Deutschen. Hätte man damals schon googeln können, hätte sie es getan und dabei gefunden, dass ein Seefahrer aus Thomas Cooks Team es im 18. Jahrhundert aus Polynesien importiert hatte, wo die Leute etwas, was heilig und unberührbar ist, als „tapu“ bezeichnen. Das konnte für Orte gelten, die man nicht betreten darf, aber auch für Sachen, die man nicht essen darf. Eigentlich auch nicht anders als Fleisch, das am Freitag verboten war, fand Barbara, in deren Familie es dank dieser katholischen Marotte wenigstens einmal in der Woche das gab, was heute sowieso als gesünder gilt: Fisch.
Kuriose Wörter für kuriose Sachen faszinierten sie. Und das hier war kurios! Man wusste schließlich nicht, woher die Tabuverbote kamen und warum es sie gab, aber dass die, die sie befolgten, sie für selbstverständlich hielten. Es machte daher gar keinen Sinn zu fragen, warum denn der eher heidnisch wirkende Opa in eine Familie einheiraten durfte, die nach den Worten einer späteren Freundin von Barbara „Weihwasser pinkelte“.
Man wusste überhaupt wenig über den Nordmann mit dem kantigen Kopf, denn er sprach wenig. Man fragte sich auch, was seine für eine Westfälin verblüffend lebensfrohe, rundliche, kleine Frau mit den Silberlöckchen an ihm gefunden hatte. Tatsache war, dass er es schweigend hinnahm, wenn sie zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten die gesamte Großfamilie bis hin zu den Verlobten der Enkelkinder in ihrer dafür eigentlich viel zu kleinen Wohnung versammelte und, von ihren Töchtern unterstützt, bekochte. Nur so viel stand fest: Nie wieder in ihrem späteren Leben, auch nicht bei so genannten Sterneköchen, sollte Barbara eine so traumhafte Rindfleischsuppe mit Eierstich und Markklößchen genießen und eine Bratensoße, für die man sogar den butterzarten Braten hätte stehen lassen. Tatsache war auch, dass der Opa es nicht merkte, wenn seine Frau ihn austrickste oder – wie Barbaras Mutter es konspirativer ausdrückte – „zu nehmen wusste“.
Wenn man im Ruhrgebiet chronisch krank ist, hat es man immer „an“ irgendetwas. Und dieser Opa hatte es „am Magen“. Er legte deshalb Wert darauf, keine Butter, sondern Margarine zu essen. Der Oma, für die „gute Butter“ getreu dem berühmten Kochbuch der Westfälin Henriette Davidis mit dem Titel „Man nehme“ für schmackhafte Speisen der unübertroffene Geschmacksträger war, passierte es schon einmal, dass sie, wenn sie anlässlich von deren „großer Wäsche“ zusammen mit ihrem Mann die Tochter Hildegard besuchte, um auf deren Kinder aufzupassen, die Margarine vergaß. Denn auf die Idee, seine Sachen selbst zu packen, wäre zu jener Zeit kein Ehemann gekommen; das galt als Frauensache. Tochter Hildegard kaufte aber keine Margarine. Sie schmeckte ihr nicht, und sie mochte auch keine bunten Becher auf dem Tisch; aus dem Becher heraus bekam man die Margarine aber nicht ohne Verlust. Die Oma dachte aber gar nicht daran, die Enkel zum Konsum zu schicken, um Margarine zu kaufen, wenn doch Butter im Hause war. Sie nahm vielmehr die Butter, ließ sie etwas weich werden und strich sie, die Enkel zu strengstem Schweigen verpflichtend, in ein Plastikgefäß mit Deckel, das von der Form her einem Margarinebecher glich. Der Opa hat es nicht bemerkt; aber die Enkelkinder hatten einen „Heidenspaß“, wie die Oma das nannte – ein Wort, von dem zu vermuten steht, dass es inzwischen genauso verboten ist wie der Negerkuss und der Sarotti-Mohr.
Dass die Eigenheiten des Opas seiner Akzeptanz in der Familie keinen Abbruch taten, war besonders nach dem Tod seiner Frau einer stattlichen Knappschaftsrente zu verdanken, die er wegen seiner Staublunge bezog. Denn „am Magen“ mochte er es nach eigener Überzeugung haben; doch „an der Lunge“ hatte er es tatsächlich. Das machte den Bergbau-Opa bei allen seinen Kindern und deren Familien trotz seiner allseits bekannten kommunikativen Defizite zum umworbenen Hausgenossen, besserte dieses Familienmitglied doch das Haushaltsbudget auf, ohne groß zu stören. Denn den überwiegenden Teil seiner Tage verbrachte der Opa auf der Küchen-Eckbank und las Zeitung.
Ob er, wenn er sonntags vormittags im feinen Zwirn und mit gebügeltem Hemd zum Frühschoppen ging, gegenüber seinen Kumpels in der Kneipe genauso wortkarg war, konnte niemand sagen. Die Welt der Bergbau-Veteranen war eine ganz eigene, in sich geschlossene. Eines Tages wären sie ohnehin alle „weg vom Fenster“ – eine Wendung, die der Neigung der Silikose-Geschädigten geschuldet war, zu ihren Lebzeiten am offenen Fenster nach Luft zu schnappen, bis sie irgendwann eben „weg vom Fenster“ waren.
Barbara würde vermutlich eine kräftige Lunge entwickeln, denn täglich ging sie zu Fuß zur Schule, zwei Kilometer hin und zwei Kilometer zurück. Näher gab es keine katholische Volksschule, und ein Bus oder gar eine Straßenbahn fuhr auf der Strecke nicht. Auf Wunsch der Mutter holte sie die am Wege wohnenden Klassenkameraden ab – im Fall der Monika aus der Bukowina vorgeblich aus Christlichkeit (schließlich gehörte es sich nicht, Leute zu verachten, weil bei ihnen Kämme auf dem Esstisch lagen), aber ehrlicherweise wohl wegen der Sicherheit, denn in der Gruppe zu gehen war für die Kinder immer noch besser als allein. Und die Kinder aus der Bukowina wussten sich zu wehren.
Am Wege wohnte nämlich auch Uwe, ein etwas älterer, sogenannter böser Junge mit einem ebenso „bösen“ Hund, der Freude daran hatte, vorbeikommende jüngere Kinder ohne erkennbaren Anlass zu quälen. Von Ludwig, den Barbara noch vor der Monika abholte und der von seiner verwitweten Mutter mit der strengen Hochsteckfrisur nur „Luckilein“ gerufen wurde, war in solchen Situationen kaum Hilfe zu erwarten.
Luckilein, ein sehr früh in die Höhe geschossener, dünner Junge, saß beim Abholen meist zusammengefaltet zu einem Häuflein Elend auf der Treppe zu seinem Kinderzimmer im ersten Stock. Im Winter hörte man ihn schon von draußen heulen, weil er spätestens im Angesicht der zweiten Schneeflocke seine schweren Skischuhe anziehen musste, denn dies war die Zeit, in der federleichte Funktionskleidung noch nicht erfunden war.
Auch Barbaras Bruder Bernd, zwei Jahre jünger als sie und zwei Klassen unter ihr, heulte gelegentlich aus Wut. Er aber besonders im Sommer, wenn Mutter Hildegard ihn nötigte, die ungeliebte kurze Lederhose anzuziehen. Bernd kam sich in dieser aus Bayern importierten Trophäe der Eltern, die sie aus ihrem ersten, in der Wirtschaftswunder-Euphorie gebuchten Urlaub mitgebracht hatten, vor wie ein Dorfdepp aus Oberammergau und fürchtete den Spott seiner kleinen Ruhr-Kumpel. Mit zornrotem Gesicht nahm er die Ohrfeigen hin, die er als Quittung bekam, nachdem er sich auf der Flucht vor Uwe an einem Stacheldrahtzaun einen Winkelhaken in das von Mutter mit Schuhcreme polierte Glanzstück gerissen hatte.
Bernd war insgesamt eher widerständig. Er war Linkshänder und hasste es, in der Schule als solcher vorgeführt zu werden. Er hasste es auch, am Sonntag neben der großen Schwester zum Kirchgang abkommandiert zu werden – morgens zum Hochamt unter dem strengen Blick der Eltern, die hinter den Kindern die lange Straße zur Kirche hinunter gingen, und nachmittags noch einmal zur Andacht mit der „Bohnenstange“ allein. Denn Barbara war schon früh in die Höhe geschossen, während Bernd immer noch der süße kleine Junge mit rundem Gesicht und Kulleraugen war.
Er war der hübscheste Messdiener, den sie in St. Blasius jemals gesehen hatten, und quittierte Sprüche wie „Fünf Minuten vor der Zeit ist Ministranten-Pünktlichkeit“ bei der Wandlung durch besonders lautes und heftiges Bimmeln mit der vierteiligen, glänzenden Messing-Glocke. Daran musste Barbara Jahrzehnte später denken, als ein Geschichtsprofessor in einem vornehmen Zirkel einmal genüsslich über die an der Ruhr geläufige Form der Beschimpfung im Akkusativ philosophierte: „Sie strubbeligen Messdiener, Sie!“
Im Hause Brinkmann war es verpönt, sich der Ruhrgebietssprache zu bedienen. Da hatte Mutter Hildegard ein strenges Ohr drauf. Da sie nicht studiert hatte, wusste sie zwar nicht, was der Unterschied zwischen einem Dialekt und einem Sozio-lekt ist; aber da aus ihren Kindern „mal was Besseres“ werden sollte, schien ihr „Komma“ doch besser als Bezeichnung für ein Satzzeichen geeignet denn als Verkürzung für „komm einmal“. In Bayern oder Schwaben, so dachte Hildegard Brinkmann, sprachen sie alle Bayerisch oder Schwäbisch, bis hin zu den Ministerpräsidenten; zu Hause aber, an der Ruhr, sprachen die erfolgreichen Leute Hochdeutsch. Es sei denn, sie seien zugezogen; dann durften sie auch als Chefs weiter ihren fremden Dialekt reden, und man fand das in Ordnung.
Die restriktive Einstellung der Mutter in diesen Dingen konnte Barbara aber nicht daran hindern, mit heimlichem Vergnügen Formen nachzuspüren, die in deren Kategorien eindeutig „Gossensprache“ waren, deren sprachliche Eleganz sie aber für die Mülltonne ebenso eindeutig zu schade machten. Nur laut aussprechen durfte man so etwas nicht; das gab Ärger. Und so dachte Barbara, als sie im Alter von zehn Jahren erstmals die sonst nur ihrer Mutter zustehende Ehre hatte, Heiligabend den Christbaum zu schmücken, und das Lametta und die Schätze („aber bitte nur die silbernen“) aus dem Seidenpapier barg: „Das ist für am Christbaum zu hängen.“ Sie hatte nämlich gerade angefangen, Englisch zu lernen, und war voller Bewunderung für Verkürzungen wie coffee to go; und da hatte diese verachtete Ruhrgebietssprache eine Konstruktion von vergleichbarer Virtuosität! Irgendwie war ihr das Ansporn, diese Tanne mit allen für am Christbaum zu hängenden Kerzen, Kugeln und Sternen, wenn auch wunschgemäß nur in Silber, zu einem Kunstwerk zu machen, dessen Glanz durch „Engelhaar“ den letzten Schliff bekam. Barbara wusste, dass Eitelkeit eine Sünde war; aber sie konnte sich nicht helfen: Dieser Baum würde noch schöner als der ihrer Mutter, und der konnte man ein Händchen in dekorativen Dingen nun wirklich nicht absprechen.
Da brauchte man nur auf die Geschenke zu sehen, die da bereits fertig verpackt lagen und ihre Wirkung nicht etwa dem Einsatz teuerster Papiere und Schleifen verdankten, sondern der fantasievollen Wiederverwendung von Materialien, die andere weggeworfen hätten: Stoffreste, Glöckchen von Schoko-Osterhasen, noch grüne Zweige vom ausgemusterten Adventskranz und so weiter. Eigentlich, so dachte Barbara später, als die grüne Bewegung aufkam, hätte die Mutter, die sie im Verdacht hatte, CDU-Anhängerin zu sein, grün wählen können. Was sie wirklich gewählt hat? Die Antwort auf diese Frage sollte Hildegard Brinkmann wie so viele andere mit ins Grab nehmen; darüber wollte sie nicht sprechen. Das war tabu.
Manchmal ist es gut, wenn Menschen etwas nicht mehr miterleben. Hätte ihre Mutter, so denkt Barbara heute, es verstanden, dass Menschen sich vor Google und anderen Fremden völlig entblößen? Wie sie kein Problem damit haben, dass es da einen Apparat in den USA gibt, der alles über sie weiß, wo es doch für Hildegard Brinkmann schon der Gipfel der Peinlichkeit gewesen wäre, sich nackt vor ihren Kindern zu zeigen? Schließlich hatte sie die Nazis erlebt und wusste, was es bedeutet, in einem System der Überwachung zu leben. Die Bequemlichkeit mit dem Verlust der Privatsphäre bezahlen – dieses Geschäftsmodell der modernen Welt wäre ihr vermutlich unheimlich gewesen.
Als die zehnjährige Barbara den Christbaum schmückte, musste sie solche schlimmen Gedanken noch nicht haben. Der schlimmste war noch, dass der Baum, so schön er sein mochte, bis Maria Lichtmess das ohnehin nicht allzu große Wohnzimmer der Brinkmanns beengen würde – zusammen mit der elektrischen Eisenbahn des Bruders, zu der sich aber in Wahrheit Vater Brinkmann jedes Jahr zu Weihnachten eine Erweiterung gönnte. Dass Märklin Spur H0 nicht für sie gedacht war, störte Barbara wenig; in Kreisen fahrende Züge interessierten sie nicht sonderlich. Sie würde lieber andere Weichen stellen. Etwa bei der Handhabung des Christbaums.
Während die Nachbarn ihre abgetakelten Bäume spätestens zu Heilige Drei Könige an die Straße warfen, musste der Brinkmannsche Baum bis Maria Lichtmess durchhalten. Das war der 2. Februar! Doch da half kein Protest, auch wenn man als die stets willfährige Tochter zum täglichen Wegfegen der Nadeln aufgefordert wurde. Nach dem Hantieren mit dem Kehrblech unterhalb des raumhohen Baumes fühlte Barbara sich mit den pieksenden Nadeln in der Strumpfhose wie eine Märtyrerin.
In gewisser Hinsicht, aber das wäre ein Gedanke zum Beichten gewesen, war die Mutter ein Tyrann. Und hätte das Gymnasium namens Schillerschule, das Barbara neuerdings besuchte, nicht nur des Dichters Namen getragen, sondern wäre ihm auch tatsächlich als Schillers Schule gerecht geworden, hätte sie vielleicht gegen diesen und anderen Irrsinn Widerstand geleistet. So aber war Barbara stolz, als Mädchen überhaupt aufs Gymnasium geschickt worden zu sein. Denn man „heiratete ja doch“. Die aus solchen Worten sprechende Vorstellung, Bildung sei Zeitverschwendung, wenn sie keinen geldwerten Vorteil bietet, hätte selbst die durchaus bildungsbeflissenen Eltern Brinkmann korrumpieren können, hätten die Volksschullehrer bei ihnen nicht den richtigen Nerv getroffen: den Stolz. Sie möchten ihre Tochter, appellierten sie an die Eltern Brinkmann, als mit Abstand Klassenbeste doch bitte unbedingt die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium machen lassen. Worauf der Vater, der sich sonst wenig zu grundsätzlichen Fragen der Erziehung äußerte, sich geschlagen gab mit den Worten: „Eine Fünf, und das war’s.“
Statt Fünfen wurden es bei Barbara dann eher Einsen. Was aber nicht zu besonderem Lob der Tochter führte oder gar zu Anerkennungen in Form von Taschengeld, sondern nur zwei Folgen hatte: dass Rudolf und Hildegard Brinkmann von „unserer Barbara“ sprachen, den Kopf draußen etwas höher trugen und „unsere Barbara“ dem jüngeren Bruder als Vorbild darstellten, worauf der gut hätte verzichten können und das auch sagte.
Es gibt zwar nicht viel Dümmeres, was wohlmeinende Eltern einem jüngeren Kind antun können; aber der Wille zum Aufstieg auf dem Umweg über die Kinder war nach den geplatzten eigenen Träumen durch eine Kindheit und Jugend unter den Nazis stärker als die Vernunft. Diese NS-Verbrecher, so empfand es Barbara, hatten noch Jahrzehnte nach ihrem Ende mehr auf dem Gewissen als all die vielen Toten. So richtig klar wurde ihr das aber erst, als ihr Vater Jahrzehnte später, wenn auch, gemessen an der statistischen Lebenserwartung, immer noch viel zu jung, an Krebs starb und zu ihr sagte: „Nun wein’ mal nicht; es ist ja ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe.“
Ein Wunder war es in der Tat. Denn er hatte als ganz junger Mann Kriegsdienst leisten müssen. Zwar musste er zu seinem Glück auf niemanden schießen, sondern war als Funker bei der Marine eingesetzt, aber er wäre beinahe zusammen mit der gesamten Mannschaft seines getroffenen Schiffes im Skagerrak abgesoffen. Noch immer hatte Barbara den abgeschlagenen Schneidezahn vor Augen, der an den Zusammenprall mit dem Schiffsrumpf im eiskalten Meer erinnerte. Sie ging bereits zur Schule, als der Vater den Zahn endlich hatte reparieren lassen; er gab das Geld lieber für die Kinder aus als für seine Schönheit.
Wenn Bernd als Messdiener agierte, waren Rudolf und Hilde Brinkmann stolz auf ihren Sohn; mit demonstrativem Interesse blieben sie im Kircheneingang stehen und studierten den Aushang mit dem Ministranten-Dienstplan, auf dem sein Name mehr als nur einmal stand. Aber die ganz große Genugtuung, die in der oft bemühten Wendung „unsere Barbara“ ihren Ausdruck fand, bezogen sie unverkennbar aus dem tadellosen Funktionieren ihrer Tochter.
Die sang im Kinderchor und durfte im Adventsgottesdienst „Maria durch ein’ Dornwald ging“ solo vortragen. Sie würde zudem nach bestandener Aufnahmeprüfung nicht nur als einziges Mädchen, sondern sogar als einziges Kind aus ihrer Volksschulklasse aufs Gymnasium wechseln, und jetzt stand auch noch ihre „erste heilige Kommunion“ bevor – ein Ereignis, das in der Familie wie eine Hochzeit vorbereitet wurde.
Die Verwandten würden alle kommen, man würde das Wohnzimmer leer räumen und mit einer riesigen Tafel bestücken und der Hausherr würde seiner Kochleidenschaft beim Zaubern von Büffetplatten freien Lauf lassen. Die Familie besaß nämlich seit geraumer Zeit einen Fernseher, und Rudolf Brinkmann ließ sich keine Sendung des unheilvollen Urmodells aller Fernsehköche namens Clemens Wilmenroth entgehen. Dabei war das, was der gelackte Typ anzubieten hatte, „Toast Hawaii“ und dergleichen, nichts im Vergleich zu dem, was Rudolf selbst zu zaubern imstande war. Dessen federleichte Schwäne aus Brandteig, aus denen weiße Federn aus steif geschlagener Sahne herausschwangen wie die Tutus in Schwanensee, waren nicht nur eine Gaumenfreude, sondern eine in der gesamten Verwandtschaft gerühmte Augenweide.
Für Bernd stellte sich lediglich die Frage, was häufiger fotografiert werden würde: besagte Schwäne, die Körbchen aus gefüllten Eiern und die Fliegenpilze aus Tomaten mit ihren Tupfen aus Mayonnaise oder Schwesterlein in ihrem die finanziellen Verhältnisse der Eltern strapazierenden bestickten Kommunionkleid samt Kränzchen im lächerlicherweise erstmals vom Friseur dauergewellten Haar.
Da saß sie: im Zentrum des von gestärkten Damastdecken bedeckten, blendendweißen, U-förmigen Tisches, ihr besonders von Onkel Manfred immer wieder im Foto festgehaltenes schönes Profil dem unvermeidbaren, ebenfalls mit Kränzchen herausgeputzten „Engelchen“ alias Cousine Sabinchen zugewandt.
Rudolf Brinkmann ging es vor allem um die Geselligkeit. Es war ihm einfach eine Freude, Gastgeber zu sein; da war ihm jeder Anlass recht. Aber Hildegard Brinkmann wollte ihre Kinder bei jeder Gelegenheit als die besten und schönsten sehen. Bei Bernd biss sie da auf Granit; darum sagte er auch, wenn diese Aufforderung erwartungsgemäß auf ihn zukam, partout nicht vor Gästen „die blöden Gedichte“ auf, und mochte die Mutter es hundertmal verlangen. Aber bei Barbara schaffte sie es, das Kind zu dem zu machen, was sie selbst gern gewesen wäre. Wie sie so artig war, so dienstbeflissen, so klug. Sie führte sogar solche Wünsche der Mutter aus, die diese noch gar nicht ausgesprochen hatte: Ein „Einer müsste mal …“ – und schon brachte Barbara den Müll hinunter, wusch ab oder was sie sonst an Schlussfolgerung pflichtschuldig aus den Worten der Mutter herausgehört hatte.
Bernd hasste diese Methode der Mutter, und er war wütend auf seine Schwester, weil sie funktionierte wie gewünscht und ihn dadurch zum Versager stempelte. Er war aber kein Versager; er wollte dieses Spiel nur nicht mitspielen. Einerseits tat es ihm gut, dass die Eltern, wenn sie von „unserem Bernd“ sprachen, ihm nicht anders als seiner Schwester eine Art Stempel der Akzeptanz aufdrückten; andererseits störte ihn die damit verbundene stolze Botschaft gelungener Erziehungsarbeit.
In den Monaten vor dem, was Monika aus der Bukowina die „Kommion“ nannte, drehte sich alles um dieses Thema. Unter den Mädchen war eine Art Leistungswettbewerb ausgebrochen, wer wohl das schönste Kleid hätte und wer die meisten und eindrucksvollsten Glückwunschkarten bekäme. Besonders begehrt waren die dicken Doppelkarten mit angehängten Kreuzen und geprägten goldenen Kelchen, über deren glänzende Rundungen man so wollüstig mit dem Zeigefinger streichen konnte.
Bei den Jungen interessierte eher, wer seinen Karten die höchste Geldsumme in Form von vorzugsweise braunen oder – besser noch – blauen D-Mark-Scheinen entnehmen konnte. Die schönen Bilder auf den Scheinen – ob Cranachs junger Mann auf dem Zehner oder Dürers Nürnberger Kaufmannsfrau auf dem Zwanziger – wurden dabei kaum wahrgenommen. Ganz wenige Kinder waren es, die später den Wunsch entwickelten, vielleicht doch einmal die Originalgemälde, die als Vorlage gedient hatten, in den Museen zu sehen. Vielleicht hätten sie ja wenigstens Lust auf die Burg Eltz oder den Limburger Dom bekommen, wenn die Ikone der Ritterlichkeit und der Stolz der deutschen Romanik nicht die Rückseiten von Scheinen geziert hätten, die sie nie in die Hand bekamen: der Fünfhunderter und der Tausender.
Den Kindern konnte man daraus keinen Vorwurf machen, war die Frage, wer seinem Glückwunsch wie viel Geld beifügte, doch auch den frömmsten Eltern wichtig. Es ging um einen Maßstab der Wertschätzung, bei dem das Tarifgefüge zu respektieren war. Undenkbar, dass ein Patenonkel weniger „springen ließ“ als ein Nachbar, der noch nicht einmal katholisch war, oder dass Verwandte, die zum Festessen eingeladen waren, weniger in den Umschlag steckten als solche, die nicht kommen konnten. Solche Fehltritte konnten den Gebern jahrelang nachgetragen werden.
Einem Tarifgefüge unterlagen auch die Fleißbildchen, die man im Kommunion-Unterricht bekam, kleine bunte Reproduktionen, meist von Sixtinischen und anderen Madonnen, die bei großer erdienter Menge das Gesangbuch unübersehbar aufblähten. Da Barbara von allen Kindern im Kommunion-Unterricht die meisten Fleißbildchen hatte, obwohl sie gar nicht in erster Linie fleißig war, sondern ihr das Lernen nur leicht fiel, trugen die Bildchen eigentlich den falschen Namen. Es konnte ja wohl nicht im Sinne des lieben Gottes sein, Leute für etwas zu belohnen, was sie völlig unverdient von ihm bekommen hatten.
Die Monika jedenfalls hätte so fleißig sein können wie sie wollte – nie hätte sie eine Madonna im Rosenhag bekommen. Sie würde später auch ihre eigenen Kinder noch zur „Kommion“ geschickt haben, wenn sie bis dahin nicht längst aus der Kirche ausgetreten wäre, um die Kirchensteuer lieber in eine „intrigierte Mikrowelle“ zu investieren oder sich „ein Visa“ für einen Urlaub in „Domrep“ zu besorgen.
Das größte Problem für normal fromme Kinder war die erforderliche Beichte, wenn man doch gar nicht gesündigt hatte. Barbara waren die vorgeschriebenen Formeln natürlich bekannt: „Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken.“ Aber dann sollte es ja konkret werden, damit man auch mit dem richtigen Maß an Buße aus der Düsternis des Beichtstuhls herauskam. Wie einfach es doch gewesen wäre, wenn man mal etwas gestohlen hätte! Oder jemandem ein Bein gestellt, so dass er hingeflogen wäre. Oder wenn man wenigstens gelogen hätte.
Irgendwie ahnte Barbara, dass man bei dem jungen Kaplan, der immer so rot wurde, am besten mit „unzüchtigen“ Gedanken hätte punkten können. Aber da hätten sie einem bitteschön einmal erklären müssen, was das ist. Die Eltern konnte sie so etwas nicht fragen, da hätte sie sich einen Tadel eingefangen; und ihre immer modisch gekleidete Patentante Helga, der sie am ehesten zutraute, dass sie die Antwort wüsste, weil sie aus der Kirche ausgetreten war und sich im Gegensatz zu ihrer Schwester Hildegard die Lippen schminkte, hätte nur laut gelacht und gesagt: „Was erzählen sie euch Kindern da für einen Blödsinn!“
Eine Sache wäre Barbara allerdings eingefallen; aber da genierte sie sich so, dass sie das doch besser für sich behielt. In der Siedlung, in der sie wohnten, gab es zwei Nachbarjungen, mit denen ihr Bruder manchmal auf dem Rasen hinter dem Haus Fußball spielte. Das Tor war die Teppichstange, über die, nachdem die festen Bodenbeläge sich durchgesetzt hatten, nur noch selten Teppiche zum Ausklopfen geworfen wurden. Es war an einem verregneten Tag, einem, der sich zum Fußballspielen nicht eignete, als Barbara in den Hausflur kam und die Stimmen von Bernd und seinen Freunden im Keller hörte. Sie öffnete die Tür zu den Kellerräumen und sah, wie die Jungen verschwörerisch die Köpfe zusammensteckten. „Komma, willste ma was sehen?“, rief einer aus der Gruppe und winkte sie zu sich.
Da ihr Bruder auch dabei war, stieg Barbara die Kellertreppe hinunter und folgte dem Jungen nach links in die Nische mit den Wasseruhren, in der sie kein Licht gemacht hatten, so dass ihre Augen sich erst einmal an das Dunkel gewöhnen mussten. „Pass auf“, sagte Timo, der älteste der Jungen, der damals dreizehn gewesen sein muss und nicht besonders gut in der Schule war, griff dann in seine Hose und holte ein ziemlich großes, fleischiges Ding heraus. Barbara stieß einen spitzen Schrei aus, floh aus dem Keller und hörte die Jungen immer noch brüllend lachen, als sie vor der Wohnungstür im zweiten Stock angekommen war.
Aber ob sie das beichten würde? Ihrem Tagebuch konnte sie das wohl anvertrauen, um es danach nicht nur mit dem kleinen Schlüssel zu verschließen, sondern gut zu verstecken. Schreiben ja; aber ob ihr das über die Lippen ginge?
Wenn Barbara später, als die Beichtstühle meist nur noch als merkwürdiges Mobiliar einer fernen Vergangenheit in den Kirchen herumstanden, hinter dessen Gittern und Gardinen nichts mehr passierte, eine katholische Kirche betrat, musste sie an diese Episode im Keller ihrer Kindheit denken. Die Leute beichteten zwar immer noch, dachte sie dann, aber in Fernsehsendungen und auf Internet-Plattformen. Auf Stufe eins des Exhibitionismus stellte man sich vor möglichst vielen Menschen mit Selfies bloß; auf Stufe zwei machte man sich vor Voyeuren mit tränenreichen Verfehlungen wichtig.