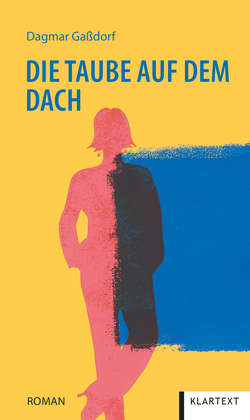Читать книгу Die Taube auf dem Dach - Dagmar Gaßdorf - Страница 9
Der Freund
ОглавлениеGrundsätzlich verbot sich Barbara unkatholische Gedanken; die Kirche war ihr schließlich ein wichtiges Stück Heimat. Wenn sie auf der Orgelempore stand und im Chor sang, tat sie es besonders gern, wenn in derselben Messe ein Junge vom Jungengymnasium im Einsatz war und die Lesung vortrug: Ludger. Er war nicht besonders groß gewachsen, hatte aber eine sonore, wohlklingende Stimme und nicht die Spur von Lampenfieber, war aber gleichwohl – das merkte man daran, wie er die Texte vortrug – klug und sensibel. Das zeigte sich auch in den Diskussionsrunden, die sie im Pfarrheim veranstalteten und zu denen Barbara die Plakate für den Schaukasten gestaltete. Auf einer Wallfahrt nach Chartres merkte Barbara, dass Ludger auch eine gewisse praktische Schläue hatte, denn mochte sein Französisch auch nicht perfekt sein, wusste er sich doch stets verständlich zu machen.
Ludger war ein richtig guter Kumpel, hilfsbereit, zupackend und mit guten Ideen. Ihm hatte Barbara es zu verdanken, dass sie, wenn auch erst mit sechzehn, Fahrrad fahren lernte. Hildegard Brinkmann hatte es stets zu verhindern gewusst, dass ihre Kinder Fahrräder bekamen. Ein schlimmer Rad-Unfall ihres Mannes, den der nur um ein Haar überlebt hatte, ganz am Anfang ihrer Ehe, als Barbara und Bernd noch sehr klein waren, hatte sie, die selbst niemals ein Fahrrad bestiegen hatte, die Drahtesel hassen und fürchten gelehrt. Indem man sie den Kindern vorenthielt, ersparte man sich zudem eine unnötige Geldausgabe.
Ludgers Mutter war da ganz anders. Schon als junges Mädchen war sie in ihrem deutschen Dorf in der Ukraine als erstes weibliches Wesen Fahrrad gefahren, und jetzt, nach einem langen Leben, geprägt von einer grausamen Flucht nach Westen mit kleinen Kindern, aber ohne Mann, weil der damals noch im Krieg war, besaß sie immer noch ein Fahrrad, das sie aber nicht mehr fuhr. Das bekam nun Barbara.
Ludgers Mutter trug den schönen Namen Emilia und war eine Frau mit einer bemerkenswerten Mischung aus eisernem Willen und großer Bescheidenheit. An ihr konnte Barbara studieren, was es bedeutete, fern der Heimat eine Sprache und Sitten zu bewahren. Da hatte diese Frau ihre ganze Kindheit und Jugend am Schwarzen Meer verbracht; aber sie kochte noch im hohen Alter „Grumbeere-Kiechle“, die sie auch genauso aussprach, denn ihre Vorfahren gehörten zu den Einwanderern aus dem deutschen Südwesten, die dem Ruf des russischen Kaisers gefolgt waren und kurz nach 1800 die von ihm gegründeten Kolonien in der heutigen Ukraine besiedelt hatten.
Mit Ludger ging Barbara in die Tanzstunde. Alle Mädchen ihrer Klasse gingen spätestens mit sechzehn in die Tanzstunde. Man lernte Standard-Tänze und Latein. Ludger war ein guter Tänzer: Er hatte viel Gefühl für Rhythmus und konnte, obwohl er nicht größer war als Barbara, gut führen. Und das war auch nötig, denn Barbara ließ sich eigentlich nicht gerne „führen“.
Trotzdem hatte sie viel Spaß, besonders beim Quickstep und bei der Rumba. Beim Quickstep, einem schnellen Foxtrott, konnte man, wenn man einen guten Tänzer hatte, quer durch den Saal fegen. Und die Rumba war, obwohl man keine enge Tanzhaltung hatte, wahnsinnig erotisch, besonders die zu der Musik von Maria Elena. Tango mochte Barbara weniger gern. Da war ihr der Mann zu dominant, und das wollte zu Ludger so gar nicht passen. Da hätte sie schon so einen Schlussball-Partner haben müssen wie ihre Freundin Heidi. Alex sah aus wie Robert Redford, nur dass er größer war. Alle Mädchen himmelten ihn an, und er genoss es, sie abblitzen zu lassen.
Barbara liebte es, wenn die Stunden vom Tanzlehrer und nicht von seiner Frau gegeben wurden. Während sie akribisch auf die richtige Schrittfolge achtete, vermittelte er vor allem die Freude an der Bewegung zur Musik. Und am Dasein als „Rampensau“. Das Wort sollte Barbara erst viel später lernen, als sie im Mediengeschäft war; aber ohne diesen Tanzlehrer wäre sie vielleicht gar nicht dort gelandet. „Jetzt kaufen wir die eine Seite des Saales ein!“, pflegte er lachend auszurufen, nachdem er sich eine gute Tänzerin zur Demonstration eines mitreißenden Quickstep geschnappt hatte, um nach der Wende zur Diagonale in die andere Richtung ebenso laut und fröhlich in die Musik zu tönen: „Und jetzt die andere!“ Es waren diese Worte, die Barbara später stets im Ohr hatte, wenn sie aufstand, um etwas zu präsentieren: „Und jetzt kaufen wir …“
„Schau mal, Dicke“, pflegte Heidi zu Barbara zu sagen, während sie sich mit der Handkante auf ihren flachen, harten Bauch trommelte, „so muss sich das anhören!“ Heidi war eine Sportskanone und ein Jahr älter als Barbara. Sie ging trotzdem in dieselbe Klasse, denn sie war wegen ihrer vielen Wettkämpfe, aus denen sie stets mit Siegerurkunden nach Hause kam, einmal „sitzengeblieben“ und ließ sich nun von Barbara bei Latein, Französisch, Mathe und anderen Fächern helfen. „Dicke“ sagte Heidi nur deshalb zu ihrer schlanken Freundin, weil sie nicht nachvollziehen konnte, wie ein so kluges Mädchen so merkwürdig gestört sein konnte, wenn es um Sport ging. Denn Barbara hatte nicht nur Angst vorm Schwimmen im tiefen Wasser und speziell vorm Rückenschwimmen; sie hatte auch Höhenangst und traute sich nicht, vom Zehnmeterbrett zu springen. Sport war deshalb das einzige Fach, in dem sie jemals eine schlechtere Note als eine Zwei bekommen hatte.
Barbara gab der sportlichen Freundin nur zu gern Nachhilfe, denn sie mochte Heidi und hatte außerdem die Chance, bei ihr zu Hause eine Welt zu erleben, die sie so nicht kannte. Beide Eltern berufstätig, der Vater Lehrer am Jungengymnasium, die Mutter selbstständig mit einem kleinen Spezialverlag. Heidi hatte ein Jugendzimmer aus weißem Schleiflack. Sie hatte auch einen eigenen Schreibtisch und besaß Sachen, die Barbara hier zum ersten Mal sah. Eine Wimpernzange zum Beispiel. In dieses kleine Gestell, das da neben anderen kuriosen Dingen auf einem eigenen kleinen „Schminktisch“ mit ovalem Spiegel lag, klemmte Heidi ihre hellblonden Augenwimpern ein, drückte eine Minute an – und schon krümmten sich die Haare so nach oben, dass die Augen viel größer aussahen, aber erst, wenn man noch schwarze Wimperntusche drauf gab.
Bei Heidi war es auch, wo Barbara zum ersten Mal mitten im Winter Erdbeertorte aß. Heidis Mutter hatte nämlich eine Kühltruhe. Darin lag – man mochte es kaum glauben – die Erdbeertorte fix und fertig; man musste sie nur noch auftauen!
Lieselotte Werner, von allen nur „Lilo“ genannt, war überhaupt ganz anders als andere Mütter. Sie hatte – so wurde es im Ehefrauen-Zirkel des Lehrerkollegiums ihres Mannes mit blankem Entsetzen und hinter vorgehaltener Hand kolportiert – ihrer Tochter „die Pille“ besorgt! Diese ominöse Pille, von deren Existenz Barbara bis dato nichts gewusst hatte, lag ganz offen auf Heidis Schminktisch herum und schaute, nach Wochentagen durchnummeriert als Ration für einen Monat, aus einem gestanzten Blister-Blatt, aus dem schon einige Löcher ausgedrückt waren.
Was an der Existenz dieser Pille so „segensreich“ sein sollte, wie die nicht besonders kirchenfreundliche Heidi das in einem Anflug von Spiritualität ausdrückte, leuchtete Barbara, die gelernt hatte, dass Kinder ein Geschenk Gottes waren, nicht so ganz ein. Sie begriff nur so viel, dass man kein Kind bekommen konnte, wenn man die Tablette regelmäßig einnahm; aber die Details des Funktionierens blieben ihr verborgen, und es interessierte sie auch nicht sonderlich. Wenn man keinen Mann an sich heranließ, und das wollte sie mit sechzehn nun ganz bestimmt nicht, brauchte man – zumindest so viel war ihr klar – auch nichts zu „verhüten“.
Eigentlich fühlte Barbara sich auf ihrem Mädchengymnasium ganz wohl. Wenn sie trotzdem einmal in der Woche zum benachbarten Jungengymnasium ging, dann deshalb, weil nur dort Russisch angeboten wurde und sie eine unbändige Lust hatte, fremde Sprachen zu lernen, besonders auch solche mit fremden Schriftzeichen. Hätten sie Chinesisch angeboten, hätte sie auch das gelernt.
Dort, in der Schulbank des Jungengymnasiums, machte Barbara zum ersten Mal die Erfahrung, wie es ist, das einzige weibliche Wesen in einer männlichen Runde zu sein. Einer von denen, die auch Russisch lernten, wollte sie immer zu Spaziergängen einladen. Aber er sprach einfach zu schlecht Russisch. Nicht, dass das eine notwendige Voraussetzung für schöne Spaziergänge gewesen wäre; aber es störte Barbara. Außerdem reichte es, dass sie mit Ludger bereits einen Freund hatte. Mit ihm machte sie Fahrrad-Ausflüge; in ihm hatte sie einen Tanzstundenpartner, der gut tanzen konnte; und ihrer beider Lieblingsmusik schnitt er zu langen Magnetbändern für seinen Uher-Recorder zusammen, denn technisch begabt war Ludger auch.
Mit Ludger würde sie auch zum Abiturball gehen, den sie organisiert hatte. Irgendwie schaffte sie das alles: Klassensprecherin und Schulsprecherin, Nachhilfestunden geben, Katholische Jugend, sonntags freiwilliger sozialer Dienst im Krankenhaus, Ausflüge mit Ludger, Musik hören und ganz nebenbei das beste Abitur des Jahrgangs.
Der Abiball war die erste Groß-Veranstaltung, die Barbara organisierte, und das ohne Geld. Sie wollte unbedingt in das elegante Ausflugslokal, das hoch über der Ruhr in einem herrlichen Park lag und über einen großen Festsaal verfügte. Allein schon die Raumhöhe war gewaltig und ein Traum für ein Kind aus bescheidenen Verhältnissen. Ja, da oben auf der Empore sollten ihre Eltern sitzen!
Mit zwei weiteren Mädchen aus der Schülervertretung war sie auf den Hügel gezogen, um mit dem Wirt zu verhandeln. „Schauen Sie“, sagte sie zu dem staunenden Mann, „Saalmiete können wir natürlich nicht zahlen; aber unsere Eltern sind so stolz auf uns, dass sie alle viel bestellen werden, und wir werden den Saal so schön schmücken, dass die Zeitung bestimmt ein Foto bringt, und das ist doch auch gut für Sie, nicht wahr?“
Der Wirt war verblüfft und sagte: „Ja, dann bin ich mal gespannt!“ Man muss das Eisen schmieden, wenn es heiß ist. Darum ging Barbara sofort zur Detailplanung über. „Was halten Sie davon“, sagte sie zu dem Mann, „wir nehmen unser Ballmotto wörtlich und hängen den Himmel voller Geigen. Aus Pappe natürlich. Das dürfen wir doch, oder? Die wiegen ja nichts und sehen toll aus!“
Barbaras Kolleginnen verdrehten die Augen: Da müsste man ja mindestens zweihundert Geigen basteln, damit das auch wirklich „toll“ aussah. Zum Glück hielten sie den Mund, was Barbara die Gelegenheit gab, mit einem Kompliment wieder in die Spur zu kommen. „Wir haben gehört, dass der Flügel dahinten einen ganz ausgezeichneten Klang hat. Darum würden wir gern demnächst einmal mit einer Klassenkameradin kommen, die wunderbar singen kann. Isabell klingt wie eine Opernsängerin; sie ist nur jünger. Sie werden staunen! Und unser Musiklehrer würde sie begleiten, auch bei der Probe. Vielleicht würden die beiden ja auch, wenn Ihnen das gefällt, noch einmal bei einem anderen Anlass in Ihrem schönen Haus auftreten.“
Der Abiball war an einem Samstagabend. Montags erschien ein Foto im Lokalteil der Zeitung: Es zeigte einen Festsaal, dessen Himmel voller Geigen hing, und im Vordergrund ein junges Tanzpaar: Ludger und Barbara, wie die beiden offensichtlich gerade den Fotografen „einkaufen“. Denn eine der wichtigsten Lektionen für ihr Berufsleben hatte Barbara bereits gelernt: Wer sich nicht selbst verkaufen kann, kann auch niemand anderem etwas verkaufen.