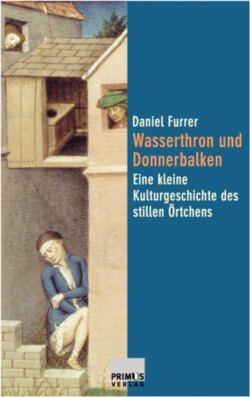Читать книгу Wasserthron und Donnerbalken - Daniel Furrer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Städtischer Zwang: Abfallhaufen und andere Häufchen
ОглавлениеIm Mittelalter war die Stadt für die Bauern, die „Nicht-Städter“, eine ungewohnte, schockierende Welt. Wer sich in der Stadt niederließ, musste zuerst mit der Fremdartigkeit des städtischen Lebens vertraut werden. Innerhalb der Mauern führte der Städter freilich oftmals ein Dasein, das an einer ländlich geprägten Lebensform festhielt. So hielt man beispielsweise Ochsen, Kühe, Schafe und Ziegen. Schweine, Hühner und anderes Kleinvieh lief die längste Zeit frei auf den Straßen herum. Die Tiere besorgten die Beseitigung organischer Abfälle und funktionierten in diesem Sinne als „Diener“ der Stadtreinigung. Andererseits erzeugten diese Tiere natürlich auch Mist, und der Misthaufen gehörte noch lange Zeit zum städtischen Alltag. So zählte man 1599 im Stadtkern Nürnbergs 386 Misthaufen, darunter 25 öffentliche. Für die öffentlichen Misthaufen erhob die Stadt Gebühren und ließ die Einnahmen dem städtischen Waisenhaus zukommen. Eine eher traurige Berühmtheit erlangte ein Misthaufen in Prag. Beim Prager Fenstersturz (1618), einem auslösenden Moment für den Dreißigjährigen Krieg, warfen aufgebrachte Protestanten die Abgesandten des katholischen Kaisers kurzerhand aus dem Burgfenster. Die kaiserlichen Herren landeten „unversehrt und wohlbehalten auf einem großen Misthaufen“.7
Bis ins 19. Jahrhundert hielt man in der Stadt noch eine bedeutende Zahl von Nutztieren. Im Jahr 1855 wurden in Basel über 600 Pferde, ein Stier, drei Ochsen, 71 Kühe, 21 Schafe, 32 Ziegen und 330 Schweine gezählt. Eine Berechnung aus dem Jahr 1873 ergab für Hamburg (Alt- und Neustadt) einen Bestand von 2171 Hühnern, 77 Enten, 73 Ziegen, 32 Rindern, 17 Schweinen, sieben Schafen, sechs Gänsen, einem Esel und einem Truthahn. Die hohe Zahl der Hühner, unterstreicht, dass deren Haltung selbst in der Wohnung für große Teile der Bevölkerung nichts Ungewöhnliches war.
Das enge Zusammenleben von Mensch und Tier konnte nicht ohne Folgen bleiben, wobei besonders die Haltung der Schweine immer wieder Anlass zu Beschwerden gaben. In Paris soll 1131 der Sohn Ludwigs des Dicken vom Pferd gestürzt sein und sich dabei das Genick gebrochen haben, weil das Pferd vor Schweinen auf der Straße scheute. Das anschließende königliche Verbot der Schweinehaltung auf den Straßen von Paris stieß auf kirchlichen Widerspruch; denn bei diesen Schweinen handelte es sich um Tiere des Klosters St. Antoine. Die folgenden Auseinandersetzungen führten zu einem Kompromiss zwischen weltlicher und kirchlicher Macht. Die Schweine durften auch weiterhin auf der Straße bleiben, mussten aber von da an ein Glöckchen um den Hals tragen, um eventuelle Reiter zu warnen. In Ulm wurde 1410 angeordnet, dass Schweine nur noch mittags von 11.00 bis 12.00 Uhr auf die Straße gelassen werden durften. In Zürich gestattete der Rat 1431 den freien Auslauf der Tiere in der Stadt jeweils von Mitte März bis Mitte Oktober. Während der kälteren Jahreszeit waren die städtischen Gärten abgeerntet und der Schweinekot auf der Straße roch weniger penetrant. Im Sommer durften die Schweine nur zum Ausmisten des Stalles und zum Tränken unter Aufsicht eines bottes (eines Knechtes) auf den öffentlichen Grund.
Die eigentliche Gefahr, die von Schweinen ausging, wurde nicht erkannt: Als im Grund nützliche Abfallverwerter konnten sie im Umfeld desolater hygienischer Verhältnisse zu Krankheitsüberträgern werden, denn Schweine fressen u. a. Kot und können dadurch große Mengen von Eiern des Schweinefinnenbandwurms (Taenia solium) aufnehmen. Der Verzehr von infiziertem Schweinefleisch durch den Menschen führt meist zu einem Befall des Gehirns durch die Larven. Hirnhautentzündungen, Kopfschmerzen oder Erbrechen sind nur einige der auftretenden Symptome. Mit Hilfe der Fleischbeschau konnte der Schweinefinnenbandwurm in Mitteleuropa praktisch zum Verschwinden gebracht werden.
Tierische und menschliche Exkremente, Mist und Straßendreck mischten sich besonders bei nassen Verhältnissen zu einem fürchterlich stinkenden Kot. Viele Bürger benutzten deshalb Holzschuhe mit hohen Sohlen und Absätzen. Modebewusste Bürger und Bürgerinnen schnallten lieber Holztreter („Tripper“) unter die guten Schuhe, um das teure Leder nicht dem ätzenden Dreck der Straße auszusetzen. Beschwerden über unerträglichen Gestank wurden in mittelalterlichen Städten von den Bürgern immer wieder vorgebracht, wobei auch die menschlichen Notdurft ein Gegenstand war. Hans Velber klagte 1445 zu Wien, dass das „secret“ des Veit Schattauer „ein tamphloch“ habe, „daraus ruche im der unflat und pos gesmachen [böser Geschmack] in sein kamer“8. Die geschworenen Werkleute, die vom Rat der Stadt zur Klärung der Frage bestellt wurden, entschieden, dass Veit Schattauer eine Art Rauchfang errichten müsse, um die Geruchsbelästigung einzudämmen, außerdem müssten beide Parteien für das Räumen und Instandhalten des secrets verpflichtet werden.
Mit dem secret – in andern Quellen auch als secessus, privet oder haimliches gemach benannt – bezeichnete man einen Abort, der von den anderen Wohnräumen abgetrennt war. An manchen Häusern sieht man noch heute einen steinernen Aborterker, wie man ihn auf Burgen schon Generationen früher verwendet hat und wie man ihn im Verlauf des 13. Jahrhunderts auch in Stadthäusern anzulegen begann. Auch ein Beleg für diese örtliche Situation ist die Erlaubnis für die Wiener Augustiner vom Jahr 1354, ihr heimliches Gemach in einem an der Ringmauer zu erbauenden Turm unterbringen zu dürfen.
Eine andere, für den modernen Leser nicht mehr verständliche Bezeichnung für den Abort war der Ausdruck Sprachhus. Er bedeutete ursprünglich soviel wie Rathaus oder geheimes Besprechungszimmer und wurde später übertragen verwendet für Abtritt. Unter einem Sprachhus oder einem privet muss man sich nicht zwingend ein Abtritthäuschen oder einen Erker vorstellen. In vielen Fällen handelte es sich dabei um eine äußerst einfache Einrichtung im Hinterhof beim Stall. Die in den Höfen gelegenen Abtritte brauchten nicht unbedingt von einem Häuschen umgeben zu sein. Der Zürcher Pfarrer Johannes Wick, der in seiner Chronik, der Wickiana, Unglücksfälle und Verbrechen sammelte, zeichnete ein doppelsitziges Plumpsklosett, das einfach an eine Hausmauer lehnt.
Die Szene stellt einen Klosterbruder dar, der auf seinem nächtlichen Gang zum Abtritt unglücklich auf der Treppe stürzte und sich das Genick brach. Wie aus dem dazugehörenden Text zu entnehmen ist, handelte es sich beim Unfallopfer um Baschi Hegner, einen ehemaligen Mönch des Klosters Rüti. Dieser hatte nach der Aufhebung seines Klosters von der Zürcher Obrigkeit eine Rente erhalten, war aber wenig später wieder einem katholischen Orden beigetreten. In Zürich löste dieses Verhalten Verärgerung aus, weshalb Pfarrer Wick den Tod des Unglücklichen – er fand nicht im Kloster, sondern in der Kleinstadt Rapperswil statt – fast genüsslich ausschlachtete.
Gemeinsam war wohl allen Abortanlagen ein Sitz mit einer runden Öffnung. Der Bezeichnung sedile für den Abort ist die Möglichkeit des Sitzens jedenfalls zu entnehmen. Die Sitzfläche bestand aus Stein oder Holz, die Öffnung konnte häufig mit einem Holzdeckel verschlossen werden, der sowohl den Gestank als auch die kalte Zugluft abhalten sollte. Offensichtlich haben sich aber auch mehrsitzige Toiletten einer gewissen Beliebtheit erfreut, wie es das „Unfallbild“ von Baschi Hegner zeigt. Im ländlichen Umfeld haben sie sich bis ins 19. Jahrhundert hinein gehalten.
6 Bei seinem nächtlichen Gang zur Toilette stürzt ein Mönch die Treppe zur Latrine hinunter. Das Bild zeigt links eine Blocktreppe, rechts den Abortkasten mit zwei Sitzlöchern. An der Wand hängt ein Holzgestell mit Heu zum Putzen des Hinterns.
Wenig Gedanken machte man sich in hygienischer Hinsicht. In Dürers Haus in Nürnberg befand sich der einzige Abort in der Küche, dicht neben dem Herd. Es war üblich, die Fäkalien aus dem Abort direkt oder über ein Fallrohr auf die Straße zu leiten. In Stadtteilen, die von Wasser durchströmt waren, brachte man die Aborterker kurzerhand über den Wasserläufen an. Weil dabei auf Abflussrohre verzichtet wurde, bildeten die Exkremente häufig Schlierspuren an der Mauer des Gebäudes, nicht selten führte ihr Weg an Küchen- und Schlafzimmerfenstern vorbei. Ohne Bedenken schöpfte man aus demselben Gewässer, in das die Fäkalien geleitet wurden, auch Trinkwasser oder verwendete das Wasser zur Herstellung von Bier.
7 Ein Ausschnitt aus der Bilderreihe die „Niederländischen Sprichwörter“ von Pieter Bruegel (1525? – 1569) dem Älteren. Aus einem am Turm angebrachten Abtrittserker ragen die Gesäße zweier Benutzer heraus. Die provokative Darstellung zeigt unmissverständlich, wozu der Erker diente.
Noch eine wichtige Bemerkung zum Stichwort Trinkwasser: Nach Möglichkeit vermied man es im Mittelalter, Wasser pur zu trinken. Man verdünnte den Wein, das Bier oder den Most damit. Hauptsächlich waren in den Städten die Brunnen und nicht der Fluss oder Bach der Ort zum Wasserholen. Den Luxus von Wasserleitungen konnten sich nur wenige Städte leisten, und auch hier kam dieser Komfortgewinn nur den Reichen zugute.
Die simpelste Art der Beseitigung der Exkremente erfolgte in den mittelalterlichen Städten über „Ehgräben“, „Reulen“ „Reihen“ oder „Winkeln“. Hierbei handelte es sich um offene Rinnen, die auf dem Grund eines schmalen Gässchens zwischen Häuserrückseiten verliefen. An diesen Rückseiten befanden sich, Schwalbennestern gleich, die Abtrittserker, aus denen die Fäkalien unmittelbar in die Rinnen hinabfielen. In den Hinterhöfen, also gleichfalls zu den „Ehgräben“ hin orientiert, befanden sich außerdem oftmals Ställe für die Kleintierhaltung. Wer über keinen eigenen Abort verfügte, wird wohl hier seine Notdurft verrichtet haben. Wegen des üblen Geruchs gab es denn nur wenige Fenster auf der Rückseite der Gebäude.
„Der Unterschied zwischen Ehgräben, Reulen, Winkeln und Reihen bestand im Wesentlichen darin, dass Ehgräben und Reihen praktisch allen Unrat aufnahmen, während Reulen und Winkeln mehr der Aufnahme von häuslichen Abwässern und Niederschlagswässern dienen sollten. In der Praxis wird man da aber wenig Unterschied gemacht haben. Im Ürigen waren Ehgräben meist in städtischem Besitz, Reulen aber Privatbesitz.“9
Im Allgemeinen hatten die Ehgräben ein Gefälle und waren meistens zu einem System verbunden, dessen Endziel der Stadtgraben oder ein Wasserlauf war. Bei fehlendem oder zu geringem Gefälle oder auch bei Überlastung sammelte sich natürlich aller Unrat an. Dies war offenbar eher die Regel als die Ausnahme: Der Ausspruch „Stinken wie ein Ehgraben“ wurde in Italien zu einer stehenden Redewendung.
Im Laufe der Zeit suchte die Obrigkeit die Räumung der Ehgräben strenger zu handhaben. In Zürich mussten gemäß einem Mandat von 1546 alle Gräben jeweils nachts und etappenweise gereinigt werden. Gleich bei Morgengrauen – man wollte vermeiden, die Stadttore in der Nacht zu öffnen – musste aller Abraum weggeschafft werden. Als Begründung dieser strengen Anordnungen führte dieses Mandat an: Die unsachgemäße Ehgrabenreinigung gebe „eyn söllichen bösen geruch und gestangk das dem menschlichen cörpel [Körper] gewüsslich großer schad darus gefolget“10.
Die Gesundheitsgefährdung durch Gestank, die in diesem Mandat angesprochen wird, ist auf die allgemein verbreitete Überzeugung zurückzuführen, dass Seuchen durch üble Gerüche, so genannte Miasmen verbreitet würden (siehe Seite 132 ff.). Die Ehgräbenreinigung diente also der Seuchenbekämpfung, was ein Beschluss aus dem Jahr 1611 verdeutlicht: Hier erließ man gleich zu Beginn des Pestausbruchs ein Verbot, Fäkaliengruben tagsüber zu entleeren. Nur in der Nacht, wenn keine Passanten die krankheitserregenden Miasmen einatmen konnten, war die Räumung erlaubt.
Die Leute, welche die Ehgräben nachts ausräumten, nannte man „Nachtmeister“. In Nürnberg wurden sie als „Pappenheimer“ bezeichnet. Man vermutet, dass Kriegsgefangene aus dem bekannten Kürassierregiment der Pappenheimer diese wenig rühmlichen Arbeiten verrichten mussten und dass ihr Name später zur Beschreibung dieser Reinigungsarbeiten beibehalten wurde. Die Münchner wiederum nannten die Leute, welche den Schlamm aus den Gruben schöpften, beschönigend die „Goldgrübler“, in Frankfurt hießen sie „Heymelichkeitsfegere“ und in Schaffhausen „Ehgrabenrumer“.
Rendez-vous im Ehegraben
Eine amüsante Geschichte zu den Gefahren, die die mittelalterliche „Abfallkultur“ mit sich bringen konnte, findet sich bei Giovanni Boccaccio in seinen erotischen Erzählungen Decamerone („Zehntagewerk“, entstanden 1348 – 353, gedruckt 1470). Der verheiratet Arzt Simon, der auf der Suche nach sexuellen Abenteuern ist, gerät in die Gesellschaft zweier skurriler Mitbürger (Bruno und Buffalmacco). Sie versprechen ihm in blumiger Sprache die tollsten erotischen Abenteuer – und der naive Doktor errät nicht, was ihm blüht!
„Sie versprachen ihm die Gräfin von Latrinien als Gattin zu verschaffen, welche das schönste Wesen sei, das im ganzen Hinternreich des menschlichen Geschlechts zu finden wäre. Nun fragte der Doktor, wer diese Gräfin sei.,ein Samengürkchen‘, antwortete ihm Buffalmacco, das ist eine gar große Dame, und wenig Häuser gibt es in der Welt, wo sie nicht etwas zu sagen hätte, von den andern nicht zu reden … Auch kann ich sagen, wenn sie einmal umhergeht, weiß sie sich wohl bemerkbar zu machen, wie verschlossen sie auch gehalten werden mag. … ihre gewöhnliche Wohnung ist im Laterin. Gleichwohl gehen ihre Knechte häufig im Lande umher … Ihre Vasallen sieht man überall, wie zum Beispiel … Don Häuflein, Herrn von Würstchen, Frau Katharina Schnelle und viele andere, die alle, wie ich glaube, auch Euch befreundet sind, ohne dass Ihr Euch jetzt erinnert. Eine so vornehme Dame wollen wir Euch, wenn ihr Eure Geliebte von Kackenwinkel im Stich lasst und unsere Pläne uns nicht missraten, in die holden Arme führen.“11
In den holden Armen dieser Dame landet der Doktor: im Ehgraben. Denn Buffalmaco hatte mit der „Gräfin von Latrinien“ nichts anderes als den Ehgraben – die offenen Abfallgräben mitsamt Exkrementen – umschrieben.
Das Fegen des „Scheißhauses“ oder das Ausräumen der Ehgräben sowie der Sickergruben war eine unehrenhafte Tätigkeit und wurde den Außenseitern der Gesellschaft überlassen – häufig dem Henker, Abdecker oder Totengräber. Nicht zuletzt gingen diese Leute ein sehr hohes Risiko ein. Unfälle wie der Folgende kamen immer wieder vor: In Nürnberg wollten die Dominikaner 1469 die lästige Entleerung ihrer Abortgrube dadurch umgehen, dass sie einen Abflusskanal in die Pegnitz gruben. Erst nachdem bei diesem Unternehmen ein Mitbruder und ein Steinmetz umgekommen waren, ließ man von dem Vorhaben ab und löste es auf die traditionelle Weise. Das heißt, man rief die „Scheißhausfeger“, „den gab man einen gulden zu lohn und den schadet kain gestank und waren frolich vor den münchen und sungen und sprungen“12.
8 Wie man sich einen Aborterker in einer mittelalterlichen Stadt über dem Ehgraben vorstellen muss, zeigt diese Darstellung. Unter den neugierigen Blicken von drei Zuschauern erleichtert sich ein Mann im Ehgraben. Über seinem Kopf befindet sich in luftiger Höhe der eigentliche Abort.
Aufsehen erregend mutet der folgende „Latrinenunfall“ an: Als der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa 1183 im Schloss Erfurt einen Reichstag abhielt, brachen die morschen Fußbodenbalken unter der großen Last der versammelten Menschen. Unglücklicherweise fielen die Leute in das Sammelbecken für Fäkalien, das sich ausgerechnet unter diesem Saal befand. Der Kaiser vermochte sich gerade noch durch einen Hechtsprung in eine Fensternische zu retten, von wo er entsetzt zusehen musste, wie seine Edlen in der stinkenden Brühe versanken. Drei Fürsten, fünf Grafen und zahlreiche Ritter fanden dabei den Tod. Ganz offensichtlich hatte man über einen derart langen Zeitraum die Abortgrube nicht mehr geleert, dass die Holzbalken zu faulen begonnen hatten. Nicht nur Adelige, sondern auch reiche Stadtbürger zögerten die kostspielige und Ekel erregende Leerung der Fäkaliengrube möglichst lange hinaus. Der Nürnberger Stadtbaumeister Endres Tucher berichtet über die Säuberungen seiner Abortgrube:
„Am 8. Januar 1508 habe ich mein heimliches Gemach im Hinterhaus durch Laurenz Claubenpulch und Ulrich Fleissmann ausschöpfen lassen. Die beiden haben knapp 10 Stunden daran gearbeitet, um die Grube bis zum Grund zu reinigen. Das letzte Mal wurde die Grube am 7. März 1499 geleert. Bezahlt habe ich alles in allem 20 Pfund. Die Grube ist 13 Schuhe tief, 9 Schuhe lang und 8 Schuhe breit.“ 13
Tucher ließ seine Abortgrube übrigens erst wieder am 26. Oktober 1517 leeren – ein Beleg dafür, dass auch reiche Bürger nur in großen Zeitabständen (in diesem Fall im Abstand von ca. zehn Jahren) ihre Abortgruben leeren ließen.
Der Luzerner Chronist Renward Cysat (1545 – 1614) riet, die Fäkaliengruben wie die Sodbrunnen bis zum Grundwasserspiegel abzutiefen und so eine Leerung zu umgehen. Für die Stadt Zürich zeigen die schriftlichen Quellen und die archäologischen Befunde für das Mittelalter und die frühe Neuzeit jedoch eher das Gegenteil. Die Einwohner suchten ihre Fäkaliengruben, welche sie unverblümt „Schîssgruoben“14 nannten, mit großer Sorgfalt abzudichten und sanierten lecke Kloaken von Zeit zu Zeit.
Das Geheimnis der Abortgruben
Für die Archäologen sind Fäkalgruben hoch geschätzte Fundgruben – Quellen für die Erschließung des mittelalterlichen Alltags. In die Latrinen wurden neben menschlichen Fäkalien auch die verschiedensten pflanzlichen Abfälle und „Zivilisationsmüll“, der in Haus und Hof im Lauf des Jahres anfiel, entsorgt. So finden sich neben Exkrementen Geschirrscherben, Trinkgläser, Flaschen, Lampen, Ofenkacheln, Nachttöpfe, Textilreste, Fellreste, Tierknochen, Pflanzenreste usw. Kriminalistischer Spürsinn ist gefragt, wenn es darum geht, diesem Abfall Informationen zu entlocken. Noch relativ einfach ist die Bestimmung von Scherben: Hier ein Stück eines Kochtopfes, dort ein Stück eines Nachttopfes. Wie aber kann man die Frage „Was haben die Menschen damals gegessen?“ beantworten?
Große Tierknochen sind in Abortgruben nicht zu finden. Ihre Entsorgung hätte allzu schnell zur Auffüllung der Grube geführt. Gesucht sind kleinste, nur wenige Millimeter große Knochensplitter, die stark verrundete Bruchkanten aufweisen und deren mehrfach eingedellte Oberfläche stark glänzt. Die geschilderten Eigenschaften deuten darauf hin, dass die Knochenfragmente den Darmtrakt des Menschen (oder auch des Hundes) passiert haben. Ebenso lassen sich kleinste Fischknochen wie Wirbel oder Gräten als Fäkalienreste des Menschen interpretieren.
Unter den Pflanzenresten aus Abortgruben deuten kleine Obstkerne von Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Weintrauben oder gar Feigen auf Fäkalien hin. Feine Häutchen von Getreidekörnern, Fruchtschalenfragmenten und Kerne von Äpfeln und Birnen sowie Sämereien von Gemüse- und Gewürzpflanzen wie Dill, Sellerie, Petersilie und Kohl sind ebenfalls typisch für menschliche Fäkalien.
Das Wasser vieler städtischer Ziehbrunnen wurde durch undichte oder falsch angelegte Kloakengruben immer wieder mit Darmkeimen infiziert. Sporadisch führte dies zu explosionsartigen Massenerkrankungen. Infolge solcher „Brunnenvergiftungen“ starben 1346 in Straßburg etwa 6000 Menschen, 1360 abermals 6000 und in den Jahren 1414 und 1417 je 5000 Menschen, ohne dass man die Ursache erkannte.
Der unterirdischen Verschmutzung stand die oberirdische Bekämpfung der Verdreckung gegenüber. Im Hochmittelalter erhielten viele Straßen in den Städten eine Pflasterung. Diese begann 1294 in Hamburg, 1331 in Prag, 1368 in Nürnberg, 1379 in Straßburg, 1399 in Bern, 1400 in Regensburg, 1416 in Augsburg und 1494 in Landshut. Gewöhnlich wurden nur verkehrsreiche Straßen und Märkte gepflastert. Gässchen blieben lange Zeit ohne festen Belag. Eine Pflasterung für Fußgänger legte man in Paris schon 1185, in Florenz 1235 und in Lübeck 1310 an. Die Straßenpflasterung war übrigens eine derart Aufsehen erregende Neuerung, dass ein Nürnberger Chronist eigens erwähnt, wie in Augsburg 1415 erstmals Straßen befestigt wurden.
Fehlte eine Straßenpflasterung, so war eine Reinigung praktisch unmöglich und entschied das Wetter über den Straßenzustand. Bei Regen verwandelten sich unbefestigte Straßen rasch in einen tiefen Morast. Im 14. Jahrhundert beklagte sich Johann von Neumarkt, der Kanzler Karls IV., beredt darüber, dass kaiserliche Reiter die Straßen Nürnbergs wegen des tiefen Schmutzes nicht passieren könnten. In einem Brief an den Erzbischof von Prag schrieb er:
„Die Stadt Nürnberg wird durch häufige Regenfälle betroffen und mit einer solchen Nässe der himmlischen Wasser durchtränkt, dass man hier an eine ewige Sintflut glauben möchte und von dem nassen Boden eine solche Masse Schmutz anwächst, dass auf den Straßen die Reiter nicht mehr fortkommen können, da der Reiter immer befürchten muss, dass entweder sein Pferd aus Unvorsichtigkeit oder über einen Stein stolpernd in die Schmutztiefe so unbedacht stürzt, dass es seinen Reiter, wer er auch sei, und wie hoch gestellt, wie ein Schwein mit dem Gestank des schmierigen Straßenkotes beschmutzt oder, wenn er durch die Gunst des Schicksals diesem Unfall entgeht, doch vorne und hinten und an den Seiten hie und da durch die Menge der ankommenden Pferde, die Kleider, zumal eines reisenden Priesters, da sie der Ehrbarkeit wegen lang sind, so sehr durch die Berührung des widrigen Schmutzes befleckt werden, dass man von den entfernten Herbergen der Stadt zum kaiserlichen Schloss nicht ohne wirklichen Schaden gelangen kann …“15
Nicht besser stand es in Paris: Rigord, der Leibarzt des französischen Königs Philipp II. August (1180 – 1223), berichtet, dass der König 1184 in Ohnmacht fiel, als er in Paris am Fenster seines Palastes stand, weil vorüberfahrende Karren den Straßenschmutz aufwirbelten und der Gestank dem König den Atem raubte. Umgehend befahl er, alle Straßen der Stadt mit harten Steinwürfeln zu pflastern. Vielerorts führte man diesen Befehl aus, aber bald war der Zustand wieder der alte, denn die Pflasterung wurde nicht ausgebessert, und alten Gewohnheiten gehorchend, warf man weiterhin allen Unrat und Kot auf die Straße. So zeigte sich rasch das alte Bild, und die Klagen über Unwegsamkeit und Unsauberkeit der Straßen tauchten wieder auf.
Die mittelalterliche Stadt in Bausch und Bogen als stinkenden und dreckigen Ort zu verurteilen, wäre aber vorschnell und ungerecht. Die Ehre einer mittelalterlichen Stadt wurde ebenso in möglichster Sauberkeit gesehen wie in prächtigen Bauwerken. Schmutz wurde als „unlust“ empfunden. Schmutz in Gestalt von Fäkalien bildete andererseits auch einen wertvollen Dünger. In Zürich belegten die Bürger die Gassen gelegentlich mit Stroh, um möglichst viel vom wertvollen tierischen Kot und Urin abzufangen. „Einerseits dürften die Gassen reingefegt gewesen sein, weil man den Straßenkot als Dungseits gehörten gerade deswegen die Mist- und Abfallhaufen zum Straßenbild.“16
9 Die unbekleidete Hausherrin leert ihr Nachtgeschirr über die Musikanten, die unter ihrem Fenster aufspielen. Nachttöpfe wurden gern auf dem einfachsten und bequemsten Weg entsorgt.
Eine mittelalterliche Stadt roch wohl nicht „anrüchiger“ als ein Bauernhof. Allerdings kam es gegen Ende des Mittelalters zu einer Verschlechterung der sanitären Verhältnisse. Ein wichtiger Grund war der Bau von vielgeschossigen Mietskasernen, häufig mit vier oder fünf Stockwerken, wie man sie bereits im alten Rom gekannt hatte. Für Bewohner der Wohnungen in den oberen Stockwerken war die Benutzung von Toiletten außerhalb des Hauses eine mühselige Angelegenheit. Die Verführung war groß, sein Nachtgeschirr einfach aus dem Fenster zu leeren. Und eines muss man sich klar vor Augen führen: Die Armen der Stadt verrichteten ihre Notdurft weiterhin in einem Winkel oder in einem Gebüsch.