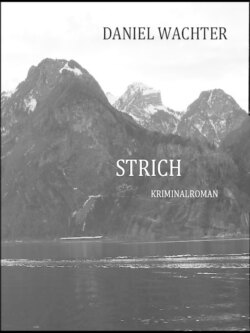Читать книгу Strich - Daniel Wächter - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
Оглавление13. Dezember, 11:30
„Ich möchte gerne zu Raphael Ferkovic! Er sitzt in U-Haft“, sagte Gian Meyer eine halbe Stunde später zur Empfangsdame im Bezirksgefängnis in Pfäffikon ZH und legte seinen Dienstausweis auf den Tresen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal hier war. Es war wohl in seinen Anfängen als Kripochef gewesen.
„Kommissar Meyer“, sagte die Frau langsam, als sie den Ausweis musterte. Sie sah zu ihm auf.
„Zelle 15. Im ersten Stock!“, sagte sie und wies ihm den Weg.
Meyer steckte seinen Ausweis wieder ein und ging durch die Gänge, welche in gewissen Abständen von Patrouillen bewacht wurden. Nur die Wachmänner erinnerten Meyer daran, dass er sich in einem Gefängnis und nicht in einem Spital befand.
Meyer war zum Hauptbahnhof gegangen und mit der S3 nach Pfäffikon gefahren. Da das Winterthurer Gefängnis überbelegt war, wurde Raphael nach Pfäffikon gebracht, wo er eine enge Einzelzelle bewohnte. Vanessas Vater wiederum wurde vom Haftrichter in einem Schnellverfahren zu lächerlichen 2 Jahren Haft in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf verurteilt, während Raphael immer noch auf seinen Prozess wartete. Meyer zog es vor, sich eine Kugel in den Kopf zu donnern als dieses Inzestmonster zu besuchen, obwohl es ihm Dr. Göhner mehrmals aufgetragen hatte.
Meyer vermutete, dass Raphael die Sonderbehandlung im negativen Sinn wegen seines ausländischen Nachnamens erhielt. Dabei trug seine Mutter den Namen Fischer und Raphaels Vater war bereits in der Schweiz geboren worden – und hatte die Staatsbürgerschaft auch schon seit er 3 Monate alt war. Traurig, dass sich – auch unterschwelliger – Rassismus in alle Branchen und Sphären verbreitet hatte.
Endlich hatte er den Zellentrakt mit der 15 gefunden. Er ging zum Büro des diensthabenden Wachmanns und legte seinen Ausweis abermals vor.
„Geht klar!“, sagte der Wachmann und Meyer erwartete, dass er einen grossen Schlüsselbund vom Brett nahm. Doch – Fehlanzeige. Der Wachmann öffnete die Tür zu seinem Büro und trat auf den Flur.
„Wo sind die Zellenschlüssel?“, erkundigte sich Meyer.
Der Wachmann sah den Kommissar an, als würde der vom Mars kommen.
„Geht alles elektronisch heute!“, grinste er.
Meyer nickte. Ist wirklich eine lange Zeit seit seinem letzten Gefängnisbesuch vergangen.
Nach einer Weile blieben die beiden vor einer grossen weissen Tür stehen. Sie war steril mit einer schwarzen 15 in Arial-Schrift beklebt. Durch ein kleines quadratisches Fenster konnte Meyer in die Zelle blicken. Es war tatsächlich Raphael. Mit gefaltenen Händen und gesenktem Blick sass er auf dem Holzstuhl im Biedermeier-Stil.
„So machen wir das heute!“, frotzelte der Wachmann und nahm eine elektronische Chipkarte, vom Format und vom Aussehen einer Kreditkarte ähnlich, aus der Tasche und hielt sie in einen Kartenleser neben der Tür. Auf dem Nummernblock mit neun Ziffern tippte der Wachmann, die tippende Hand mit der anderen abgedeckt, seinen Code ein. Sofort blinkte eine Lampe am Leser grün auf und ein Summer ertönte. Der Wachmann drückte die Klinge herunter und öffnete die Tür. Mit einem kurzen Wink liess er Meyer den Vortritt. Meyer betrat die Zelle, der Wachmann folgte ihm und schloss die Tür von innen. Er postierte sich neben die Tür, während Meyer auf Raphael zuging.
„Hallo Raphael“, sagte er leise.
„Guten Tag!“, antwortete der Junge, ohne aufzusehen. Die Hände hatte er immer noch gefaltet.
„Ich wollte nach dir sehen!“
„Gut!“
„Alles klar?“
Keine Antwort.
„Raphael? Alles klar?“
„Sie sind der erste, der mich besucht, Herr Kommissar!“ Raphael schaute auf. Seine Augen waren gerötet. Er hatte wieder geweint.
„Was?“ Meyer drehte sich zum Wachmann an der Tür um. Der nickte stumm.
„Es ist so. Meine Eltern waren nie hier, Larissa sowieso nicht!“
„Wer ist Larissa?“, fragte Meyer.
„Meine Schwester!“
Dem Kommissar kam das hellbraune Holzschild mit der Inschrift in Raphaels Wohnung in den Sinn.
„Aber jetzt bin ich hier!“, sagte er versöhnlich.
„Na und?“
„Gefällt es dir hier?“
„Man hat hier nicht mal einen Computer!“ Die Bemerkung war fast ironisch.
„Du wirst einen bekommen! Dafür sorge ich!“ Meyer drehte sich zum Wachmann um, der wild mit dem Zeigefinger wedelte.
„Sicher schon!“, zischte Meyer leise in Richtung Tür und der Wachmann erstarrte wieder zur Salzsäule.
Der Kommissar beugte sich zu Raphael nieder und sah ihm direkt in die Augen.
„Sprichst du jetzt über die Tat?“
Raphael schüttelte den Kopf.
„Ich kenne Dr. Göhner. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht eine allzu hohe Strafe bekommst!“ Der Junge hatte eine psychische Blockade.
„Ich brauche ihr Mitleid nicht, verdammt noch mal! Ich wollte helfen, aber ich bin der Verarschte!“, schrie Raphael und verpasste Meyer eine glatte Ohrfeige.
Überrascht von Raphaels Frontalangriff packte Meyer dessen Hand und hielt sie fest.
„Mach das nicht noch mal!“, knurrte der Kommissar. „Ich bin der vielleicht einzige Freund, den du auf dieser Scheiss-Welt hast!“
„Gehen Sie bitte!“, brachte Raphael hervor und riss die Hand aus Meyers Griff los.
Meyer zuckte mit den Schultern, stand auf und ging wortlos an dem Wachmann vorbei an die von ihm geöffnete Tür.
„Wieso zur Hölle musste alles, wirklich alles an diesem verfluchten Scheiss-Tag auch schief gehen?“, zischte Meyer leise und tritt gegen einen Abfalleimer aus Plastik, der ein wenig verloren im Flur stand.
Er hätte sich selbst ohrfeigen können, selbst noch als die S3 am Gleis 23 im unterirdischen Bahnhof Museumstrasse im HB anhielt und Meyer aus seinem Viererabteil aufstand, um auszusteigen. Wieso hatte er den Jungen wieder unter Druck setzen müssen.
Meyer fuhr mit der Rolltreppe vom Bahnsteig ins Zwischengeschoss. Er hastete Richtung Shopville, und vollzog vor der Buchhandlung Barth eine 180°-Grad-Drehung, um auf die Rolltreppe zum Seitenausgang an der Löwenstrasse/Postbrücke zu gelangen, als das Telefon klingelte.
„Ja?“, meldete sich Meyer. Die Nummer kannte er nicht. Eine Ostschweizer Vorwahl.
„Hier Alters- und Pflegeheim Schloss Eppishausen, Erlen, Walter, guten Tag!“, antwortete eine Frauenstimme.
Meyer wusste sofort, was los war. Sein Herz zog sich vor Schmerz regelrecht zusammen.
„Herr Meyer, es tut mir leid, aber ihre Mutter, Seraina Meyer, ist gestorben! Ich bitte Sie, herzukommen!“ Die Befürchtung hatte sich bewahrheitet.
Ohne eine Antwort zu geben, beendete Meyer den Anruf und ging zur Rolltreppe. Ihm war leicht schwindlig. Er schaute auf die Uhr. Knapp nach halb eins. In etwa fünf Minuten würde ein InterRegio in Richtung Konstanz fahren. Gut. Aufs Autofahren hatte er in dem Zustand keine Lust.
Gedankenverloren schlurfte er durch die Querhalle vor den Bahnsteigen und bog danach in den Bahnsteig mit dem Zug nach Konstanz ein, der gerade einfuhr.
Meyer kletterte, sobald der Zug angehalten hatte, in einen Wagen und setzte sich in ein leeres Abteil. Er wollte seine Ruhe haben.
Doch – weit gefehlt! Zwei Minuten vor Zugsabfahrt stiegen drei japanische Frauen – Meyer schätzte sie um Mitte fünfzig herum – in den Wagen und steuerten direkt auf Meyers Abteil zu.
Kaum hatte sich der Zug in Bewegung gesetzt, legten sie los und schnatterten in auffallend hoher Stimme auf Japanisch. Das heisst, die Frau, die sich neben Meyer niedergelassen hatte, redete und die anderen beiden nickten glucksend. Wieder einmal hatte sich das Klischee leider bestätigt.
Glücklicherweise stiegen sie am Flughafen aus und als der Zug vor Bassersdorf wieder das Tageslicht erreichte, lehnte Meyer den Kopf ans Fenster und schloss die Augen.
Während der Zugfahrt gedachte Meyer seiner Mutter. Seine ersten Erinnerungen an sie waren, wie sie ihn im aufblasbaren Bassin im Garten mit Wasser gebadet hatte, als er knapp vier war. Dann über die Begleitung zum ersten Schultag damals in Chur, nachdem er den Kindergarten verweigert hatte, da er von ihr nicht getrennt sein wollte. Meyer wurde älter, seine Mutter auch. Die Freude über seine Matura, die Zulassung zur Universität, den Abschluss. Ihre Angst und ihre Bedenken, als er ihr eröffnete, zu Interpol zu gehen, hatte sie jedoch nie verloren, genauso wenig wie ihre Fröhlichkeit. Ihre Furcht, Meyer könnte schwul sein, als er mit 32 noch keine Freundin hatte. All dies hatte sein Erinnerungsvermögen geprägt. Am Ende hatte die Demenz komplett von ihr Besitz genommen. Meyer erinnerte sich an seinen letzten Besuch im Schloss Eppishausen. Das war vor zwei Wochen. Immer hatte sie ihn lächelnd mit Curdin angesprochen, und gesagt, dass sie bald aus der Pflege entlassen würde. Just in diesem Moment war Meyer klar geworden, dass seine Mutter den Verstand verloren hatte. Curdin, das war Meyers älterer Bruder, der aber mit 19 – Meyer war gerade mal 15 – bei einem Motorradunfall auf dem Flüelapass ums Leben kam. Er war auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Auto geprallt, an dessen Steuer ausgerechnet Curdins und Gians Vater sass. Seraina war über den Verlust ihres ältesten Sohnes nie hinweggekommen und hatte ihrem Gatten, obwohl der ja faktisch nichts für den Unfall konnte, insgeheim die Schuld an Curdins Tod gegeben. Es dauerte kaum einen Monat, da trennten sich die beiden. Seraina blieb mit Gian und den Erinnerungen an Curdin in Chur, während Meyers Vater irgendwo hin zog. Meyer hatte ihn niemals wieder gesehen. Er wusste nicht mal, ob sein Vater sich in der Schweiz niedergelassen hatte oder ins Ausland ging, geschweige denn, ob er noch lebt, oder nicht.
Jetzt war sie 95 geworden, hatte ihn aber nicht mehr erkannt. Langsam hatte er gespürt, dass es zu Ende ging, wie sie von ihrem Geiste verlassen wurde. Doch dass es so schnell ging, hätte er sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können.
Fünfzig Minuten nach der Abfahrt in Zürich bremste der Zug ab und fuhr in den Bahnhof Weinfelden ein.
Meyer stand auf, wartete bis die Komposition zum Stillstand kam, stieg aus dem Zug und ging zum Abgang der Hauptunterführung, der direkt beim im Gegensatz zu den restlichen Bahnhofsanlagen seit der Eröffnung 1855 nahezu unveränderten Empfangsgebäude nach Plänen des Architekten Jakob Friedrich Wanner lag. Auf dem elektronischen Zugzielanzeiger vergewisserte er sich, dass die S7 Richtung Rorschach auf Gleis 4 fuhr. Er hastete die Treppe hinunter und ging in schnellen Schritten durch die Unterführung, um dann den Aufgang am Mittelbahnsteig 3-4 zu nehmen. Der Zug stand bereits abfahrbereit am Bahnsteig des Gleises 4.
Meyer stieg ein, und wenig später setzte sich der Zug in Bewegung und erreichte über Bürglen und Sulgen die Haltestelle Erlen.
Meyer entstieg dem Zug, wartete bei den Lista-Gewerbegebäuden am Bahnübergang bis die Schranken hochgingen, überquerte die Geleise und ging die beidseits bebaute Bahnhofstrasse entlang zur Hauptstrasse, auf der früher gar Auto- und Motorradrennen ausgetragen wurden. Dort bog er links ab und überquerte nach einem Fussmarsch durch die Felder die Hauptstrasse im Weiler Eppishausen, um dann die Schlossstrasse den Hügel hinauf zu erklimmen. Das im Schloss untergebrachte Alters- und Pflegeheim sah er schon von weitem, die grünen Jalousien der vielen Fenster stachen sofort hervor. Ein immer mehr mulmiges Gefühl beschlich Meyer, als er näher kam. Dieser Moment hatte sich viele Male in seinem Kopf abgespielt, doch die Realität ist doch noch ein klein wenig anders. Tatsächlich wusste Meyer nicht, wie er der Leiche seiner Mutter entgegentreten soll.
„Guten Tag“, kam ihm eine Schwester entgegen, als er die elektronische Schiebetür durchtrat.
„Ich bin Gian Meyer. Ich komme wegen meiner Mutter! Seraina Meyer“
Sie schaute ihn lange an, räusperte sich aber nach einer knappen Minute.
„Mein aufrichtiges Beileid!“, sagte sie und schaute ihn mitfühlend an. Meyer konnte nicht sagen, ob es ehrlich gemeint war oder es einfach eine schauspielerische Maske war, die von den Pflegerinnen im Todesfall eines Patienten auf Knopfdruck vorgetragen werden musste.
„Vielen Dank!“, sagte Meyer nur.
„Es wird jetzt ein bisschen schwer, aber ich bitte Sie, mir zu folgen!“
Sie machte auf dem Absatz kehrt, Meyer folgte ihr. Sie gingen durch die Flure zum Aufzug. Die Schwester drückte den Knopf für die dritte Etage. Die Lifttüren schwangen zu, Meyer spürte ein beklemmendes Gefühl im Magen.
Da lag sie, die von Runzeln übersäte Haut war ganz fahl. Meyer legte eine Hand auf ihre Stirn. Tränen rannen über seine Wangen. Sie war in ihrem Bett friedlich eingeschlafen.
„Sie hat nicht gelitten!“
Die Worte der Schwester sollten eine tröstliche Funktion haben. Meyer drehte sich zu ihr um.
„Vielen Dank für alles. Wie Sie sich um sie gekümmert haben!“
„Das ist unser Job. Wir werden Sie, sofern Sie einverstanden sind, zu Ihnen nach Zürich überführen, wo Sie sie dann bestatten können!“
Meyer nickte.
„Vielen Dank!“, sagte er abermals. Er wusste nicht, was er sonst sagen sollte.
Er umrundete das Bett seiner Mutter und schaute aus dem Fenster. Sie hatte eine hervorragende Aussicht gehabt. Eine grosse Ebene, nur durch Strasse und Eisenbahn durchtrennt, breitete sich unter dem Schloss aus. Rechts stand eine kleine Ansammlung aus Häusern, die meisten Bauernhäuser, das sollte Eppishausen sein. Schön hatte sie es hier wirklich gehabt. Meyer wünschte, auch er könne in solch einer Landschaft Abschied nehmen.
„Herr Meyer?“
Er drehte sich um. Die Schwester lächelte ihn an.
„In einer halben Stunde haben Sie den Termin mit dem Notar bezüglich der juristischen Angelegenheiten. Wir haben das organisiert!“
‚Hättet mich auch vorher mal fragen können!’, dachte Meyer und schenkte der Schwester ein Lächeln. „Vielen Dank. Treffe ich ihn hier im Zimmer oder unten in der Caféteria?“
Die Schwester biss sich auf die Lippen. „In seinem Büro. Wir wollten ihn hierher holen, doch her hatte keine Zeit.
„Soweit ich mich erinnern kann, war der Notar meiner Mutter ein gewisser Eduard Hasler in Weinfelden?“
Die Schwester schüttelte den Kopf. „Nein. Sie hat ihn vor zwei Monaten gewechselt!“
„Mir hat sie nie was gesagt!“
„Sie waren auch so selten hier, so dass ihre Mutter Sie nicht mehr wieder erkannt hat!“, konterte die Schwester mürrisch.
Das sass! Ganz Unrecht hatte die Schwester mit ihrem Vorwurf nicht. Er hätte ihr viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Diese Erkenntnis kam aber jetzt zu spät.
„Wer ist es dann?“, fragte Meyer.
„Ein Herr Albers. Er hat sein Büro in Konstanz.“
„Und wie komme ich dahin? Ich bin mit dem Zug hier und da dauert es fast eine Stunde!“
„Ich fahre Sie mit dem Wagen. Ihre Mutter hat uns versichert, dass sie uns in ihrem Testament ebenfalls berücksichtigt hat.“
„Wie bitte?“ Soweit sich Meyer erinnern konnte, hatte seine Mutter ihr Testament vor fünf Jahren bei Hasler verfasst und seinem Wissen nach nicht mehr verändert. Und vor fünf Jahren lebte sie noch in ihrer Altbauwohnung in Chur.
„Sie hat es beim Wechsel zu Albers überarbeiten lassen.“
Meyer schüttelte den Kopf. Er konnte es kaum glauben.
Eine Viertelstunde und eine eher rasante Autofahrt über Berg später überquerte der VW Golf der Krankenschwester die nur noch auf dem Papier bestehende Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Nur ein einziges Mal hatte die Schwester während der Fahrt ein Wort gesagt. Als sie bei Kehlhof am Bahnübergang vor den heruntergelassenen Schranken gewartet hatten, hatte sie ihn abermals getadelt.
„Sie hätten wirklich mehr vorbeikommen sollen!“, hatte sie gesagt, „Seraina war sehr einsam. Sie waren der einzige, der sie noch hatte. Und Sie haben sie im Stich gelassen!“
Meyer hatte daraufhin nichts gesagt. Dieses Moralapostelgetue ging ihm sowieso langsam auf die Nerven.
Unmittelbar nach der Grenze steuerte die Schwester den Wagen in das Parkhaus eines grossen Einkaufszentrums.
Meyer und die Schwester hatten das Einkaufszentrum verlassen und kämpften regelrecht gegen den Strom aus Menschen, die ihren Weihnachtseinkäufen nachgingen, ankämpfen. Aufgrund des tiefen Euros und des starken Schweizer Frankens entschieden sich viele Schweizer, insbesondere aus den Grenzregionen, für den Einkauf auf der anderen Seite der Grenze. Tatsächlich sprachen die meisten, die ihnen mit schwer beladenen Einkaufstüten entgegenkamen, Schweizerdeutsch.
Sie gingen am Bahnhof entlang und bogen danach in die Marktstätte ein, wo auf der gesamten Fussgängerzone der Weihnachtsmarkt abgehalten wurde. An Ruhe war hier kaum mehr zu denken.
Meyer konnte nicht verstehen, wie man an diesem Ramsch, der an solchen Märkten verhökert wird, auch nur einen Ansatz von Freude haben kann.
Die Schwester steuerte durch die Mengen und Meyer folgte ihr. Sie bog links zwischen Volksbank und dem Müller-Drogereimarkt in eine namenlose, dunkle Seitengasse ab und öffnete die Tür zu einem der alten, jedoch sanierten Häuser der Konstanzer Altstadt. Eine Messingtafel am Eingang informierte den Besucher, dass sich Albers’ Kanzlei im dritten Stock befand.
„Herein!“, rief eine gutgelaunte Männerstimme, als Meyer im dritten Stock geklopft hatte. Der Kommissar drückte die Klinke hinunter und stand nun mitten in einem Büroraum. Hinter einem riesigen Buchenholzschreibtisch sass ein rundlicher Mann mit Stirnglatze auf einem Lehnsessel. Er sprang auf, um seinen Besuch in Empfang zu nehmen.
„Ich bin Frank Albers!“, stellte er sich vor. „Und Sie sind Herr Meyer!“ Er grinste.
Meyer nickte.
„Mein Beileid zum Tode ihrer Mutter. Ich hatte immer sehr grosse Freude, mit Sereina zu arbeiten!“
Dann erblickte er die Schwester.
„Ah, Sie sind Frau Schenk!“ Zum ersten Mal erfuhr Meyer den Namen der Schwester. Er biss auf seine Zähne. Diese eingebildete Tante hatte sich wohl für was Besseres gehalten und darauf verzichtet, sich ihm vorzustellen! Er sandte ein Stossgebet zum Himmel und hoffte inständig, dass diese Schenk keinen einzigen Rappen zu Gesicht bekam.
„Setzen Sie sich!“, sagte Albers und wies auf eine leer stehende Stuhlreihe am Schreibtisch. Meyer legte seinen Mantel ab und umhüllte damit die Stuhllehne. Alle drei setzten sich.
Mit einem lauten Klatschen warf Albers eine dicke Mappe auf den Tisch. Sie war in säuberlichen Druckbuchstaben mit Sereina Meyer als Titel versehen. Er klappte sie auf und legte ein mit wenigen Zeilen beschriebenes A4-Blatt auf den Tisch. Meyer sah, dass das A4-Blatt am unteren Ende zwei Unterschriften trug. Er erkannte die kühn geschwungene Signatur seiner Mutter. Die andere gehörte wohl zu Albers, obwohl das Gekritzel überhaupt nicht entzifferbar war.
„Jetzt werden wir mal sehen, wer die ganze Kohle bekommt!“, grinste Albers und liess ein gackerndes Lachen folgen. Meyer verzog keine Miene. Er wusste erst seit wenigen Stunden vom Tode seiner Mutter und dieser Vollidiot hatte nichts Besseres zu tun als unlustige Witzchen zu reissen.
Aber überraschenderweise verspürte Meyer nicht den Impuls zu weinen. Er war traurig, sogar sehr traurig. Die Trauer lastete über ihm wie ein schwerer Gegenstand, der ihn zu zerdrücken drohte.
Als Albers merkte, dass nur die Krankenschwesterm, wenn auch offensichtlich gekünstelt, lachte und Meyer ungerührt dasass, setzte er sich eine Lesebrille auf.
„Ich lese nun das Testament von Frau Sereina Meyer vor!“, sagte er und blickte auf.
Dann begann er zu lesen.
„Ich vermache all mein Vermögen und dasjenige meines vor zwanzig Jahren verstorbenen Ehemannes an das Alters- und Pflegeheim Schloss Eppishausen in Erlen!“
Meyer traute seinen Ohren nicht.
„Und jetzt noch was für meinen Sohn Gian: Du hast zwei riesige Fehler in deinem Leben gemacht: Du hast diesem bezaubernde Mädchen Gertrud die Hölle heiss gemacht. Kein Wunder, hat sie dich sitzen gelassen. Und du hättest mich mehr besuchen müssen. Ich merke, wie mein Geist mich verlässt, aber ich hätte dich gern noch einmal so gesehen, wie du wirklich bist. Aber ich bin kein Unmensch, natürlich gehst du nicht leer aus. Ich habe dir meinen alten Besen hinterlassen, die Schwestern in Eppishausen werden dir ihn sicherlich übergeben!“
Meyer war sprachlos. Er warf einen Seitenblick zur Schenk, die ihn triumphierend angrinste. Er verspürte einen gewissen Drang, die Krankenschwester zu ermorden.
Er schaute Albers an.
„Ist das alles?“
Statt einer Antwort drehte Albers das Testament und übergab es Meyer. Der las die Zeilen immer und immer wieder durch. Tatsächlich. Ihm blieb nur der Besen übrig. War ja klar! Seit Curdins Tod war er einen Scheissdreck mehr wert gewesen!
Er nickte. „Ist okay!“
„Akzeptieren Sie ihr Erbe?“, fragte Albers. Meyer hoffte, dass diesem Trottel die Ironie seiner Frage bewusst wurde.
Meyer und Schenk nickten.
Der Kommissar stand auf und nahm den Mantel von der Stuhllehne.
„Ich gehe jetzt!“, sagte er.
Schenk schaute zu ihm hoch. „Soll ich Sie mitnehmen?“ Sie liess wieder ihr Lachen aufblitzen. „Dann könnte ich Ihnen gleich den Besen mitgeben!“
„Nein danke. Ich fahre mit dem Zug!“, brummelte Meyer und funkelte sie wütend an. Dann stand er auf und verliess das Alberssche Büro. Er pfiff auf das Erbe seiner Mutter.
Eine knappe halbe Stunde später stieg Meyer am Gleis 4 im Bahnhof Weinfelden aus dem Regionalzug der Thurbo. Der Anschlusszug nach Zürich HB am benachbarten Gleis war auf den Zugzielanzeigern bereits angekündigt.
Er verfluchte seine Mutter für ihr Testament aber noch mehr sich selbst. Seine raren Besuche hatte er immer wieder aufgeschoben, bis sie unausweichlich waren. Er besuchte sie nur noch maximal einmal pro Monat. Aber er war wütend. Seine Mutter war demenzkrank und hatte ihn immer mit seinem Bruder verwechselt – klar war er für sie nicht erschienen. Er überlegte sich sogar, dass die Angestellten des Alters- und Pflegeheimes auf die Formulierungen eingewirkt haben, doch er verwarf den Gedanken gleich wieder. Verschwörungstheorien waren nicht sein Ding.
Er spürte einen fahlen Geschmack im Mund. Er wollte ausspucken.
Der Kommissar trat auf die Bahnsteigkante, als ihn plötzlich ein leichter Schwindel überfiel. Er sah seine Mutter vor sich, wie sie auf ihn zukam. Sie war ganz nah bei ihm und streckte die Hände nach ihm aus.
„Gian! Endlich erkenne ich dich wieder! Mir geht es viel besser! Hast du das mit dem Testament erfahren?!“ Sie schien zu lachen, wie sie es immer getan hatte. Beim Stricken, beim Fernsehen, bei Gians erstem Schultag…
Er wollte antworten, doch er brachte kein Wort heraus. Als er ihre Umarmung erwidern wollte, fühlte er sich, als wäre er mit einer Hundeleine an einen Pfahl angebunden und er konnte sich ihr nicht nähern und in die Arme schliessen.
Meyer wurde schlecht, er merkte, wie er das Gleichgewicht verlor und auf etwas Hartes, Metallenes stürzte: Die Schienen. Er hörte Schreie, das Tuten der Warnhupe einer Lokomotive. Die leuchteten Stirnlampen, die rote Front der nahenden Lokomotive.
Hände, die ihn an den Füssen packten und auf den Bahnsteig zurückzogen, gerade noch rechtzeitig, bevor der Zug einfuhr.
Zu Hause angekommen, schleuderte Meyer seine Aktentasche in die Ecke, warf den Schlüsselbund auf den Tisch, nahm ein Weissbier aus dem Kühlschrank und schaltete den Fernseher ein.
Nach seinem Schwächeanfall in Weinfelden hatte er entgegen des Rates der entsetzten Passanten einen Arztbesuch abgelehnt und hatte den Zug bestiegen, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte und war nach Zürich gegangen, um den RS6 zu holen. Die Autofahrt nach Horgen verlief problemlos.
Gerade lief auf SFinfo in einer Wiederholung der Tagesschau am Mittag der Beitrag über die Leiche am Sihlquai. Es war kurz vor fünf Uhr.
„…Zürich am Sihlquai wurde in eine Leiche gefunden. Das Opfer muss zunächst noch identifiziert werden“, dröhnte der Kommentar durch die Lautsprecher von Meyers Fernseher.
Meyer beugte sich vor, hielt die Flasche an die Kante des kleinen Tischchens und hämmerte mit der Hand so lange auf den Deckel, bis er weggeschleudert wurde. Genüsslich liess er das schäumende Bier die Kehle hinunter fliessen.
Der Beitrag wurde geschnitten und stattdessen erschienen die Szenen einer Pressekonferenz im Bild. Die Journalisten liessen ununterbrochen ihre Kameras blitzen, in der Angst etwas zu verpassen. Das Interesse galt dem Podium, das notfallmässig in einer Sporthalle in Aussersihl aufgebaut wurde. Auf dem Podium sassen zwei Menschen, eine war Dr. Elisabeth Göhner, Staatsanwältin des Kantons Zürich, und der andere war Philipp Estermann, seines Zeichens Polizeipräsident des Kantons.
„Wir versichern Ihnen, dass unsere Männer alles in ihrer Macht stehende tun werden, um den Fall zu lösen“, nuschelte Estermann in einen Strauss Mikrofone.
„Du machst ja nie einen Finger krumm!“, knurrte Meyer. Er war auf Estermann aus bekannten Gründen nicht gut genug zu sprechen.
„Der Fall ist kompliziert und auf jeden Fall spreche ich den Angehörigen des Opfers unser Beileid aus, und hoffe, dass ihre Identität ans Licht kommt, damit sie einen angemessenen Abschied aus dem irdischen Leben erhält. Vielen Dank!“, beendete Estermann die Pressekonferenz.
Im TV erschien ein grässlich schwitzender Nachrichtensprecher, der von einer politischen Debatte im Deutschen Bundestag in Berlin zu sprechen begann. Meyer suchte nach der Fernbedienung und wühlte durch die Kissen. Als er sie gefunden hatte, drückte er ohne zu Zögern auf den roten Knopf und liess den Fernseher in den Standby-Status übergehen.
Er ging in die Küche, schaltete die Kaffeemaschine ein und stellte eine grosse Tasse unter die Düsen. Dann drückte er einen Knopf und sah zu, wie die dunkelbraune Flüssigkeit in die Tasse floss.
Er nahm die dampfende Tasse und setzte sich trotz der Kälte auf den Balkon, denn Meyer hatte ihn beim Einzug in einen Wintergarten umbauen lassen. Die Aussicht war dieselbe wie im Badezimmer – direkt auf den Zürichsee.
Unten sah er, wie die Autofähre nach Meilen über den See fuhr. Der Gegenkurs war ebenfalls unterwegs und auf der Seemitte kreuzten sie sich.
Meyer nippte seinen Kaffee und dachte über die Ereignisse nach. Den ganzen Abend hatte er bekanntlich Zeit, da sie die definitiven Resultate aus der Pathologie abwarten mussten.
Die entscheidende Frage war: Welches Ziel verfolgte der Täter mit der Tat?
Gegen diese brennende Frage kämpfte nur ein Gefühl an: Die Trauer um den Verlust seiner Mutter.
Sie hatte am Ende nur noch gelitten, aber trotzdem ein schönes Ende gehabt, mit der Aussicht auf die Thurgauer Apfelbäume. Meyer wurde schlecht. Er ging in sein Badezimmer und übergab sich. Als er sich das Gesicht gewaschen hatte und sein Gesicht im Spiegel betrachtete, überkamen in die Gefühle. Zitternd wurde er von seinen Schluchzern übermannt, ehe er nicht mehr stehen konnte und auf den Fliesen des Badezimmers zusammenbrach.
Er überhörte beinahe sein Telefon.
„Ja?“, sagte er mit leiser Stimme.
„Hallo Gian! Alles klar?“ Es war Steiner.
Meyer sagte nichts.
„He, Gian!“
„Meine Mutter ist gestorben!“
Steiner schwieg eine Zeit lang.. „Das tut mir leid!“
Meyer winkte ab. „Schon okay! Sie hat’s eh nicht mehr gecheckt!“
Eine Zeitlang schwiegen die beiden.
“Okay Ramon! Was ist los?
“Wir haben einen weiteren Toten!”