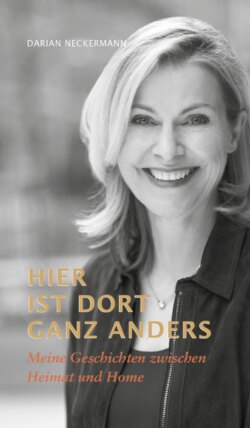Читать книгу Hier ist dort ganz anders - Darian Neckermann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIM STARKEN TRAB VORAN
Sport ist in den Staaten ein integrativer Bestandteil des amerikanischen Schulsystems. Wie steht es um die positiven und negativen Aspekte des Schulsports sowie um die damit verbundenen Erwartungen und Grenzen?
Ausgerechnet in dieser Nacht hatte sich die Luft auf Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt abgekühlt, und leichter Bodenfrost überzog das offene Feld. Die Läuferinnen und Läufer scharten sich in Gruppen zusammen, als ob die gegenseitige Nähe sie in ihren leichten Trikots vor der Kälte schützen könnte. Warum dauert das denn so lange?, dachte ich mit Blick auf meine frierende Tochter und widerstand der Versuchung, ihr ihre Jacke zu bringen. Es war das letzte Crosslaufrennen der Saison, und wie bereits im Vorjahr hatte sich unser Team für das Rennen qualifiziert. Meine Tochter liebte dieses Querfeldeinlaufen, auch wenn sie aufgrund ihres täglichen Trainings und der wöchentlichen Qualifizierungsrennen oft erst um sieben Uhr abends zu Hause war und mit den hierzulande nicht unüblichen drei bis vier Stunden Hausaufgaben in den Abendstunden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stieß.
Gott sei Dank, es ging los! Ein Hauch von Erleichterung mischte sich in die plötzlich spannungsgeladene Luft, die Läufer positionierten sich bei leichtem Nieselregen an der Startlinie, der Startschuss fiel. Die Erde bebte unter den Schritten der über hundert losspurtenden Jugendlichen, und auch wir Zuschauer setzten uns in Bewegung, um ihnen die gesamte Bandbreite inspirierender Anfeuerungsrufe mit auf den Weg zu geben. Bereits nach den ersten Sekunden hatten sich einige der Läufer von der Horde bunter Trikots gelöst und führten das sich mit jedem Schritt weiter auseinanderziehende Feld auf dem Rundkurs im Anderson Park an.
Ganz vorn mit dabei war – wie erwartet – eines der Bennett-Mädchen. Unglaublich, diese Familie. Alle vier Mädchen liefen bei solchen Rennen mit, als hinge ihr Leben davon ab, und kamen dementsprechend immer auf einen der vordersten Plätze. Sie waren die Superstars in unserer Schule und aufgrund ihrer zahlreichen Erfolge die Leistungsträgerinnen unseres Crosslaufteams.
Während die Läufer so langsam unserem Sichtfeld entschwanden, machten wir Eltern uns auf den Weg zur Zielgeraden. »What a great day for a race«, hörte ich eine Stimme hinter mir sagen und drehte mich ungläubig um, nass und bis auf die Knochen durchgefroren. Es war Mary Bennett, und bei so viel mütterlichem Sportsgeist an diesem lausigen Novembertag musste ich schon beinah lachen. Doch es war mehr als ihre Einstellung zum Wetter, die uns voneinander unterschied. Während ich für meine Tochter froh war, als sie endlich erschöpft und nach Luft ringend in die Zielgerade einlief, diskutierte Mary noch vor der Siegerehrung mit ihrer Tochter, wie diese ihre persönliche Bestzeit das nächste Mal verbessern könne.
Ich lernte an diesem Tag, dass das Sprintvermögen ihrer Töchter nicht nur an den rigorosen Trainingsauflagen unseres Coaches lag, sondern an der Tatsache, dass alle ihre Kinder vor der Schule noch ein zweistündiges Schwimmtraining in dem nahe gelegenen Schwimmzentrum des Massachusetts Institute of Technology absolvierten. Ob diese Familie auch mal schlief? Wie konnten ihre Kinder bei so einem ausgefüllten Tagesprogramm überhaupt noch schulische Leistung erbringen? Schon unser Freund Mike hatte seine damals vierzehnjährige Tochter jeden Morgen um vier Uhr zum Schwimmen gefahren, da dies die einzig verfügbare Trainingszeit für das Schwimmteam unserer Highschool war. Und schon damals empfand ich ausreichenden Schlaf als ein weit besseres Argument als jeglichen Nutzen frühsportlicher Aktivität. Doch weder Mary noch Mike hegten den leisesten Zweifel an ihrem Familienfahrplan. Während sie mir etwas von »Müdigkeit schadet nicht« und »Man tut, was man tun muss!« erzählten, war ich froh, dass meine Kinder nicht Mitglieder eines Schwimmteams waren und der Wecker in unserem Haus erst um sechs Uhr klingelte.
Ist Leistungsfähigkeit eine Frage individueller Belastbarkeit? Gehörten solche Kinder zu den Ausnahmen oder herrschten hier einfach andere Maßstäbe? War es Zeit, meine Einstellung anzupassen?
Bereits als meine Kinder noch hier im Ort Fußball spielten und ich nicht nur am Rand unseres Spielfelds in Winchester, sondern auf dem Rasen von Ortschaften stand, von denen ich vorher nie etwas gehört hatte, schien meine Vorstellung von Freizeitsport mit der hiesigen nicht ganz kompatibel. Konnten die Knirpse in ihren schwarz-roten Trikots nicht gegen unsere benachbarten Mannschaften antreten? Und seit wann war der Sport meiner Kinder ein All-inclusive-Paket? »Travel soccer« (mit Betonung auf Travel) nannte sich damals dieses zeitintensive Familienprogramm der Abende und Wochenenden, bei welchem den Kindern auf dem Spielfeld der sportliche Einsatz zufiel und uns Eltern als Fanclub der Transport, die Trink- und Essensversorgung, der seelische Beistand, die medizinische Betreuung und das Anfeuern. Ich bewunderte die hundertprozentige Einsatzbereitschaft meiner amerikanischen Mitstreiter, den Großteil ihrer Freizeit im Auto und am Spielfeldrand zu verbringen, auch wenn sie mitunter ihr Kind nur auf der Ersatzbank sitzen sahen. Die Mehrzahl unserer siegreichen Spiele verdankten wir ohnehin dem gezielten Einsatz der Walsh-Zwillinge, die zwischen ihren Hockeyspielen mal eben ein paar Fußballtore schossen und unsere Mannschaften jedes Mal verlässlich in Führung brachten. Wurde ein Spiel wegen eines Unwetters abgesagt, schienen die meisten Eltern enttäuschter als ihre Kinder, während mein Mann und ich uns freuten, dass der Sport der Kinder einmal nicht über unsere Zeit bestimmte.
Absagen wie diese blieben allerdings eine Seltenheit. Zwischen Crosslauf, Volleyball und anderen Aktivitäten koordinierten wir an Wochenenden die diversen Fahrpläne und verfolgten mit zunehmendem Stirnrunzeln die minütlich getakteten Wochenpläne unserer Kinder. Als ihr sportliches Engagement zunehmend mit den akademischen Anforderungen kollidierte, bestärkten wir sie, sich für Sportarten zu entscheiden, deren Zeitaufwand überschaubar war. Viel Auswahl gab es nicht. Und den Zeitgeist trafen wir damit auch nicht. Anstatt die Bremse etwas anzuziehen, machten sich andere Eltern für Off-Season-Training stark und schickten ihre Kinder neben dem täglichen Schultraining und den Wettkämpfen an den Wochenenden zusätzlich zum Krafttraining. Sie hofften, mit diesen gezielten Trainerstunden die Chancen bei den Tryouts zu erhöhen, bei denen sich die Schüler noch vor Beginn des Schuljahres für die diversen Mannschaften qualifizieren müssen. Jedes abgesagte Spiel schien eine verpasste Chance, Können zu beweisen. Körperliches Wohlbefinden, individuelle Fitness, Beweglichkeit und Spaß als ausschlaggebende Faktoren, sich sportlich zu engagieren, traten mit jedem Schuljahr hinter diesen Wettkampf der Belastungsfähigkeit zurück. Wie gut, dass man Nachsicht mit mir hatte, wenn ich Kommentare wie »If they are busy, they can’t get into trouble« oder »If they are not tired, they are not working hard enough« nicht ganz nachvollziehen konnte.
Sport war immer ein integrativer Bestandteil des amerikanischen Schulsystems, und die in der Regel eindrucksvollen Sport- und Grünanlagen sind Ausdruck seines gesellschaftlichen Stellenwerts. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Sportangebot einer Schule so umfangreich ist wie das akademische Kursangebot, und die im Sport vermittelten Werte wie Fairness, Teamgeist, Selbstdisziplin und Einsatzbereits chaft genießen als kognitive wie soziale Kompetenzen höchste Anerkennung. Vielen Eltern ist es ein Anliegen, dass sich ihre Kinder durch Sport schon früh im Wettbewerb üben, dass sie lernen, unter hohem Druck Leistung zu erbringen und mit Niederlagen umzugehen. Nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass mit einer Teamzugehörigkeit ein gewisses Ansehen verbunden ist und damit die Chance, ethnische wie soziale Grenzen zu überwinden und den eigenen sozialen Status zu erhöhen. Die Anerkennung für die Spieler, die es in die erste Mannschaft schaffen, reicht oft weit über den Schulhof hinaus, und der Bewunderung wird in verschiedenster Weise Ausdruck verliehen.
Da werden Spins dekoriert, Häuser über Nacht in mit Klopapier überzogene Kunstwerke verwandelt und vor wichtigen Spielen die sogenannten Pep rallies organisiert, rituelle Zeremonien, die den Fans die Gelegenheit geben, den Spielern zuzujubeln, sie anzuspornen und sich einzustimmen.
Und wenn sich an einem Freitagabend Freunde und Familie versammeln, um unter dem Schein der Flutlichter die eigene Mannschaft anzufeuern und sie mit Stolz und emotionaler Verbundenheit durch ein Football- oder Lacrossespiel zu tragen, stärkt nichts in vergleichbarer Weise das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Ob im Abendlicht auf der Tribüne des Red-Sox-Stadiums, inmitten des Tailgate-Trubels vor Anpfiff eines Harvard–Yale-Footballspiels zwischen Bier, Burgern und Autos oder bei einem High school homecoming mit seinen Cheerleadern, dem Auftritt der Marching band, den Sportlern und ihrem Glück bringenden Maskottchen … auch wir und unsere Kinder haben über die Jahre die gesellige, zusammenführende und identitätsfördernde Komponente des amerikanischen Sportenthusiasmus und der damit verbundenen Rituale lieben gelernt. Getragen von dieser Woge des uns umgebenden Ambientes fragte ich mich des Öfteren, ob ich mir und meinen Kindern mit meiner pragmatischen »Alles in Maßen«-Einstellung nicht im Weg stand. Passten meine altmodischen Bullerbü-Vorstellungen zu einer solchen Turbogesellschaft? Und wie weit ließen sich die Grenzen der Belastungsfähigkeit durch den in den Amerikanern so tief verwurzelten »Can do«-Glauben ausdehnen?
Während der vier Highschooljahre meiner Kinder ertappte ich mich immer wieder ratlos angesichts dieser Fragen. Ich lernte, dass das richtige Maß nicht in dem Ausbalancieren von Arbeit und Freizeit lag, sondern im Feinschliff der diversen Anforderungen. Hier ging es um die Kunst, sich akademisch zu fordern, ohne sich zu überfordern oder den Notendurchschnitt zu gefährden. Es ging darum, sich in und durch den Sport zu profilieren und gleichzeitig als Team captain oder Head eines der zahlreichen Schulkomitees seine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Und es war wichtig, sich darüber hinaus noch in irgendeiner Form sozial zu engagieren. Kein Wunder, dass die Kinder ab und an einen sogenannten »mental health day« (einfach mal einen Tag zu Hause) brauchten und ihre größte Herausforderung darin bestand, in ihrem ausgefüllten Alltag Zeit für sich selbst zu finden.
Doch die Erwartungen sind ungeachtet der psychischen und emotionalen Belastungen der in all diesen Disziplinen auf Leistung getrimmten Jugend so hoch wie die Hoffnungen von Schülern und Eltern, es mit ihren sportlichen Leistungen in eine der führenden Universitäten des Landes zu schaffen oder mit einem Sportstipendium die unglaubliche finanzielle Belastung der Familien zu mildern. Damit lastet ein ebenso hoher Druck auf den Schulen, in den verschiedenen Disziplinen wie Hockey, Lacrosse, Football, Rudern oder Crosslauf siegreiche Mannschaften zusammenzustellen und gleichzeitig durch Spenden und Werbung die Kosten für Anlagen und Reisen zu decken. In meinen zahlreichen Gesprächen mit Müttern und Vätern am Spielfeldrand stellte sich heraus, dass es nicht die Einstellung zum Sport ist, die sich über die Jahre verändert hat, sondern die fast schon obsessive Intensität, mit der er heutzutage betrieben wird.
»It’s all a business nowadays«, wird mir erklärt, und in dieser Spirale von Hoffnung, Erfolg und Quoten ist für »pädagogisch wertvoll« nicht mehr viel Platz. Der Lebenslauf beginnt bereits im Kindergarten, auch wenn es am Ende nur wenigen gelingt, sich in einer College-Bewerbung durch sportliche Leistungen von anderen abzuheben. Für die meisten bleibt es ein »race to nowhere« und nicht mehr als ein Sport, der den Großteil ihrer Jugend bestimmt hat. Vielleicht ist da ein wenig Bullerbü doch nicht so schlecht.