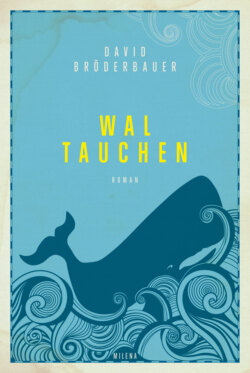Читать книгу WALTAUCHEN - David Bröderbauer - Страница 10
Das große Blau
ОглавлениеDas Gefühl für Zeit und Raum verändert sich beim Tauchen, Distanzen wachsen unter Wasser ins Unendliche. Hundert Meter, die man an der Oberfläche spielend zurücklegt, werden darunter zu einer unüberwindbaren Entfernung. Bleibt man lange unter Wasser, beginnt sich alles zu drehen, man verliert das Gefühl für seine Körpergrenzen und in der Folge die Orientierung. Stille tritt ein, ein Stillstand, ein Zustand intensivierter Wahrnehmung. Die Sinne treten in den Hintergrund, Geschmack und Geruch fallen weg, der Tastsinn wird durch den Neoprenanzug gedämpft. Die Wahrnehmung verlagert sich an die Ränder des Bewusstseins, richtet sich nach innen.
Zum Zeitmesser wird die Lunge, eine Luftuhr, deren beide Hälften gleichzeitig auslaufen. Die Aufmerksamkeit des Freitauchers ist auf sie gerichtet, darauf, die verbleibende Sauerstoffmenge abzuschätzen, zu ermessen, wie rasch die Sauerstoffmoleküle durch die Arterien rieseln. Sie ist ein unzuverlässiger Zeitmesser, der nur Schätzungen zulässt. Man muss sich auf sein Gefühl verlassen und die kleinsten Hinweise deuten lernen. Und doch ist die Lunge genauer als jede Uhr mit Sekunden- und Millisekundenanzeige, denn eine Uhr misst nur die Außenzeit, nicht aber die Zeit, die im Körper vergeht. Hält man den Atem an, wechselt das Körperinnere in eine andere Zeitzone, die Herzfrequenz sinkt, das Blut pulst langsamer durch die Adern, die linke Gehirnhälfte übergibt den Stab an die rechte. Man nimmt nicht mehr wahr, wie die Außenzeit vergeht, man horcht nach innen, und wann immer man das Gefühl hat, jetzt ist die Lunge leer, der Sauerstoff verbraucht, hält man noch ein wenig aus, und noch ein wenig, man spürt nach, ob nicht doch noch eine klein wenig Atemsand vorhanden ist, ob es nicht noch einen Moment geht, ein paar Herzschläge nur. Dann taucht man auf.
Der Grund für die Tauchbegeisterung des Knaben ist ein Spielfilm, den seine Familie an einem Sonntagabend sieht, alle vier vor dem Einbauschrank mit dem Fernsehapparat in seiner Mitte. Der Vater sitzt links vom Fernseher in einem der beiden schweren Couchsessel. Im zweiten Couchsessel sitzen abwechselnd der Bruder und er. Der andere nimmt hinten auf der Bank neben der Mutter Platz. Im Rausch der Tiefe heißt der Film, er handelt von zwei Freitauchern, die sich gegenseitig zu neuen Tiefenrekorden antreiben. Nächte später träumt er noch von der Szene, bei der das Meer durch die Zimmerdecke bricht und den im Tiefenrausch fiebernden Taucher unter sich begräbt. Einer der beiden Hauptdarsteller ist ein sehr männlicher Mann – groß, behaart, selbstbewusst, gespielt von Jean Reno. Der andere, sein Held, ist klein, tapsig, verträumt, unerfahren im Umgang mit Frauen. Den Namen des Schauspielers kann er sich nicht merken. Was sich ihm eingeprägt, ist die Tatsache, dass der Mann auf Stirn und Hinterkopf ansatzweise schütteres Haar hat. Noch keine Glatze, wie sein Vater, dem nur noch an den Seiten Haare wachsen, aber doch ist das Haar des Helden gelichtet. Er kennt keinen anderen Film, in dem der Hauptdarsteller schütteres Haar hat. Außer Actionfilme, aber dann ist es eine Vollglatze, glattrasiert, der Mann muskelbepackt und beinhart. Der Taucher aus Im Rausch der Tiefe ist das alles nicht. Er braucht es auch nicht zu sein, denn mit seiner zurückhaltenden Art hebt er sich so sehr vom gängigen Bild eines Filmhelden ab, dass man gar nicht auf die Idee käme, ihn nach denselben Kriterien zu beurteilen wie einen haarlosen Krieger von der Sorte eines Bruce Willis. Er ist anders, jemand, der in Verbindung zu den Meerestieren steht und mit Delfinen spricht, dem die dunkle Tiefe des Meeres, sein grenzenloser Raum, keine Angst macht. Tauchen kann er wie kein anderer. Tiefer und länger als alle, auch als der männliche, unerschütterliche Jean Reno. Gleichzeitig ist es das Verhängnis des Namenlosen, dass er so anders ist. Er passt nicht in diese Welt. Am Ende des Films verschwindet er bei einem Nachttauchgang in den Tiefen des Meeres. Wohin, weiß man nicht, ob er wiederauftaucht, auch nicht. Das Ende ist offen.
So wie dieser Mann will er sein, seinem Vorbild folgend ist er in das Kinderbecken im Freibad gestiegen. Er spürt, dass er vieles mit ihm gemeinsam hat, so ein Mann liegt in seinem Inneren begraben. Er muss ihn nur befreien, muss nur lange genug im Wasser sein und die Verwandlung wird von selbst stattfinden. Bei seinem Filmhelden ist es auch so. Er muss sich nicht anstrengen, der beste Taucher der Welt zu werden, er ist einfach der Beste, er ist so geboren. Damit er sein Talent entfalten kann, braucht er nur in seinem Element zu sein. Was ihn bremst, ist die Welt außerhalb des Wassers, die voller Störungen ist, voller Lärm, in der jeder etwas von ihm erwartet. Deshalb verschwindet er in der Tiefe, taucht zu den Delfinen, wo er der sein kann, der er wirklich ist.
Ich frage mich, was aus dem Schauspieler geworden ist. Man hat nach diesem Film nicht mehr von ihm gehört. Vor einiger Zeit habe ich mir den Film wieder angesehen. Zufällig war ich online darauf gestoßen. Den musst du sehen, habe ich zu Vera gesagt, die ihn tatsächlich nicht gekannt hat, und wir haben ihn gemeinsam am Laptop geschaut. Die ersten zehn Minuten hat Vera noch stillgehalten, dann hat sie begonnen, erste Bemerkungen zu machen. Ob sich Männer zu Fischen sexuell hingezogen fühlen, hat sie gefragt. Ab der Hälfte des Films, der viel länger gedauert hat, als ich ihn in Erinnerung habe, hat Vera nur noch Witze gerissen. Ein Film für zarte Männerherzen, das passe ja zu mir, hat sie gesagt. Ob mich E-Orgelmusik errege, wollte sie wissen. Ich habe es nicht verstanden. Der Film, der mich damals so begeistert hat, ist mir nun kitschig erschienen, die Charaktere überzeichnet, die Handlung plump, die Filmmusik eine exzessive Orgie aus Synthesizerklängen. Die Delfine sind auf unerträgliche Weise vermenschlicht gewesen, dargestellt, als wären sie unschuldige, friedliche Wesen, dabei ist mittlerweile bekannt, dass gerade beim Menschen beliebte Arten wie der Große Tümmler systematische Vergewaltiger und Kindsmörder sind. Ich habe den Film verteidigt, obwohl ich maßlos enttäuscht gewesen bin, nur um Vera nicht Recht zu geben, und habe ihr erklärt, in den Achtzigern habe man noch extrem wenig über Delfine gewusst. Du immer mit deinen Meerestieren, hat Vera gesagt und den Laptop zugeklappt.
Für den Knaben damals sind alle Meeressäuger wunderbare und vollkommen reine Wesen. Mehr als alle anderen Tiere liebt er sie. Sein größter Traum ist es, einmal einen Wal zu berühren. Immer wieder malt er sich den Moment aus. Er stellt es sich so vor, dass er in einem Boot fährt, das Meer vollkommen ruhig und spiegelglatt, da taucht plötzlich ein Wal neben dem Boot auf, ein riesiger, gebogener Rücken steigt empor, höher als der Bootsrand. Zur Begrüßung stößt der Wal eine Fontäne aus, so kräftig, dass ihm der Luftstoß das Haar zerzaust. Er streicht die nassen Strähnen zur Seite, dann streckt er die Hand aus. Seine Eltern und sein Bruder, die auch im Boot sitzen, starr vor Angst ob des riesigen Ungetiers, heulen auf, aber sie wagen es nicht, ihn zurückzuhalten. Vorsichtig legt er die Hand auf den Rücken des Wals. Die Haut ist weich, sie fühlt sich überraschenderweise warm an, und wenn der Wal seinen Atem ausstößt, vibriert sie. Mit seiner Hand auf dem Rücken begleitet der Wal das Boot. Als er die Hand für einen Moment wegzieht, um eine Strähne aus der Stirn zu wischen, taucht der Wal ab. Er wirft sich halb über den Bootsrand, starrt nach unten, aber der Wal ist verschwunden. Es ist still auf dem Boot, seine Familie sieht ihn immer noch entgeistert an. Plötzlich schießt der Wal – es ist ein Buckelwal, wie er ihn aus dem Fernsehen kennt – vor dem Boot senkrecht aus dem Wasser und stürzt mit einem Krachen auf die Oberfläche zurück. Gischt schießt in die Höhe, seine Eltern und sein Bruder jaulen vor Angst. Er jubiliert und springt im Boot auf und ab, im Gleichklang mit dem Wal, der dem Boot folgend Sprung um Sprung vollführt, bis zum Sonnenuntergang.
In einer noch waghalsigeren Version seines Tagtraums berührt er den Wal nicht vom Boot aus, sondern springt ins Wasser, taucht hinab zu der riesigen, unförmigen Masse, die nicht als Lebewesen zu erkennen wäre, gäbe es nicht dieses große, gütige Auge, dessen Lid er streichelt. Aber ihm ist bewusst, wie unwirklich dieses Szenario ist, kann er doch nicht einmal schwimmen und hätte viel zu viel Angst, ins Wasser zu springen, in das grenzenlose Meer, das ihn in manchen seiner Albträume verschlingt. Nur selten fantasiert er diese Variante.
Wozu Wale und Delfine fähig sind, begeistert ihn ungemein. Obwohl sie wie der Mensch Säugetiere sind und Lungen haben, können sie im Wasser leben, unter Wasser. Mehrere Stunden können Pottwale und Schnabelwale die Luft anhalten, bis auf dreitausend Meter Tiefe tauchen sie in dieser Zeit. Dreitausend Meter! Man muss sich den Druck vorstellen, dem sie standhalten müssen, dazu tauchen sie in vollkommener Dunkelheit, alles mit einem einzigen Atemzug. Dagegen sind die Tauchrekorde des Menschen lächerlich.
Allerdings ist das Luftanhalten an Land auch viel schwieriger als im Wasser. Das erlebt er bei seinen Übungseinheiten hinten im Zimmer. So sehr er sich auch bemüht, gelingt es ihm nicht, die Zeiten aus dem Freibad nur annähernd zu erreichen. Auch das Gefühl des Losgelöstseins will sich nicht mehr einstellen. Er fühlt sich verloren. Erst später lernt er, warum man im Wasser länger die Luft anhalten kann. Man nennt es den Tauchreflex oder amphibischen Reflex, der auf die amphibischen Vorfahren aller Säugetiere zurückgehen soll. Ein Wissenschaftler, der ihn an Robben erforscht hat, war so weit gegangen, ihn den Hauptschalter des Lebens zu nennen. Es hatte sich herausgestellt, dass sich beim Menschen ebenso wie bei anderen Säugetieren die Abläufe im Körper verändern, wenn sie tauchen. Es genügt, dass man das Gesicht unter Wasser hält, schon schaltet der Körper in eine Art Energiesparmodus um – der Parasympathikus wird aktiviert, das Blut zieht sich aus den Gliedmaßen zurück, damit die lebenswichtigen Organe in der Körpermitte besser versorgt werden, das Gehirn schaltet ab. So verbraucht der Taucher weniger Sauerstoff und kann länger unter Wasser bleiben. Gelangt beim Tauchen Wasser durch die Schleuse der Lippen in den Mund, schließt sich automatisch der Kehlkopf, das Wasser kann nicht in die Lunge gelangen. Schon bei Säuglingen funktioniert das. Setzt man sie ins Wasser, tauchen sie von allein, ohne Wasser zu schlucken. Ein tauchender Mensch gleicht einem Raumschiff, das beim Verlassen der Atmosphäre die Verbindungen nach Außen kappt und das Lebenserhaltungssystem aktiviert.
In seinem Zimmer sitzend, weiß der Knabe noch nichts von der Wirkung des Wassers auf die Fähigkeit zu tauchen. Er ist wütend, er ringt mit der Verzweiflung, er verbrennt Sauerstoff. Die Schuld sieht er bei seinem Vater, der unter seinem Fenster den Rasen mäht und ihn stört. Ab und zu sieht der Vater zu seinem Zimmer hoch, das er nach dem gescheiterten Schwimmunterricht am Aichingerteich nur selten verlässt. Aber das Fenster liegt zu hoch, als dass der Vater ihn sehen könnte. Er hingegen kann unentdeckt auf den Vater hinuntersehen, er sieht zu, wie der Vater immer schmälere Rechtecke zieht, bis der letzte Streifen abgemäht ist, wie er den schweren Korb zum Komposthaufen trägt und den feuchten Grasschnitt hineinleert, wie er sich das Gras von den Armen wischt, sich über die kahle Stirn fährt, dabei ein letztes Mal zu seinem Fenster hochsieht und dann den Rasenmäher in den Keller zurückschiebt. Die Störung ist vorbei, zumindest für kurze Zeit. Wenn sein Vater nicht den Rasen mäht, schneidet er Sträucher oder sticht Ameisenbaue aus und wirft sie in die Abfalltonne. Die Lücken bleiben, obwohl der Vater mehrmals Grassamen aussät und den Rasen notfalls bei Nacht bewässert, wenn die Gemeinde in den trockenen Sommerwochen wieder einmal ein Bewässerungsverbot ausruft. Statt Gras wachsen in den Lücken Kräuter, zwischen denen sich wieder Ameisen ansiedeln. Die Kräuter sind so zahlreich, dass es nicht möglich ist, sie alle auszureißen. Ihre gelben und violetten Blüten heben den Rasen von den einheitlich grünen Nachbarsgärten ab. Sie machen sichtbar, dass sein Vater nicht mit seinem Rasen fertig wird. Vielleicht um das wettzumachen, verbringt der Vater so viel Zeit mit Gartenarbeiten. Der Knabe sieht es dem Vater an, dass er die Arbeit nicht gerne macht, dass er die Handgriffe ungeduldig ausführt, der Anblick seines Vaters macht ihm das Luftanhalten unmöglich.
Ist der Vater nicht da, spielt sein Bruder im Garten Fußball. An schulfreien Tagen lädt er Freunde ein, sie spielen ein Match nach dem anderen, sie fordern laut schreiend den Ball und jubeln bei den Toren. Sein Atem stockt während der Tor-Rufe, holpert dem dumpfen Geräusch hinterher, wenn der Ball die Douglasie trifft, die als Torstange dient, folgt seinem regelmäßigen Aufprall auf der Wand unter ihm. Manchmal fliegt der Ball gegen sein Fenster, das berichtet er umgehend seiner Mutter, denn gegen das Fenster zu schießen ist strengstens verboten und wird mit Spielabbruch bestraft. Sind die anderen gegangen, schießt sein Bruder den Ball noch eine Weile gegen die Wand.
Bringt er die nötige Konzentration zum Üben nicht auf, was oft der Fall ist, liest er Geschichten, er liest gerne Heldensagen, am liebsten aber liest er über das Meer und seine Bewohner. Seine Bücher sind voller bunter Illustrationen, manche enthalten auch Fotografien. Niemand in seiner Familie weiß mehr über das Meer, in seiner Klasse auch nicht, nicht einmal die Lehrerin. Er weiß zum Beispiel, dass der Mensch von den Fischen abstammt, deshalb besteht er zu siebzig Prozent aus Wasser. Im Mutterleib – ein Wort, das er lange nicht mit den ihm bekannten Frauenkörpern in Verbindung bringen kann, bis er einmal eine schwangere Frau im Freibad sieht – besitzen die Babys anfangs noch Kiemen. Und nicht ohne Grund schmeckt menschliches Blut salzig. Das Fruchtwasser, so liest er, gleicht in seiner Zusammensetzung dem Meerwasser, werdende Mütter tragen den Ozean in sich. Er betrachtet die Bäuche Schwangerer und stellt sich vor, wie die Babys darin tauchen. Er ist fest davon überzeugt, dass sie alles registrieren, was um sie herum vorgeht, wie die Delfine, die mit ihrem Sonar in absoluter Dunkelheit sehen, die damit sogar in die Körper anderer Lebewesen hineinschauen können. Er fragt sich, ob er als Embryo auch so ein Sonar besessen hat. Aber es sind keine Bilder, keine Sonogramme in seiner Erinnerung abgespeichert. Vielleicht sind die Bäuche auch zu klein für ein richtiges Meer, denkt er, sie erreichen gerade die Größe eines Aquariums, und die Babys, die darin aufwachsen, sind eingepfercht wie Fische hinter Glas.
Auch etwas anderes beschäftigt ihn sehr: Das Meer ist voller Sperma. Dieses Sperma ist eine beunruhigende Sache, es ist einerseits eine Flüssigkeit – Tiere und Menschen besitzen sie, das weiß er – und gleichzeitig ist das Spermium ein kleines Tier, ein Einzeller, etwas wie ein Bakterium, ein Geißeltier, das mit seinem langen Schwanz überallhin schwimmt und das trotz seiner Winzigkeit die Macht besitzt, Leben zu erschaffen. Es ist etwas, das nur Männer besitzen – aber wo? –, und worüber man mit Schulkameraden im Pausenhof verstohlen lachen kann, ohne zu wissen, warum. Ohne das Sperma können keine neuen Tiere entstehen, das weiß er. Es muss an den richtigen Ort gelangen, aus eigener Kraft, damit Lebewesen wachsen können. Um an das Ziel zu gelangen, muss das Spermium, das winzig ist – er vermutet, dass man es deshalb nie sieht –, durch das Meer schwimmen, nachdem es das Meerestier verlassen hat. Allein schwimmt es durch die unendliche Weite. Aber – das ist das Besondere – in Wirklichkeit ist das Sperma nicht allein, alle Meerestiere entlassen nämlich ihr Sperma gleichzeitig ins Wasser. In einer Fernsehdokumentation sieht er, wie bei Vollmond alle Tiere im Korallenriff ihr Sperma freisetzen, so viel, dass sich unter Wasser Wolken aus Sperma bilden. Das Meer ist voller Sperma. Er tut sich schwer mit dieser Vorstellung, denn das Meer ist rein und vollkommen, aber das Sperma ist zumindest beim Menschen – so viel versteht er – etwas Unreines, so weiß es auch ist.
Er beginnt, Versuche mit seinem Atem anzustellen, um länger die Luft anhalten zu können. Er atmet so tief wie möglich und so schnell wie möglich ein, damit sich sein Körper mit Sauerstoff füllt, er will seinen Körper mit Sauerstoff vollpumpen. Sein Kopf beginnt dabei zu dröhnen, ihm wird schwindlig. Er übt ohne Plan, und es gibt Momente, wo er nicht mehr weiß, ob er gerade atmet oder die Luft anhält. Er hat Angst, dass er irgendwann ersticken könnte, weil er vergessen hat, wie man Atem holt.
Den Winter über plagt ihn oft seine Migräne. Nichts hilft dann, außer die Vorhänge zu schließen und sich im Bett zu verkriechen. Wenn die Kopfschmerzen es zulassen, liest er in dem Buch, das er als Trost für sein Kranksein bekommen hat, Die schönsten Sagen des klassischen Altertums. Besonders fasziniert ihn der Kampf um Troja. Die Vorstellung, dass es Troja wirklich gegeben hat, dass man es vor gar nicht so langer Zeit wiederentdeckt hat, fesselt ihn. Niemand kann den wütenden Achill besiegen, dessen Mutter eine Meeresgöttin ist. Blond und bartlos und mit pochenden Schläfen sieht er den Helden vor den Toren Trojas rasen. Ist die Migräne besonders schlimm, legt ihm seine Mutter ein feuchtes Tuch über die Augen, und dazu manchmal ihre kühlende Hand auf die Stirn.